


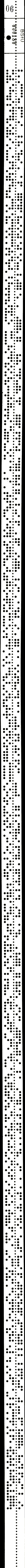
Im Zusammenhang des Chiffrierverfahrens CM-2 und des Chiffrierge- rätes T-301 wurde auch der Name FLIEDER verwendet. Sowie in den Ersatzteillisten für das Chiffriergerät. Das Chiffrierverfahren CM-2 wurde ab Mai 1958 eingesetzt und wurde in der NVA von 1959 bis 1989 und in der SDAG Wismut bis 1980 eingesetzt. Im Jahre 1984 wurden durch das MfNV 85 Geräte an das ZCO zurück- gegeben. Diese Maschinen wurden an das ACO, die mit der Kabine AURORA ausgestattet sind, übergeben. BArch*193 Auch ist dokumentiert der Einsatz im Chiffrierdienst des Minister- rates. In der Beschreibung zum Chiffrierverfahren CM-2 wird das Chiffriergerät T-301 genannt. Die technische Beschreibung aus dem Jahr 1963 für die T-301 beschreibt die elektrischen und mechanischen Vorgänge dieses Chiffriergerätes. Das Chiffriergerät T-304 nutzte das Chiffrierverfahren CM-2. Die T-304 gab es in zwei Ausführungen: BArch*175
| CM-2 | T-304c | kyrillische Tastatur |
| CM-2D | T-304d | lateinische Tastatur |
Das Chiffrierverfahren wird verwendet im individuellen oder zirkularen Verkehr. Das Chiffrierverfahren CM-2 hatte zwei Ausführungen:
Weiter Handbücher zur T-301 bzw. CM-2:
Beim Chiffrierverfahren CM-2 A wurde das Chiffriergerät T-301 verwendet. Für das Chiffrierverfahren CM-2 B wurde die T-304 eingesetzt. In beiden Beschreibungen zum Chiffrierverfahren wird auf die Unterschiede der beiden Verfahren eingegangen. (CM-2 A S.31, CM-2 B S.24) Es besteht die Möglichkeit mit der T-301 bzw. T-304 chiffrierte Sprüche mit der T-304 bzw. T-301 zu dechiffrieren. Der Hauptumdrehungszähler mußte am Monatsende dem Chef Nachrichten gemeldet werden. Mit der T-301/T-304 wurden auch vorchiffrierte Sprüche überchiffriert bzw. überchiffrierte Sprüche dechiffriert. Siehe Codes. Die zu de-, chiffrierende Texte waren reine Buchstabentexte. Ziffern und Zeichen mußten entsprechend als Worte umgesetzt werden. Das Hauptgerät wurde für die CM-1 VASILEK, CM-2 und die modifizierte M-130 KORALLE verwendet. Bei der CM-2 wurde auf die Maschine der Chiffrator mit Schlüssel- lochstreifenleser montiert. Bei der CM-1 und M-130 wurde der Schlüsselscheibenblock montiert.

Abb.: CM-1 aus ©Crypto-World Ausgabe 01/2008 Sammler*70
 |  |  |
Abb.: Netzteilansichten. Sammler*79, *24
Der Schlüssel ist ein fünfkanal Lochstreifen, auch als Additions- bzw. Wurmreihen bezeichnet. Der Aufbau des Schlüsselstreifens ist beschrieben beim Schlüssel- generator T-151.T-301 GRANAT
Chiffriergerät das z. B. im Chiffrierdienst des Ministerrates verwendet wurde. Als Chiffrierverfahren wird das Verfahren CM-2 verwendet. Die Schlüsselunterlagen wurden mit dem Schlüsselgenerator T-151 erzeugt. Aufbau und Besonderheiten der Schlüsselunterlagen sind dort beschrieben. Für die Überprüfung der Kontaktleisten wurde das Gerät T-703 - Kontaktleistenprüfgerät - verwendet. Die mathematische Beschreibung der Chiffrierung bzw. Dechiffrierung lautet: R(Ki) + R(Sj) + R(Ck) ≡ 25 mod 26 Ki = Element des Zwischentextes Sj = Element der Additionsreihe/Wurmreihe, Ck = Element des Chiffretextes
| R(Ki) Rang des Elementes Ki | R(Sj) Rang des Elementes Sj | R(Cj) Rang des Elementes Ck | |||
| R(o)=0 | R(q) =13 | R(ZI) =0 | R(c)=13 | R(l)=0 | R(d)=13 |
| R(g)=1 | R(c) =14 | R(m) =1 | R(k)=14 | R(o)=1 | R(t)=14 |
| R(e)=2 | R(m) =15 | R(a) =2 | R(t)=15 | R(m)=2 | R(u)=15 |
| R(i)=3 | R(ZWR)=16 | R(ZWR)=3 | R(z)=16 | R(j)=3 | R(b)=16 |
| R(a)=4 | R(l) =17 | R(s) =4 | R(l)=17 | R(g)=4 | R(f)=17 |
| R(n)=5 | R(n) =18 | R(i) =5 | R(w)=18 | R(k)=5 | R(s)=18 |
| R(k)=6 | R(w) =19 | R(u) =6 | R(h)=19 | R(e)=6 | R(x)=19 |
| R(z)=7 | R(t) =20 | R(WR) =7 | R(y)=20 | R(a)=7 | R(z)=20 |
| R(h)=8 | R(j) =21 | R(d) =8 | R(p)=21 | R(p)=8 | R(c)=21 |
| R(d)=9 | R(f) =22 | R(r) =9 | R(q)=22 | R(r)=9 | R(v)=22 |
| R(s)=10 | R(y) =23 | R(j) =10 | R(o)=23 | R(w)=10 | R(q)=23 |
| R(v)=11 | R(r) =24 | R(n) =11 | R(b)=24 | R(y)=11 | R(u)=24 |
| R(b)=12 | R(p) =25 | R(f) =12 | R(g)=25 | R(h)=12 | R(i)=25 |
Geheime Verschlußsache
GVS-XI/75/72
Ausfertigung 0393 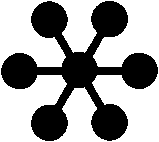 Inhalt: 30 Blatt
Inhalt: 30 Blatt
| Gebrauchsanweisung A zum Verfahren |
| CM-2 |
1. Änderung, GVS ZCO/066/78 eingearbeitet am 27.10.1978 Unterschrift DieGebrauchsanweisung A zum Verfahren CM-2wird erlassen und tritt mit Wirkung vom 1. 5. 1973 in Kraft. Gleichzeitig damit treten dieGebrauchsanweisung CM-2, GVS 946/62 und dieGebrauchsanweisung CM-2, GVS 24/65 außer Kraft und sind bis auf die Urschrift zu vernichten. Berlin, den 1. 5. 1973 Leiter ZCO Schürrmann Oberst
| Inhaltsverzeichnis |
1. Zweckbestimmung 2. Chiffriermittel 2.1. Allgemeines 2.2. Gerätesatz 2.2.1. Auspacken des Gerätes 2.2.2. Wartung des Gerätes 2.2.3. Kontroll- und Sicherungsvorrichtungen 2.2.4. Inbetriebnahme des Gerätes 2.2.5. Funktionskontrolle des Chiffriergerätes 2.2.5.1. Allgemeines 2.2.5.2. Kontrolle in der BetriebsartKlartext2.2.5.3. Kontrolle der Chiffrier-, Kontroll- und Sicherungs-
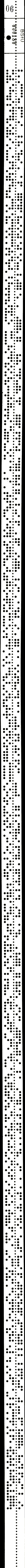
vorrichtungen (KSV)
2.2.6. Verpacken des Gerätes
2.3. Schlüsselunterlagen
2.3.1. Schlüssellochstreifenheft
2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt
2.3.2.1. Aufbau
2.3.2.2. Entnahme
2.3.2.3. Nichtbenutzte Schlüssellochstreifenabschnitte
2.3.2.4. Beschädigte Schlüssellochstreifenabschnitte
2.3.2.5. Vernichtung
2.3.3. Kenngruppentafel
2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen
3. Herrichtung der Klartexte
3.1. Telegrammgliederung
3.2. Kürzungen
3.3. Interpunktionszeichen
3.4. Einfacher Zwischenraum
3.5. Zweifacher Zwischenraum
3.6. Fünffacher Zwischenraum
3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen
3.8. Umlaute und die Schriftzeichen ß und x
3.9. Zahlen und Buchstaben-Ziffernfolgen
3.10. Ordnungszahlen
3.11. Römische Zahlen
3.12. Uhrzeiten
3.13. Monatsangaben
3.14. Jahreszahlen
3.15. Wiederholungen
3.16. Irrungen
3.17. Fortsetzungen
3.18. Bearbeitung von Telegrammen mit zirkularem
und individuellem Text
3.19. Weiterleitungen
4. Herstellung von Klartextlochstreifen
5. Einlegen der Lochstreifen
5.1. Einlegen der Schlüssellochstreifenabschnittes
5.2. Einlegen des Klar- bzw. Chiffriertextlochstreifens
6. Chiffrieren
6.1. Erkennungsgruppen
6.1.1. Kenngruppe
6.1.2. Unterscheidungsgruppe
6.2. Arbeitsablauf beim Chiffrieren
7. Dechiffrieren
7.1. Allgemeines
7.2. Arbeitsablauf beim Dechiffrieren
8. Entstümmelungen
8.1. Entstümmelungsversuche zum Spruchanfang
8.2. Entstümmelung des Chiffretextes vom Blatt
8.3. Entstümmelung des Chiffretextlochstreifens
9. Rückfragen
10. Sicherheitsbestimmungen
10.1. Allgemeines
10.2. Vorkommnisse und Sofortmaßnahmen
11. Beispiele
Abbildungen
Abbildung 1 Schlüssellochstreifenabschnitt
Abbildung 2 Kenngruppentafel
Abbildung 3 rechte Seitenansicht des Gerätes
Abbildung 4 linke Seitenansicht des Gerätes
Abbildung 5 Kennlochstreifenabschnitte
Abbildung 6 Kontrolltext
Abbildung 7 Arbeitsablauf beim Chiffrieren/ind.
Verkehr (Spruchlänge unter
100 Gruppen)
Abbildung 8 Arbeitslauf beim Chiffrieren/zirk.
Verkehr (Spruchlänge über
100 Gruppen)
Abbildung 9 Markierung der Kontrollochstreifen
Abbildungen Schlüsselhefte, Schlüssel-Lochstreifen, Kenngruppentabelle
1. Zweckbestimmung
Das Verfahren CM-2 ist ein maschinelles Chiffrierverfahren für
stationären und mobilen Einsatz.
Es dient unter Berücksichtigung des Abschnittes 3. zur Bearbei-
tung deutscher Klartexte.
Es ist nur Vorchiffrierung möglich.
Das Verfahren CM-2 ist zur Bearbeitung von GVS- und VVS-
Nachrichten zugelassen und gewährleistet bei ordnungsgemäßer
Anwendung absolute Sicherheit für die chiffrierte Nachricht.
Die mit dem Verfahren CM-2 chiffrierten Nachrichten können
mit beliebigen Nachrichtenmitteln, einschließlich über Funk,
übermittelt werden.
Mit dem Verfahren können individuelle und zirkulare Verkehre
abgewickelt werden.
2. Chiffriermittel
2.1. Allgemeines
Zum Verfahren CM-2 gehören folgende Chiffriermittel:
- Chiffriergerät T-301
- Schlüsselunterlagen: Schlüssellochstreifenhefte und Kenngrup-
pentafeln
- Gebrauchsanweisung A zum Verfahren CM-2
2.2. Gerätesatz
Zum Gerätesatz gehören:
- Gerät T-301
- Ersatzteil- und Werkzeugkasten
- Zubehör
2.2.1. Auspacken des Gerätes
Das Auspacken des Gerätes ist in folgender Reihenfolge durch-
zuführen:
-Transportkiste entsiegeln und Verschlüsse öffnen
-Oberteil der Transportkiste abnehmen
-Schutzhaube entsiegeln und Schutzhaube entfernen
2.2.2. Wartung des Gerätes
Die Wartung des Gerätes - außer der täglichen Durchsicht -
und Reparaturen am Gerät am Gerät sind nach gesonderter Vorschrift vom
zugelassenen Personenkreis durchzuführen.
Der Mechaniker hat den für die Durchführung der täglichen
Durchsicht zuständigen Personenkreis entsprechend einzuweisen.
Die tägliche Durchsicht des Gerätes ist bei Dienstbeginn bzw.
Dienstübernahme in folgender Reihenfolge durchzuführen:
(1) Mit einem Lappen oder einem weichen Pinsel den Staub vom
Gehäuse, den offen teilen der Grundplatte, der Tastatur
und vom Transmitter entfernen.
(2) Das Gehäuse abnehmen und den Staub sowie herunterge-
tropftes öl von den Baugruppen entfernen.
(3) Die Kontaktleisten Nr. 2 und 4 sowie die feststehenden Kon-
taktleisten (Ein- und Ausgang) des Chiffrators mit in Spiri-
tus getränkten Mull oder Leinen vom alten Fettfilm befreien
und mit technischer Vaseline einfetten. Bei Bedarf tägliche
Kontrollstelle am Auslösehebel der Hauptwelle mit FS-Ma-
schinenöl ölen.
(4) Das Gehäuse wieder aufsetzen, festschrauben und eine Funk-
tionskontrolle des Gerätes entsprechend Abschnitt 2.2.5. vor-
nehmen.
2.2.3. Kontroll- und Sicherungsvorrichtungen
Durch die Kontroll- und Sicherungsvorrichtungen des Gerätes
wird automatisch folgendes verhindert:
- Mehrmalige Benutzung eines Schlüssellochstreifenabschnittes
zur Chiffrierung von Klartexten
- Chiffrierung eines Klartextes mit einem Schlüssellochstreifen-
abschnitt aus dem Eingangsheft
- Arbeit des Chiffriergerätes in der Betriebsart C
, wenn sich
im Transmitter des Chiffrators kein Schlüssellochstreifenab-
schnitt befindet
- Arbeit des Chiffriergerätes in der Betriebsart C
nach Ende
des Schlüssellochstreifenabschnittes
- Chiffrierung eines Klartextes mit einer Schrittgruppe des
Schlüssellochstreifenabschnittes, wenn dieser nicht mehr
transportiert wird
- Arbeit des Chiffriergerätes in der Betriebsart K
, wenn im
Transmitter des Chiffrators ein Schlüssellochstreifenabschnitt
eingelegt ist.
2.2.4. Inbetriebnahme des Gerätes
Zur Inbetriebnahme des Gerätes sind in der Reihenfolge nach-
stehende Arbeitsgänge durchzuführen:
(1) Ein Blatt Papier in den Wagen einspannen.
(2) Falls notwendig, eine neue Lochstanzrolle einlegen.
Lochstreifenende (mindestens 100 cm) nicht durch den Loch-
streifenkanal des Lochers laufen lassen.
Vor Einlegen der neuen Lochstanzrolle die Papierführung des
Lochers mittels Räumblech säubern.
(3) Die zur Verfügung stehende Stromart (Gleich- oder Wechsel-
strom) und die Netzspannung feststellen.
(4) Den Hebel zur Einstellung des Klartextes in Fünfergruppen
(rechts am Gerät) auf AUS
stellen.
(5) Den Hebel zum Ein- oder Ausschalten des Zeichenzählers mit
Zwischenraumgeber zur Einstellung des Chiffretextes in Fün-
fergruppen (links am Gerät) auf EIN
schalten.
Hebel- und Schalterstellung siehe Abbildung 3 und 4.
Arbeitsgänge bei der Arbeit mit
| Wechselstrom (100 … 250 V) | Gleichstrom (110 V) |
| (1) Hinteren rechten Gehäuse- deckel öffnen und Stromar- tenstecker (mit dem Zeichen ~ nach oben) stecken (siehe Abb. 3). | (1) Hinteren rechten Gehäu- sedeckel öffnen und Stromartenstecker (mit dem Zeichen = nach oben) stecken (siehe Abb. 3). |
| (2) Stromartenschalter an der Stromversorgung auf ~ stellen | (2) Stromartenschalter an der Stromversorgung auf = stellen. |
| (3) Spannungswahlschalter auf die im Arbeitsraum vorhan- dene Netzspannung abschalten. | (3) Netzschalter des Gerätes auf EINschalten. |
| (4) Netzschalter des Gerätes auf EINschalten. | |
| (5) Mittels Spannungswahl- schalter eine Ausgangsspan- nung von 127 ±12,7 V einregeln. |
2.2.5. Funktionskontrolle des Chiffriergerätes
2.2.5.1. Allgemeines
(1) Die Funktionskontrolle des Chiffriergerätes ist täglich bei
Dienstbeginn bzw. bei Dienstübernahme, unabhängig vom
Arbeitsanfall, in der angegebenen Reihenfolge durchzufüh-
ren und nachzuweisen.
Das Chiffriergerät darf nicht zum Chiffrieren verwendet wer-
den, wenn das Ergebnis der Funktionskontrolle vom vorge-
schriebenen abweicht.
Die Funktionskontrolle ist nach Beseitigung der Mängel am
Chiffriergerät (beachte Abschnitt 2.2.2) vollständig zu wieder-
holen.
(2) Zur Funktionskontrolle sind Kontrollochstreifen des festge-
legten Typs zu verwenden. Die Kontrollochstreifen sind in
Abschnitte unterteilt. Jeder Kontrollochstreifenabschnitt kann
bis zu zehnmal zur Funktionskontrolle gewährleistet ist.
Die Kontrollochstreifenabschnitte (Abb. 5) sind der Kassette
zu entnehmen und an den in der Abbildung gekennzeichneten
Stellen zu trennen.
Der Kassette entnommene, noch nicht zur Funktionskontrolle
verwendete Kontrollochstreifenabschnitte sind mit bereits ge-
prüften, fehlerfreien auf Übereinstimmung zu prüfen.
Die Kontrollochstreifen CHIFFR.
und DEKOMB.
sind entspre-
chend Abb. 9 zu markieren.
Nicht verwendbare (fehlerhafte oder abgenutzte) Kontrollochstrei-
fenabschnitte sind nachweislich zu vernichten.
2.2.5.2. Kontrolle in der Betriebsart Klartext
(1) Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen.
(2) Arbeitsartenschalter auf BL
(Blatt/Lochstreifen) schalten.
(3) Betriebsartenschalter auf K
(Klartext) schalten.
(4) Taste WR/Zl
drücken.
Hebel 32. Kombination
einmal drücken.
Knopf Dauerlösung ZwR
drücken und Lochstreifen ca 5 cm
vorlaufen lassen.
(Wagenrücklauf und Zeilenvorschub müssen vom Wagen aus-
geführt und als Schrittgruppen im Lochstreifen gelocht wer-
den. Die 32. Kombination und der Zwischenraum müssen im
Lochstreifen gelocht sein.)
(5) In der Reihenfolge die auf der Tastatur befindlichen Buch-
stabentasten je einmal und abwechselnd die Buchstaben-
taste R
und Y
drücken bis die Zeile aufgefüllt ist.
(Die Buchstabenfolge muß auf dem Blatt ausgedruckt und als
Schrittgruppen im Lochstreifen gelocht werden. Nach dem
59. Zeichen der Zeile muß automatisch Wagenrücklauf und Zeilenvorschub er-
folgen.)
Hebel 32. Kombination
einmal drücken.
Knopf Dauerauslösung ZwR
drücken, Lochstreifen ca. 10 cm vorlaufen lassen
und abreißen.
(6) Erhaltenen Lochstreifen mit der ersten Kombination des Textes über die Abfühl-
stifte in den Transmitter des Dekombinators einlegen und Transmitterklappe
schließen.
Taste EIN
am Transmitter des Dekombinators drücken.
(Die eingegebenen Zeichen müssen auf Blatt ausgedruckt und im Lochstreifen
gelocht werden.)
Jeweils die beiden auf Blatt ausgedruckten Buchstabenfolgen und die beiden im
Lochstreifen gelochten Zeichenfolgen miteinander vergleichen. Sie müssen über-
einstimmen.
2.2.5.3. Kontrolle der Chiffrier-, Kontroll- und Sicherungseinrichtungen (KSV)
(1) Betriebsartenschalter auf C
(Chiffrieren) schalten.
Verschiedene Tasten der Tastatur drücken.
(Die gesamte Tastatur muß blockiert sein.)
(2) Betriebsartenschalter auf K
(Klartext) schalten.
(3) Kontrollochstreifenabschnitt CHIFFR.
(Chiffrator) und DEKOMB.
(Dekombina-
tor) so in den Transmitter des Chiffrators und Dekombinators einlegen, daß
sich bei erstmaliger Verwendung die Einlegemarkierung des jeweiligen Kontroll-
lochstreifenabschnittes über den Abfühlstiften des jeweiligen Transmitters befin-
den. Bei wiederholter Verwendung den Kontrollochstreifenabschnitt CHIFFR.
mit jeweils letzter Sperrlochung über den Stanzstempel und Kontrollochstreifen-
abschnitt DEKOMB.
mit gleichem Abstand zwischen Einlegemarkierung und Ab-
fühlstiften wie erstgenannten, in den Transmitter des Dekombinators einlegen.
Transmitterklappen schließen.
(4) Betriebsartenschalter auf C
(Chiffrieren) schalten. (Sperrlochung muß erfolgen.)
(5) Taste EIN
am Transmitter des Dekombinators drücken.
(Chiffretext, siehe Abb. 6 muß in Fünfergruppen auf Blatt ausgedruckt werden und die
betreffenden Schrittgruppen müssen im Lochstreifen gelocht werden.)
| Bei erstmaliger Verwendung der Streifen den Kontrolloch- streifenabschnitt CHIFFR.festhalten, bevor die vorletzte Gruppe (Buchstabe Y) vollständig ausgedruckt ist.(Das Gerät muß automatisch stoppen.) | Bei wiederholter Verwendung der Streifen muß das Gerät an der gleichen Stelle wie bei erst- maliger Verwendung der Streifen automatisch stoppen. |
(Beim letzten ausgedruckten Buchstaben ist ein Fehldruck möglich, siehe Abb. 6.)
(6) Verschiedene Tasten der Tastatur drücken.
(Die gesamte Tastatur muß blockiert sein.)
(7) Betriebsartenschalter auf K
(Klartext) schalten.
(Im Kontrollochstreifenabschnitt CHIFFR.
erfolgt bei erstmaliger Benutzung eine
Kontrollochung.)
(8) Verschiedene Buchstabentasten der Tastatur drücken.
(Die Hauptwelle des Gerätes darf nicht ausgelöst werden.)
(9) Kontrollochstreifenabschnitte CHIFFR.
und DEKOMB.
entsprechend Markie-
rungen (siehe Abb. 9) neu in die Transmitter einlegen.
(10) Betriebsartenschalter auf D
(Dechiffrieren) schalten.
Verschiedene Tasten der Tastatur drücken.
(Die gesamte Tastatur muß blockiert sein.)
(11) Betriebsartenschalter auf K
(Klartext) schalten.
Taste WR/Zl
drücken.
(Wagenrücklauf und Zeilenvorschub müssen vom Wagen ausgeführt werden.)
(12) Betriebsartenschalter auf D
(Dechiffrieren) schalten.
Taste EIN
am Transmitter des Dekombinators drücken.
(Der erste Teil des Klartextes muß auf dem Blatt ausgedruckt und als Schrittgruppen
im Lochstreifen gelocht werden, siehe Abb. 6. Nach Lesen der 32. Kombination
im Kontrollochstreifenabschnitt DECOMB.
muß das Gerät automatisch stoppen.)
(13) Taste EIN
am Transmitter des Dekombinators drücken.
(Der restliche Teil des Klartextes muß auf dem Blatt ausgedruckt und als Schrittgrup-
pen im Lochstreifen gelocht werden, siehe Abb. 6. Nach Lesen der 32. Kombi-
nation im Kontrollochstreifenabschnitt DECOMB.
muß das Gerät automatisch
stoppen.)
(14) Betriebsartenschalter auf K
(Klartext) schalten.
Transmitterklappe des Chiffrators und des Dekombinators öffnen und die Kon-
trollochstreifenabschnitte aus den Transmittern nehmen.
(15) Knopf Dauerauslösung ZwR
drücken, Lochstreifen ca. 5 cm vorlaufen lassen, ab-
reißen und vernichten.
(16) Netzschalter des Gerätes auf AUS
schalten.
2.2.6. Verpacken des Gerätes
Das Verpacken des Gerätes ist in folgender Reihenfolge durch-
zuführen:
| zum Transport außerhalb
nach Dienstschluß | der Diensträume
(1) Gerät entsprechend den Ab- | (1) Gerät entsprechend den
schnitten 2.2.2. und 2.2.5. | Abschnitten 2.2.2. und
reinigen, abschmieren und | 2.2.5. reinigen und kon-
kontrollieren. | trollieren.
(2) Mechanische Baugruppen in Stoppstellung bringen.
(3) Wagen in die mittlere Stellung führen.
(4) Anschlußstecker des Gerätes unter die obere Gehäuseklappe
legen.
(5) Abfallkasten des Lochers leeren.
(6) Gerät mit Schutzhaube abdecken und versiegeln.
| (7) Oberteil der Transport-
| kiste aufsetzen, Verschluß
| schließen und Transport-
| kiste versiegeln.
2.3. Schlüsselunterlagen
2.3.1. Schlüssellochstreifenheft
Die Additionsreihen, in Form von Schlüssellochstreifenabschnit-
ten (5-Kanallochstreifen), sind in Heften untergebracht. Jedes
Exemplar einer Serie enthält eine Kenngruppentafel, die soviel
Kenngruppen umfaßt wie das Heft Schlüssellochstreifenabschnitte
enthält.
Auf der Verpackung sind folgende Kennzeichnungen enthalten:
- Geheimhaltungsstufe
- MI
(Maschine individuell: Auflage 2),
- MZ
(Maschine zirkular: Auflage 3 und höher)
- Serien- und Exemplarnummer: Ex. 1 dient zum Chiffrieren,
die übrigen Exemplare zum Dechiffrieren.
Auf der Innenseite der Hefte befindet sich Raum für folgende
Eintragungen:
- Nummer des entnommenen Schlüssellochstreifenabschnittes
- Datum der Entnahme des Schlüssellochstreifenabschnittes
- Unterschrift des Bearbeiters.
Das Öffnen der Hefte und die Entnahme von Schlüssellochstrei-
fenabschnitten darf nur erfolgen, wenn sie unmittelbar zum
Chiffrieren bzw. Dechiffrieren verwendet werden sollen.
2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt
2.3.2.1. Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, einzeln durch lichtun-
durchlässiges Papier gegen vorzeitige Einsichtnahme geschützt,
im Heft untergebracht.
Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt enthält 500 Schrittgruppen.
Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, mit 01 beginnend, fort-
laufend numeriert. Sie sind in dieser Reihenfolge zu verwenden.
Die Schlüssellochstreifenabschnitte für die Chiffrierung enthalten
vor der erste Schrittgruppe eine Steuerlochung (Abb. 1).
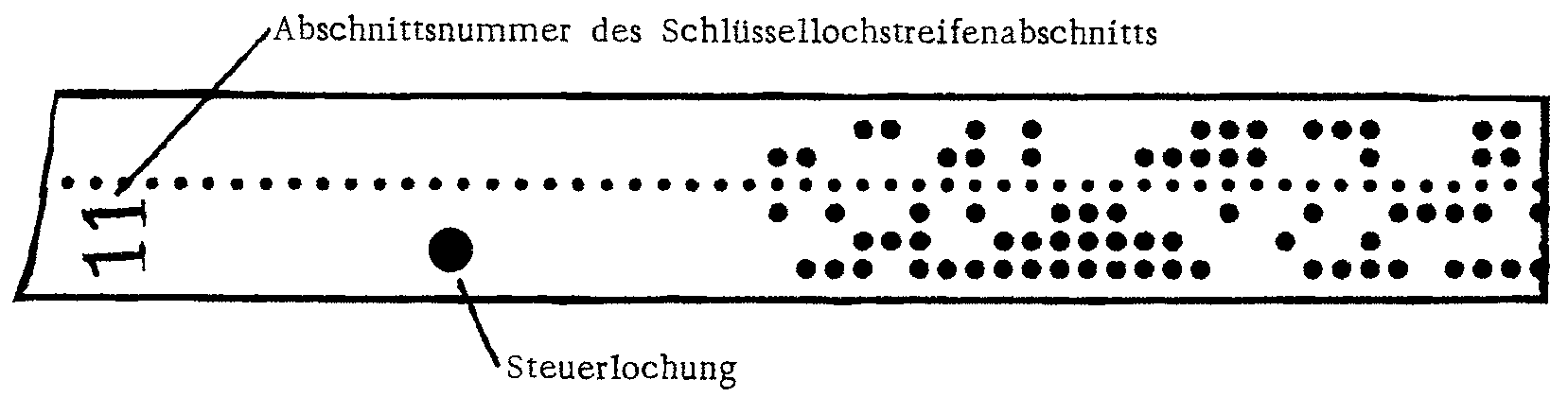
Abb. 1 Schlüssellochstreifenabschnitt
Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt darf zum Chiffrieren nicht
mehr als einmal benutzt werden!
2.3.2.2. Die Entnahme der Schlüssellochstreifenabschnitte ist in der Ent-
nahmetabelle durch Datum und Unterschrift nachzuweisen.
Auf entnommenen Schlüssellochstreifenabschnitten ist die Serien-
nummer des Heftes einzutragen.
2.3.2.3. über freigelegte nicht benutzte Schlüssellochstreifenabschnitte
ist zusätzlich Nachweis zu führen.
Auf dem Heftumschlag ist zu vermerken Nr. …………
bis …… nicht benutzt (Datum, Unterschrift)
.
Falls nicht anders angewiesen, sind diese Schlüssellochstreifen-
abschnitte bis zur Bearbeitung es nächsten Spruches im Heft,
bei Dienstschluß im versiegelten Umschlag beim Schlüsselloch-
streifenheft mit Angabe der Geheimhaltungsstufe (GVS), aufzu-
bewahren.
Bei Benutzung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist auf dem
Heftumschlag zu vermerken Benutzt (Datum, Unterschrift)
.
2.3.2.4. Schlüssellochstreifenabschnitte mit Beschädigungen, die das Chif-
frieren beeinträchtigen, dürfen nicht zum Chiffrieren verwendet
werden. Das Chiffrieren des Klartextes ist dann mit dem nächst-
folgenden noch nicht verwendeten Schlüssellochstreifenabschnitt
neu zu beginnen.
2.3.2.5. Wenn nicht anders angewiesen, sind zur Bearbeitung benutzte
und aus dem Heft gelöste unbenutzte Schlüssellochstreifenab-
schnitte innerhalb von 48 Stunden zu vernichten.
über die Vernichtung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist Nach-
weis zu führen.
2.3.3. Kenngruppentafel
Die Kenngruppentafel ist durch lichtundurchlässiges Papier ge-
gen vorzeitige Einsichtnahme abgesichert, als Tabelle im Heft
befestigt untergebracht.
Die Kenngruppentafel enthält als Kenngruppen fünfstellige Buch-
stabengruppen (lateinisch). Jedem Schlüssellochstreifenabschnitt
des Heftes ist entsprechend der Abschnittsnummer eindeutig eine
Kenngruppe zugeordnet. Die Kenngruppen sind spaltenweise von
oben nach unten, in der Reihenfolge der Spalten von links nach
rechts, aus der Kenngruppentafel zu entnehmen (Abb. 2).
QPVYA | VLHCG | VKAKZ | KHXCA | OXMZV |
TUQKL | GCRCW | XXJBT | MMDLV | IVBVT |
YQHHT | CAQZT | YNGJO | IDWVS | CZREZ |
REMEN | ACFTS | GZDDT | VCTKG | ONEES |
IPYXM | SFTLX | GNENM | OWMYP | QXGBL |
Dem Schlüssellochstreifenabschnitt 11 ist die Kenngruppe
VKAKZ zugeordnet.
Abb. 2 Kenngruppentafel
Die Kenngruppe, die dem zum Chiffrieren benutzten Schlüssel-
lochstreifenabschnitt zugeordnet ist, wird an den Anfang des
Chiffretextes gesetzt.
Werden mehrere Schlüssellochstreifenabschnitte zum Chiffrieren
eines Klartextes verwendet, so wird nur die Kenngruppe des
zuerst benutzten Schlüssellochstreifenabschnittes an den Anfang
des Chiffretextes gesetzt. Kenngruppen benutzter Schlüsselloch-
streifenabschnitte sind in der Kenngruppentafel zu streichen
(Abb. 2).
2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen
Die Leitstelle des Schlüsselbereiches (verantwortliche Chiffrier-
stelle) ordnet den Wechsel und die Außerkraftsetzung von
Schlüsselunterlagen an.
Die Chiffrierstellen haben von der Leitstelle rechtzeitig neue
Schlüsselunterlagen anzufordern, so daß ein kontinuierlicher
Chiffrierverkehr gewährleistet ist.
3. Herrichtung der Klartexte
3.1. Falls nicht anders angewiesen, ist jeder zu chiffrierende Klartext
wie folgt zu gliedern:
(1) VS-Einstufung (VS-Nr.)
(2) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Empfängers
(3) eigentlicher Text (ggf. mit Wiederholungen)
(4) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Absenders.
Im Verkehr der Chiffrierstellen untereinander können Empfän-
ger und Absender weggelassen werden. Dasselbe trifft zu bei
ständig wiederkehrenden Meldungen, Berichten usw. aus denen
klar hervorgeht, wer Empfänger und Absender sind.
3.2. Kürzungen des Klartextes sind statthaft, wenn Sinnentstellungen
ausgeschlossen sind und keine buchstabengetreue Wiedergabe des
Klartextes gefordert wird.
3.3. Die Interpunktionszeichen sind folgendermaßen darzustellen:
, - komma - - strich
· - pkt / - sstrich
: - dkpt
() - kl
Interpunktionszeichen können weggelassen werden, wenn Sinn-
entstellungen ausgeschlossen sind (beachte die Abschnitte 3.4.
und 3.5.).
(Beispiele 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16)
Alle weiteren Zeichen sind als Wörter voll auszuschreiben
(Beispiel 2).
3.4. Einfacher Zwischenraum ist zu ersetzen:
(1) zwischen aufeinanderfolgenden Wörtern, zwischen Stunden-
und Minutenangaben, vor und nach einfachen Zahlenanga-
ben, zwischen gebildeten Zifferngruppen, allgemein gebräuch-
lichen Abkürzungen usw.
(Beispiele 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15);
(2) zwischen Buchstaben wichtiger bzw. schwieriger Eigennamen
(Beispiel 3, 16);
(3) anstelle von Satzzeichen (Bindestrich usw.) bei Orts- und
Straßennamen (Beispiel4).
3.5. Zweifacher Zwischenraum ist zu setzen:
(1) vor und nach Eigennamen, geschlossenen Ausdrücken, Begrif-
fen, Zahlenangaben und Bezeichnungen, die bereits durch
einfache Zwischenräume zum besseren Verständnis oder aus
anderen Gründen unterteilt wurden (Beispiele 1, 3, 4, 5, 13,
14, 15);
(2) vor und nach Wiederholungen von Eigennamen und Bezeichn-
nungen (Beispiel 16).
(3) anstelle des Kommas, wenn Sinnentstellungen ausgeschlossen
sind (Beispiel 15).
3.6. Fünffacher Zwischenraum ist zu setzen, wenn im Klartext ein
Absatz vorgesehen ist.
Die Taste WR/Zl
darf nicht benutzt werden.
3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen sind in der Reih-
henfolge herzurichten, wie sie vom Absender angegeben wurden.
Um bei tabellarischen Aufstellungen die einzelnen Positionen der
Tabellen eindeutig den Spalten zuzuordnen, sind den jeweiligen
Spaltenbenennungen und den zugehörigen Positionen die gleichen
Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets voranzustellen
(Beispiel 5).
bei einfachen Aufzählungen sind arabische Zahlen durch Buch-
staben in der Reihenfolge des Alphabets unter Auslassung des
Buchstabens x zu schreiben (Beispiel 6). Vor und nach diesen
Buchstaben ist ein zweifacher Zwischenraum zu setzten (Beispiel
5).
3.8. Umlaute und die Schriftzeichen ß
und x
sind wie folgt zu ersetzen (Beispiele 4, 7, 9, 10, 13, 14) und bei
gesperrt geschriebenen Wörtern als eine Einheit zu behandeln
(Beispiel 3):
ä - ae ö - oe ü - ue ß - sz x - yy
3.9. Zahlen und Buchstaben-Ziffernfolgen sind in der Reihenfolge
ihrer Elemente, die Ziffern als Zahlwörter bzw. entsprechend
ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiele 1, 4, 8, 9, 10, 16).
Satzzeichen innerhalb von Ziffern- bzw. Buchstaben-Zifferngrup-
pen können, falls Sinnentstellungen ausgeschlossen sind, wegge-
lassen werden (Beispiel 5).
Positionsangaben nach Längen- und Breitengraden sind in der
Reihenfolge - Gradangabe, Minutenangabe, Komma, Zehntel-
minutenangabe, Breiten- bzw. Längenbezeichnungen zu schreiben
(Beispiel 11).
3.10. Ordnungszahlen sind in der Reihenfolge ihrer Ziffern, die Ziffern
als Zahlwörter mit der Abkürzung pkt
bzw. entsprechend
ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 12).
Steht das Tagesdatum so in Verbindung mit der Monatsangabe,
daß Mißverständnisse ausgeschlossen sind, kann die Abkürzung
pkt
entfallen (Beispiel 15).
3.11. Römische Zahlen sind als Grundzahlen zu schreiben.
Vor jeder römischen Zahl ist zur Unterscheidung von Grund-
zahlen die Abkürzung roem
zu setzen (Beispiel 13).
3.12. Bei Uhrzeiten sind
- volle Stunden als zweistellige Zahlen;
- Stunden mit Minutenangaben als vierstellige Zahlen ohne
Satzzeichen
bzw. entsprechend ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 14).
3.13. Monatsangaben sind in folgender Form als Kurzwörter zu
schreiben:
jan, febr, maerz, april, mai, juni, july, aug, sept, okt, nov, dez
(Beispiel 15).
3.14. Jahreszahlen können, sofern Mißverständnisse ausgeschlossen
sind gekürzt oder weggelassen werden (Beispiel 15).
3.15. Wiederholungen von Wörtern (z.B. Eigennamen) und anderen
Zeichengruppen (z.B. polizeiliche Kennzeichen oder Typenbe-
zeichnungen) sind vorzunehmen, wenn durch Verstümmelungen
einzelner Zeichen Sinnentstellungen auftreten könnten oder die
zeichengetreue Wiedergabe er Originalscheibweise gewähr-
leistet sein muß.
Je nach den Anwendungsbedingungen können Wiederholungen
unmittelbar im Anschluß an das zu wiederholende Wort oder an
Wortgruppen angefügt werden (Beispiele 9, 16).
Wichtige Angaben sind zur Vermeidung von Rückfragen durch
eine zweite Wiederholung abzusichern (Beispiel 16). Wiederho-
lungen sind durch das Wiederholungssignal rpt
anzukündigen.
In zu wiederholenden Wörtern sind die Bigramme ae
, oe
,
ue
und sz
, wenn sie mit der Originalschreibweise identisch
sind, zu verdoppeln (Beispiel 16).
3.16. Beim Verschreiben ist das Irrungszeichen vv
zu setzen und
anschließend mit dem berichtigten Wort neu zu beginnen.
3.17. Fortsetzungen sind zu bilden, wenn Klartexte aus praktischen
Erwägungen geteilt werden.
(1) Jeder Teil ist als selbständiger Klartext, d.h. unter Ver-
wendung eines neuen Spruchschlüssels, zu bearbeiten.
(2) Der erste Teil muß enthalten: VS-Einstufung, Empfänger,
den ersten Teil des Textes, der zur Kennzeichnung am Ende
den Fortsetzungsvermerk a ff
erhält, der angibt, daß ein
weiterer Teil folgt.
(3) Jeder weitere Teil ist in der Reihenfolge des Alphabets am
Anfang des Textes mit einem der Buchstaben b
, c
, d
… und am Ende des Textes (außer dem letzten Teil) mit dem
Fortsetzungsvermerk ff
zu kennzeichnen.
(4) der letzte Teil muß den Absender enthalten.
(Beispiel 17)
Werden mehrere Sprüche mit Fortsetzungen gleichzeitig an einen
Empfänger übermittelt, so erhalten die weiteren Sprüche zur
Unterscheidung einen weiteren Buchstaben in der Reihenfolge
des Alphabets zugewiesen (Beispiel 18).
3.18. Zirkulare Telegramme mit individuellen Textteilen sind wie folgt
zu bearbeiten:
(1) Jeweils die zirkularen und individuellen Textteile zusammen-
fassen.
(2) Anstelle des zirkularen Textes im individuellen Text und des
individuellen Textes im zirkularen Text nacheinander die
gleichen Kennzeichen ia
, ib
, ic
… einsetzen.
(3) Die Kennzeichen vom eigentlichen Text durch zweifachen
Zwischenraum trennen.
(4) Die zirkularen und individuellen Textteile getrennt als einen
zirkularen und einen individuellen Spruch bearbeiten.
(Beispiel 19)
3.19. Weiterleitungen sind grundsätzlich nur gestattet, wenn keine di-
rekte Chiffrierverbindung von einer Dienststelle zu einer ande-
ren besteht bzw. die Chiffrierverbindung zeitweilig unterbrochen
ist.
Der Spruch ist dann chiffriert über die nächstvorgesetzte Dienst-
stelle, die mit dem Empfänger Chiffrierverbindung hat, zu Wei-
terleitung zu geben.
(1) Von der absendenden Dienststelle sind wwwww
(Weiter-
leitung) als erste Klartextgruppe, der gesamte letztendliche
Empfänger und der Absender zu chiffrieren.
(2) Von der weiterleitenden Dienststelle ist der dechiffrierte
Spruch mit neuem Spruchschlüssel zu bearbeiten. Der Emp-
fänger und der gesamte ursprüngliche Absender sind zu
chiffrieren.
(Beispiel 20)
4. Herstellung von Klartextlochstreifen
Bei der Herstellung von Klartextlochstreifen sind in der Reihen-
folge nachstehende Arbeitsgänge einzuhalten:
(1) Betriebsartenschalter auf K
(Klartext) schalten.
Arbeitsartenschalter auf BL
(Blatt/Lochstreifen) schalten.
(2) Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen.
(3) Taste WR/Zl
einmal drücken.
Knopf Dauerauslösung ZwR
drücken und Lochstreifen ca.
5 cm vorlaufen lassen.
(4) Hergerichteten Klartext über die Tastatur eintasten.
(5) Nach Eintasten des letzten Klarelements des Klartextes das
Blatt aus dem Wagen spannen.
(6) Hebel für 32. Kombination einmal drücken.
Knopf Dauerauslösung ZwR
drücken und Lochstreifen ca.
10 cm vorlaufen lassen.
Lochstreifen abreißen.
(7) Netzschalter des Gerätes auf AUS
schalten.
Klartextlochstreifen sind deutlich mit der Aufschrift KLAR-
TEXT
zu kennzeichnen!
5. Einlegen der Lochstreifen
5.1. Einlegen des Schlüssellochstreifenabschnittes
(1) Schlüssellochstreifenabschnitt dem Heft entnehmen und
glätten.
(2) Transmitterklappe des Chiffrators öffnen.
(3) Schlüssellochstreifenabschnitt von rechts mit dem Ende, auf
dem die Abschnittsnummer aufgedruckt ist, mit der Nummer
nach oben, in den Transmitter des Chiffrators einlegen.
Die erste Schrittgruppe (von der Nummer aus) muß sich über
den Abfühlstiften des Transmitters des Chiffrators befinden
(bei Schlüssellochstreifenabschnitten mit Steuerlochung muß
sich das Steuerloch einen Schritt vor dem Freigabeabfühlstift
des Transmitters des Chiffrators befinden).
(4) Transmitterklappe des Chiffrators schließen.
5.2. Einlegen des Klar- bzw. Chiffretextlochstreifens
(1) Transmitterklappe des Dekombinators öffnen.
(2) Klar- bzw. Chiffretextlochstreifen so in den Transmitter des
Dekombinators einlegen, daß sich die erste zu bearbeitende
Schrittgruppe über den Abfühlstiften des Transmitters des
Dekombinators befindet.
(3) Transmitterklappe des Dekombinators schließen.
Klartextlochstreifen müssen deutlich mit der Aufschrift KLAR-
TEXT
gekennzeichnet sein!
6. Chiffrieren
6.1. Erkennungsgruppen
Zu den Erkennungsgruppen gehören die Unterscheidungsgruppe
und die Kenngruppe (siehe Abbildungen 7 und 8).
6.1.1. Die Kenngruppe bestimmt die Abschnittsnummer der ersten zu
verwendeten Schlüssellochstreifenabschnittes beim Chiffrieren
und Dechiffrieren.
Sie ist bei Chiffrieren vor die erste Chiffretextgruppe zu setzen.
6.1.2. Die Unterscheidungsgruppe kennzeichnet einen zirkularen Spruch
und besteht aus der fünfstelligen Buchstabengruppe zzzzz
.
Sie ist beim Chiffrieren vor die Kenngruppe zu setzen.
6.2. Arbeitsablauf beim Chiffrieren
| Chiffrieren auf Blatt | Chiffrieren auf Lochstreifen | Chiffrieren auf Blatt und Lochstreifen | |
|---|---|---|---|
| 6.2.1. | Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen. | ||
Arbeitsartenschalter auf B (Blatt) schalten. | Arbeitsartenschalter auf L (Lochstreifen) schalten. | Arbeitsartenschalter auf BL (Blatt/Lochstreifen) schalten. | |
Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. | |||
Knopf Dauerauslösung ZwRdrücken und Lochstreifen ca. 15 cm vorlaufen lassen. | |||
Taste WR/Zleinmal drücken. | |||
Falls zirkularer Spruch, Unterscheidungsgruppe (siehe Abschnitt 6.1.2.) eintasten und Taste ZwR einmal drücken. Kenngruppe eintasten (beachte Abschnitte 2.3.3. und 6.1.1.). Gruppenzähler auf Null stellen. Betriebsartenschalter auf C(Chiffrieren) schalten. (Dadurch werden die x-Taste und die Taste WR/Zlgesperrt. Es erfolgt eine Sperrlochung im Schlüssellochstreifenabschnitt.) | |||
| (Im Chiffretextlochstreifen wird die 32. Kombination gelocht) | |||
| Bei Eingabe des hergerichteten Klartextes über | |||
| die Tastatur | den Transmitter des Dekombinators | ||
| Klartextlochstreifen entsprechend Abschnitt 5.2. in den Transmitter einlegen. | |||
| 6.2.6. | Klartext eintasten. | Taste EINam Transmitter des Dekombinators drücken. | |
| Chiffrieren auf Blatt | Chiffrieren auf Lochstreifen | Chiffrieren auf Blatt und Lochstreifen | |
| 6.2.7. | Bei überschreiten von jeweils 100 Chiffretextgruppen stoppt das Gerät automatisch. Betriebsartenschalter K(Klartext) schalten. Schlüssellochstreifen aus dem Transmitter des Chiffrators herausnehmen. Bei Notwendigkeit ein neues Blatt in den Wagen einspannen. Taste WR/Zleinmal drücken. Folgenden gültigen Schlüssellochstreifenabschnitt entsprechend Abschnitt 5.1. einlegen. Betriebsartenschalter auf C(Chiffrieren) schalten. Folgenden Klartext entsprechend Abschnitt 6.2.6. eingeben. | ||
| 6.2.8. | Unvollständige Gruppe am Ende des Chiffretextes durch Eingabe des Zwischenraumes zur Fünfer- gruppe auffüllen. Gruppenzähler ablesen. | ||
| 6.2.9. | Nach Beenden des Chiffrierens: Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Transmitter des Chiffrators herausnehmen. | ||
| Hebel für 32. Kombination einmal drücken. Knopf Dauerauslösung ZwRdrücken und Lochstreifen ca. 10 cm vorlaufen lassen. | |||
Netzschalter des Gerätes auf AUSschalten. | |||
| Blatt aus dem Wagen spannen. | Lochstreifen abreißen. | Lochstreifen abreißen und Blatt aus dem Wagen spannen. | |
| Für die Nachrichtenübermittlung notwendige Dienstvermerke auf dem | |||
| Blatt (Spruchformular) hand- schriftlich eintragen. | Anfang des Chiffretextloch- streifens handschriftlich eintragen. | Blatt (Spruchformular) bzw. auf dem Anfang des Chiffretextlochstreifens hand- schriftlich eintragen. | |
| 6.2.11. | Chiffretext oder Anfang des Chiffretextes entsprechend Abschnitt 7.2.1. und 7.2.4. ff dechiffrieren, falls eine Kontrolle auf einwandfreies Chiffrieren erforderlich ist. | ||
7. Dechiffrieren
7.1. Allgemeines
Chiffretextlochstreifen, die entsprechend Gebrauchsanweisung
B zum Verfahren CM-2
hergestellt wurden, weisen folgende
wesentliche Besonderheiten auf:
- Beim Vor- und Nachlauf ist anstelle der Steuerkombination
ZwR
die 32. Kombination
enthalten.
- Im Lochstreifen ist vor der Kenn- oder Unterscheidungsgruppe
die Steuerkombination Bu
enthalten.
- Nach jeweils 100 Chiffretextgruppen ist einmal anstelle der
Steuerkombination WR
die Steuerkombination Zl
enthal-
ten.
7.2. Arbeitsablauf beim Dechiffrieren
Folgende Arbeitsgänge sind bei Notwendigkeit und unter Be-
achtung der Art der Vorlage des Chiffretextes in nachstehender
Reihenfolge durchzuführen:
7.2.1. (1) Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen.
(2) Arbeitsartenschalter auf B
(Blatt) bzw. BL
(Blatt/Loch-
streifen) schalten.
(3) Betriebsartenschalter auf K
(Klartext) schalten.
(4) Taste WR/ZI
einmal drücken.
7.2.2. Bei Vorlage des Spruches auf Lochstreifen und Notwendigkeit
der Reproduktion der Erkennungsgruppen:
(1) Lochstreifen mit erster Schrittgruppe der Unterscheidungs-
gruppe bzw. Kenngruppe entsprechend Abschnitt 5.2. in den
Transmitter des Dekombinators einlegen.
(2) Taste EIN
am Transmitter des Dekombinators drücken.
(Erkennungsgruppen, siehe Abschnitt 6.1., werden auf Blatt
ausgeschrieben.)
(3) Taste WR/ZI
einmal drücken.
7.2.3. (1) Anhand des Absenders und der Unterscheidungsgruppe (siehe
Abschnitt 6.1.2.) das Eingangsheft bestimmen.
(2) Anhand der Kenngruppe (siehe Abschnitt 2.3.3.) den ersten
zum Dechiffrieren zu verwendenden Schlüssellochstreifenab-
schnitt bestimmen.
7.2.4. (1) Schlüssellochstreifenabschnitt entsprechend Abschnitt 5.1. ein-
legen.
(2) Betriebsartenschalter auf D
(Dechiffrieren) schalten, Grup-
penzähler auf Null stellen.
7.2.5. Bei Eingabe des Chiffretextes über
| die Tastatur | den Transmitter des Dekombinators | |
|---|---|---|
| (1) Chiffretextlochstreifen mit der ersten Schrittgruppe des Chiffretextes ent- sprechend Abschnitt 5.2. einlegen | ||
| 7.2.6. | Chiffretext eintasten | (2) Taste AUS(Einzelaus- lösung) am Transmitter des Dekombinators mehrmals drücken. |
| (3) Erscheint Klartext: Taste EIN(Dauer- auslösung) am Trans- mitter des Dekombinators einmal drücken. | ||
| (Klartext wird auf Blatt ausgeschrieben.) | ||
| 7.2.7. | Nach Eingabe von genau 100 Chiffretextgruppen stoppt das Ge- rät automatisch. (1) Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. (2) Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Transmitter des Chif- frators herausnehmen. (3) Folgenden gültigen Schlüssellochstreifenabschnitt entspre- chend Abschnitt 5.1. einlegen. (4) Betriebsartenschalter auf D(Dechiffrieren) schalten. | |
Taste EIN(Dauerauslösung) am Transmitter des Dekom- binators einmal drücken. (Steuerkombinationen werden überlesen.) | ||
| (5) Folgenden Chiffretext entsprechend Abschnitt 7.2.6. eingeben. 7.2.8. Nach Beenden des Dechiffrierens: (1) Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. (2) Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Transmitter des Chif- frators herausnehmen. (3) Netzschalter des Gerätes auf AUSschalten. (4) Blatt mit Klartext aus dem Wagen spannen. (5) Im erhaltenen Klartext Verstümmelungen beseitigen und Arbeitsangaben streichen. | ||
| Chiffretextlochstreifen aus dem Transmitter des Dekom- binators herausnehmen. | ||
8. Entstümmelungen
8.1. Entstümmelungsversuche zum Spruchanfang
(1) Überprüfen, ob das Chiffrieren mit dem Schlüssellochstreifen-
abschnitt nächstniedriger oder nächsthöherer Nummerierung
erfolgte.
(2) Überprüfen, ob zum Chiffrieren Schlüsselunterlagen der Chif-
frierverbindung eines anderen möglichen Schlüsselbereiches
verwendet wurden.
(3) Überprüfung der ersten Chiffretextgruppen auf Verstümme-
lungen.
(4) Ist die Kenngruppe im gültigen Schlüssellochstreifenheft bzw.
auf dem ausgedruckten Formular nicht auffindbar, ist es
statthaft, Kenngruppentafeln nächstfolgender Schlüsselloch-
streifenhefte freizulegen.
8.2. Entstümmelung des Chiffretextes vom Blatt
| Art der Verstümmelung | Auswirkung | Beseitigung | |
|---|---|---|---|
| 8.2.1. | Unvollständige Gruppe | Der Klartext ist von dieser Stelle ab Ver- stümmelt, da eine Ver- schiebung der Additions- reihe zum Chiffretext erfolgt ist. | (1) Stelle des fehlenden Buchstabens bzw. der fehlenden Buchstaben feststellen. (2) Beliebige Buchstaben so oft eintasten, bis die Gruppe aufgefüllt ist. |
| 8.2.2. | Gruppe mit mehr als fünf Buchstaben | Siehe Abschnitt 8.2.1. | Stelle der zusätzlichen Buchstaben feststellen, zusätzliche Buchstaben weglassen. |
| 8.2.3. | Fehlende Gruppen | Siehe Abschnitt 8.2.1. | (1) Gruppenanzahl entsprechend Spruchkopf überprüfen. (2) Ab Verstümmelung folgende Gruppe so oft eintasten, bis sinnvoller Klartext erscheint. |
| 8.2.4. | Zusätzliche Gruppen | Siehe Abschnitt 8.2.1. | (1) Gruppenanzahl entsprechend Spruchkopf überprüfen. (2) Gleiche zusätzliche Gruppen im Chiffretext streichen. (3) Werden gleiche Gruppen nicht festgestellt, so ab Verstümmelung nach jeder weiteren eingetasteten Chiffretextgruppe - Schlüssellochstreifenabschnitt mit der Handkurbel um fünf Schrittgruppen zurückdrehen, bis sinnvoller Klartext erscheint; - eine Chiffretextgruppe überspringen, bis sinnvoller Klartext erscheint. |
| 8.3. | Entstümmelung des Chiffretextlochstreifens | ||
| 8.3.1. | Fehlende Chiffretext- schrittgruppen (1) Fehlende Fünfer- gruppen (2) Unvollständige Fünfergruppen | Der Klartext ist von dieser Stelle ab Ver- stümmelung, da eine Ver- schiebung der Additions- reihe zum Chiffretext erfolgt ist. | 1. Möglichkeit Schlüssellochstreifenabschnitt um so viele Schrittgruppen nach vorn transportieren wie Schrittgruppen im Chiffretextlochstreifen fehlen. Der Schlüssellochstreifenabschnitt kann nach vorn transportiert werden, indem - der Hebel schrittweise Transport (siehe Abb. 4) betätigt wird oder - die Handkurbel eingeführt und in Uhr- zeigersinn gedreht wird. eine Umdrehung der Kurbel entspricht dem Transport einer Schrittgruppe. Achtung: Nach entsprechenden Um- drehung ist die Handkurbel wieder aus dem Gerät zu ent- fernen! Auf dem Blatt erschienen anstelle von Buchstaben Zwischenräume. Fehlende Buchstaben sind gegebenenfalls einzusetzen. 2. Möglichkeit Chiffretextlochstreifen um so viele Schritt- gruppen zurücktransportieren, wie Schritt- gruppen im Chiffretextlochstreifen fehlen. Auf dem Blatt erscheinen für fehlende Schrittgrup- pen beliebige Buchstaben. |
| 8.3.2. | Zusätzliche Chiffretext- schrittgruppen (1) Zusätzliche Fünfergruppen. (2) Gruppen mit mehr als fünf Schritt- gruppen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | (1) Feststellen, welche Schrittgruppen zusätz- lich im Chiffretextlochstreifen enthalten sind. Diese Schrittgruppen nicht bearbeiten. Auf Blatt erschienen keine zusätzlichen oder falsche Buchstaben (2) Ist eine Feststellung zusätzlicher Schritt- gruppen nicht möglich, so Chiffretextloch- streifen um so viele Schrittgruppen nach vorn transportieren, wie zusätzliche Schritt- gruppen im Chiffretextlochstreifen ent- halten sind. Auf dem Blatt erscheinen beliebige Buchstaben, die aus dem Zusammenhang zu berichtigen sind. |
| 8.3.3. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen befinden sich die Steuerkombinationen WR, Zl, ZwR im Chiffretextlochstreifen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | |
| 8.3.4. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen befinden sich die 32. Kombination im Chiffretextlochstreifen. | Das Gerät stoppt. Bei erneutem Start er- folgt eine Verschiebung der Additionsreihe zum Chiffretext, und der Klar- text ist verstümmelt. | Siehe Abschnitt 8.3.1. |
| 8.3.5. | Anstelle der Steuer- kombination WR,Zl und ZwR befinden sich Chiffretextschritt- gruppen im Chiffretext- lochstreifen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | Siehe Abschnitt 8.3.2. |
| 8.3.6. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen stehen die Steuerkom- binationen Bu und Zi. | Für diese Steuerkombi- nationen erschient auf Blatt ein Zwischenraum und im Lochstreifen eine 32. Kombination. | Die fehlenden Buchstaben sind aus dem Zusammenhang zu ergänzen. |
| 8.3.7. | Im Chiffretextlochstrei- fen sind zusätzlich die Steuerkombinationen Bu und Zi enthalten. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | Siehe Abschnitt 8.3.2. |
9. Rückfragen
9.1. Eine Rückfrage hat zu erfolgen, wenn in einem empfangenen
Spruch Verstümmelungen enthalten sind, die nicht aus dem
Zusammenhang oder durch Entstümmelungsversuche berichtigt
werden können.
9.2. Es ist offen eine Wiederholung der Übermittlung des Spruches
oder der verstümmelten Gruppen des Spruches bei der absen-
denden Chiffrierstelle anzufordern (Beispiel 21).
Es ist verboten, weiter Mitteilungen offen zu geben.
9.3. Treten nach wiederholter Übermittlung des Spruches oder der
verstümmelten Gruppen des Spruches im Wesentlichen die glei-
chen Fehler auf, und ist ein Dechiffrieren nicht möglich, ist offen
eine Neubearbeitung des Spruches bzw. der betreffenden Teile
des Spruches (nur vollständige Wörter) bei der absendenden Chif-
frierstelle anzufordern (Beispiel 22).
Es ist verboten, weitere Mitteilungen offen zu geben.
Der angeforderte Spruch bzw. die angeforderten Teile des Spru-
ches (nur vollständige Wörter) sind dann von der absendenden
Chiffrierstelle mit neuen Spruchschlüssel zu chiffrieren.
10. Sicherheitsbestimmungen
10.1. Allgemeines
(1) Chiffrierunterlagen sind nach den entsprechenden grundsätz-
lichen Weisungen zu behandeln.
(2) Bei besonderen Vorkommnissen ist vor Einleitung weiterer
Sofortmaßnahmen entsprechend den bestehenden Bestim-
mungen Meldung zu erstatten.
(3) Mitteilungen über Kompromittierung sind bei Übertragung
über Nachrichtenkanäle unter Verwendung der folgenden
für diesen Verkehr vorgesehenen, nichtkompromittierten
Schlüsselunterlagen zu chiffrieren.
10.2. Vorkommnisse und Sofortmaßnahmen
Vorkommnisse Sofortmaßnahmen
(1) Kompromittierung von
Klartext
a) vor Übermittlung: Mitteilung über Kompromittierung an Absender der Nachricht. Weitere
Bearbeitung erst nach Rücksprache mit diesem.
b) durch offene Über- Mitteilung über Kompromittierung an Absender und Empfänger der
mittlung oder nach Nachricht.
Übermittlung:
(2) Kompromittierung
eines Exemplars einer
Schlüsselserie
a) vor Übermittlung Außerkraftsetzung aller Exemplare der betreffenden Schlüsselserie.
damit bearbeiteter
Sprüche:
b) nach Übermittlung Außerkraftsetzung aller Exemplare der betreffenden Schlüsselserie. Mit-
damit bearbeiteter teilung über Kompromittierung an Absender und Empfänger damit
Sprüche: übermittelter Nachrichten.
(3) Kompromittierung von
Schlüssellochstreifen-
abschnitten
a) vor Übermittlung - Bereits bearbeitete Klartexte mit den nächsten für diesen Verkehr
damit bearbeiteter vorgesehenen nichtkompromittierten Schlüssellochstreifenabschnitten
Sprüche: neu chiffrieren.
- Mitteilung über Kompromittierung an Chiffrierstelle(n) desselben
Schlüsselbereiches.
- Kompromittierte Schlüssellochstreifenabschnitte, falls nicht anders an-
gewiesen, innerhalb 48 Stunden vernichten.
b) nach Übermittlung Mitteilung über Kompromittierung der betreffenden Textteile an Ab-
damit bearbeiteter sender und Empfänger der Nachricht.
Sprüche:
(4) Wiederholtes Benutzen
von mehr als 10 Schritt-
gruppen eines Schlüs-
sellochstreifenabschnit-
tes zum Chiffrieren
a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.
des Spruches:
b) und Übermittlung Mitteilung über Kompromittierung der betreffenden Textteile an absen-
des so bearbeiteten dende oder empfangende Chiffrierstelle und Mitteilung an Absender und
Spruches: Empfänger der Nachricht.
(5) Einsetzen einer falschen
Kenngruppe, Chiffrieren
der Kenngruppe, Fehlen
der Kenngruppe
a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.
des Spruches:
b) und Übermittlung Bei Notwendigkeit Mitteilung der richtigen Kenngruppe an empfangende
des Spruches: Chiffrierstelle.
(6) Kompromittierung der Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.
Kenngruppentafel.
(7) Beschädigung des Sie- Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.
gels des Chiffrierge-
rätes durch unbefugte
Personen.
(8) Nichtversiegeln des Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.
Chiffriergerätes bei
Dienstschluß oder
Transport.
(9) Kompromittierung des Sofortmeldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.
Chiffriergerätes.
(10) Chiffrieren und De-
chiffrieren trotz
Mängel am Chiffrier-
gerät
a) ohne Übermittlung - Klartext mit funktionstüchtigem Gerät und noch nicht benutzten
des chiffrierten Schlüsselunterlagen neu bearbeiten.
Spruches: - Reparatur des Gerätes veranlassen.
b) und Übermittlung - Sofortmeldung erforderlich.
des chiffrierten - Ursachen und Auswirkungen des Fehlers ermitteln und die sich dar-
Spruches: aus ergebenden Sofortmaßnahmen durchführen.
- Reparatur des Gerätes veranlassen.
(11) Benutzung verfahrens-
fremder Schlüsselloch-
streifenabschnitte
a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.
des chiffrierten
Spruches:
b) und Übermittlung - Mitteilung über Benutzung falscher Schlüsselunterlagen an Absender
des chiffrierten und Empfänger der Nachricht.
Spruches: - Ursache und Auswirkung des Fehlers ermitteln und die sich dar-
aus ergebenden Sofortmaßnahmen durchführen.
11. Beispiel
Abkürzungen: KT = Klartext
hKT = hergerichteter Klartext
Beispiel 1:
KT: Polizeiliches Kennzeichen IA 07-03 Typ …
hKT: polizeiliches kennzeichen ia nullsieben strich null
drei typ …
Beispiel 2:
KT: … + …… § …
hKT: … plus … paragraph …
Beispiel 3:
KT: … Major Gäbler …
hKT: … major g ae b l e r …
Beispiel 4:
KT: … in Karl-Marx-Stadt Kurt-Fischer-Str. …
hKT: … in karl maryy stadt kurt fischer str …
Beispiel 5:
KT:
| Positions-Nr. | Benennung | Nummer des Teiles |
|---|---|---|
| 16 | Schneckenrad | 16.374.001 |
| 17 | Kegelrad | 18.440.003 |
| 18 | Zwischenwelle | 18.464.000 |
hKT: lies drei spalten a positions nr b benennung c
nummer des Teiles a einssechs b schneckenrad
c einssechs dreisiebenvier nullnulleins a einsie
ben b kegelrad c einsacht vierviernull nullnulldr
ei a einsacht b zwischenwelle c einsacht viers
echsvier nullnullnull
bzw. hKT: lies drei spalten a positions nr b benennung c
nummer des teiles a sechzehn b schneckenrad
c sechzehn dreihundertvierundsiebzig nullnullein
s a siebzehn b kegelrad c achtzehn vierhunder
tvierzig nullnulldrei a achtzehn b zwischenwell
e c achtzehn vierhundervierundsechzig nullnulln
ull
Beispiel 6:
KT: hKT:
1. a
2. b
· ·
· ·
· ·
23. w
24. y
25. z
26. aa
27. ab
· ·
· ·
· ·
Beispiel 7:
KT: Faszbinder fährt über Baerenburg nach Großenhain.
hKT: faszbinder faehrt ueber baerenburg nach groszenha
in pkt
Beispiel 8:
KT: hKT: bzw. hKT:
8 acht acht
11 einseins elf
287 zweiachtsieben zweihundertsiebenu
ndachzig
Beispiel 9:
KT: … D-48 …
hKT: … d strich vieracht …
bzw. hKT: … d strich achtundvierzig …
KT: … BA 137 …
hKT: … ba rpt ba einsdreisieben …
bzw. hKT: … ba einhundertsiebenunddreiszig …
KT: … P 6024 …
hKT: … p sechsnull zwei vier …
bzw. hKT: … p sechzig vierundzwanzig …
KT: … 73 405 …
hKT: … siebendrei viernullfuenf …
bzw. hKT: … dreiundsiebzig vierhundertfuenf …
Beispiel 10:
KT: … 1534568 …
hKT: … eisfuenfdrei vierfuenfsechs acht …
bzw. hKT: … einhudertdreiundfuenfzig vierhundertsechsun
undfuenfzig acht …
Beispiel 11:
KT: … 54° 14,8′ N … … 13° 27′ E …
hKT: … fuenfvier grad einsvier komma acht min n…
… eindrei grad zweisieben min e …
bzw. hKT: … vierundfuenfzig grad vierzehn komma acht m
in m …
… dreizehn grad sienundzwanzig min e …
Beispiel 12:
KT: Der 22. Jahrestag
hKT: der zweizwei pkt jahrestag
bzw. hKT: der zweiundzwanzigste jahrestag
Beispiel 13:
KT: Abshnitt IX/XII …
hKT: abschnitt roem neuen sstrich roem einszwei …
bzw. hKT: abschnitt roem neun sstrich roem zwoelf …
Beispiel 14:
KT: um 9 Uhr … um 7 Uhr 15 Minuten …
hKT: um nullneun uhr … um nullsieben einsfuenf
uhr
bzw. hKT: um neun uhr … um sieben uhr fuenfzehn m
in …
Beispiel 15:
KT: Ankommen am 17.8.1969 um …
hKT: ankommen am einssieben aug sechsneun um …
bzw. hKT: ankommen am siebzehten aug neunundsechzig
um …
KT: … eingetroffen, um die …
hKT: … eingetroffen um die …
bzw. hKT: … eingetroffen komma um die …
Beispiel 16:
KT: Siegfried Lehmann
hKT: l e h m a n n siegfried rpt lehmann
KT: Armin Saeger
hKT: s ae g e r armin rpt saeaeger …
KT: … IA 37-01 befindet sich …
hKT: … ia dreisieben strich nulleins rpt ia befindet
sich …
bzw. hKT: … ia dreisieben strich nulleins rpt ia rpt ia b
findet sich …
Beispiel 17:
Dreiteiliger Klartext:
1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text a ff
2. Teil: b Text ff
3. Teil: c Text Absender
Beispiel 18:
1. Spruch: Vierteiliger Klartext:
1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text aa
ff
2. Teil: ab Text ff
3. Teil: ac Text ff
4. Teil: ad Text Absender
2. Spruch: Dreiteiliger Klartext:
1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text ba
ff
2. Teil: bb Text ff
3. Teil: bc Text Absender
Beispiel 19:
Klartext: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger A, B, C
1. zirkularer Textteil
1. individueller Textteil für A
1. individueller Textteil für B
1. individueller Textteil für C
2. zirkularer Textteil
2. individueller Textteil für A
2. individueller Textteil für B
2. individueller Textteil für C
3. zirkularer Textteil Absender
Zirkularer Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger
(für A, B, C) (allgemein) 1.zirk.Textteil ia 2.zirk.
Textteil ib 3. zirk. Textteil Absen-
der
Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.
(für A) Textteil für A ib 2. ind Textteil
für A
Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.
(für B) Textteil für B ib 2. ind Textteil
für B
Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.
(für B) Textteil für B ib 2. ind Textteil
für B
Beispiel 20:
Schema der Übermittlung
(A) -> (B) -> (C)
Zu chiffrierender Klartext durch Stelle A:
WWWWW VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger C Text
Absender A
Zu chiffrierender Klartext durch Stelle B:
VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger C Text Absen-
der A
Beispiel 21:
Rückfrage: Spruch Nr. … wiederholen
oder
Spruch Nr. … 30. bis 40 Gruppe wieder-
holen
Antwort: Spruch Nr. … (Chiffretext
oder
Spruch Nr. … 30. bis 40. Gruppe (Chiffre-
text)
Beispiel 22:
Spruch Nr. … neu bearbeiten
oder
Spruch Nr. … 12. bis 13. und 21 Gruppe neu bearbeiten
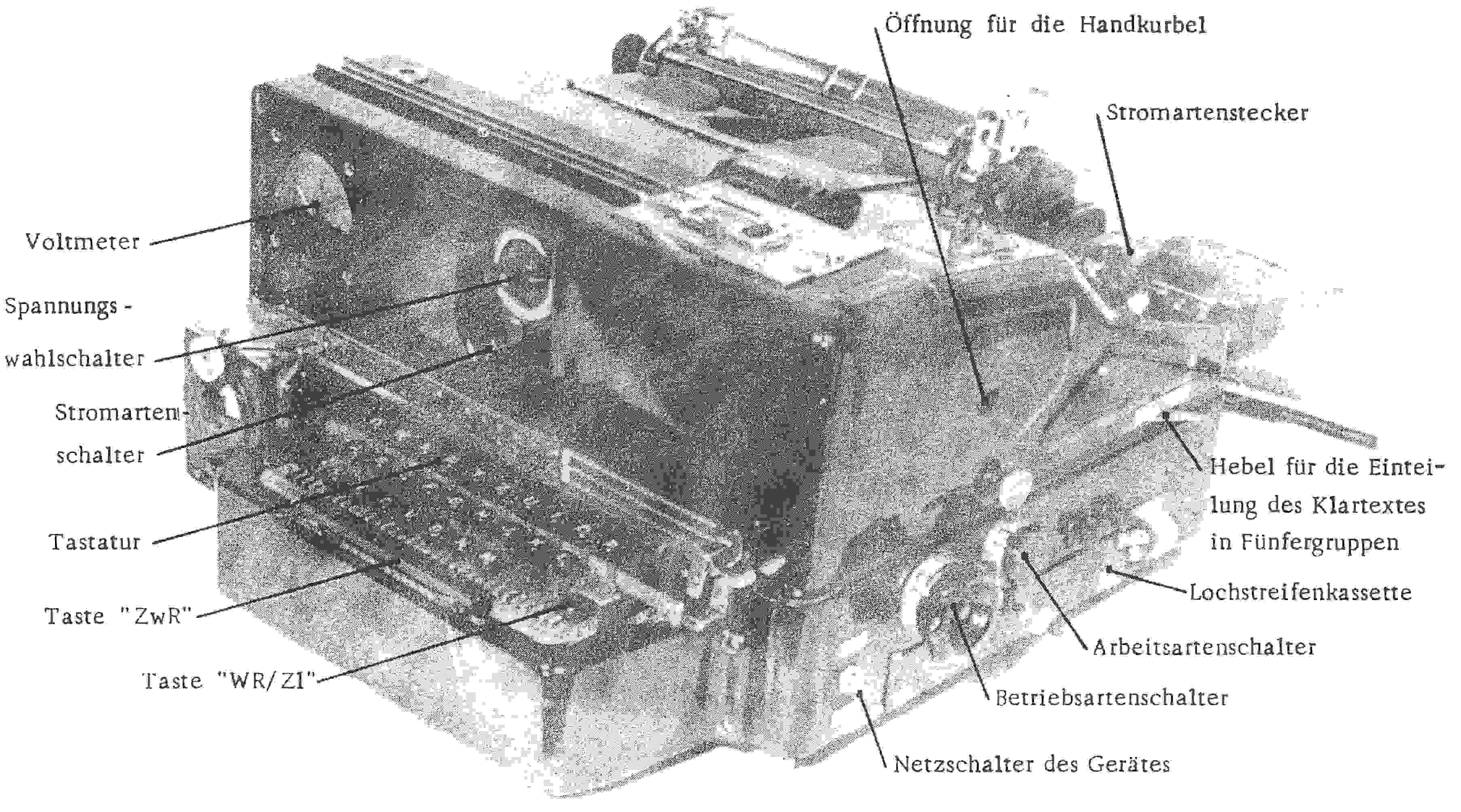
Abbildung 3
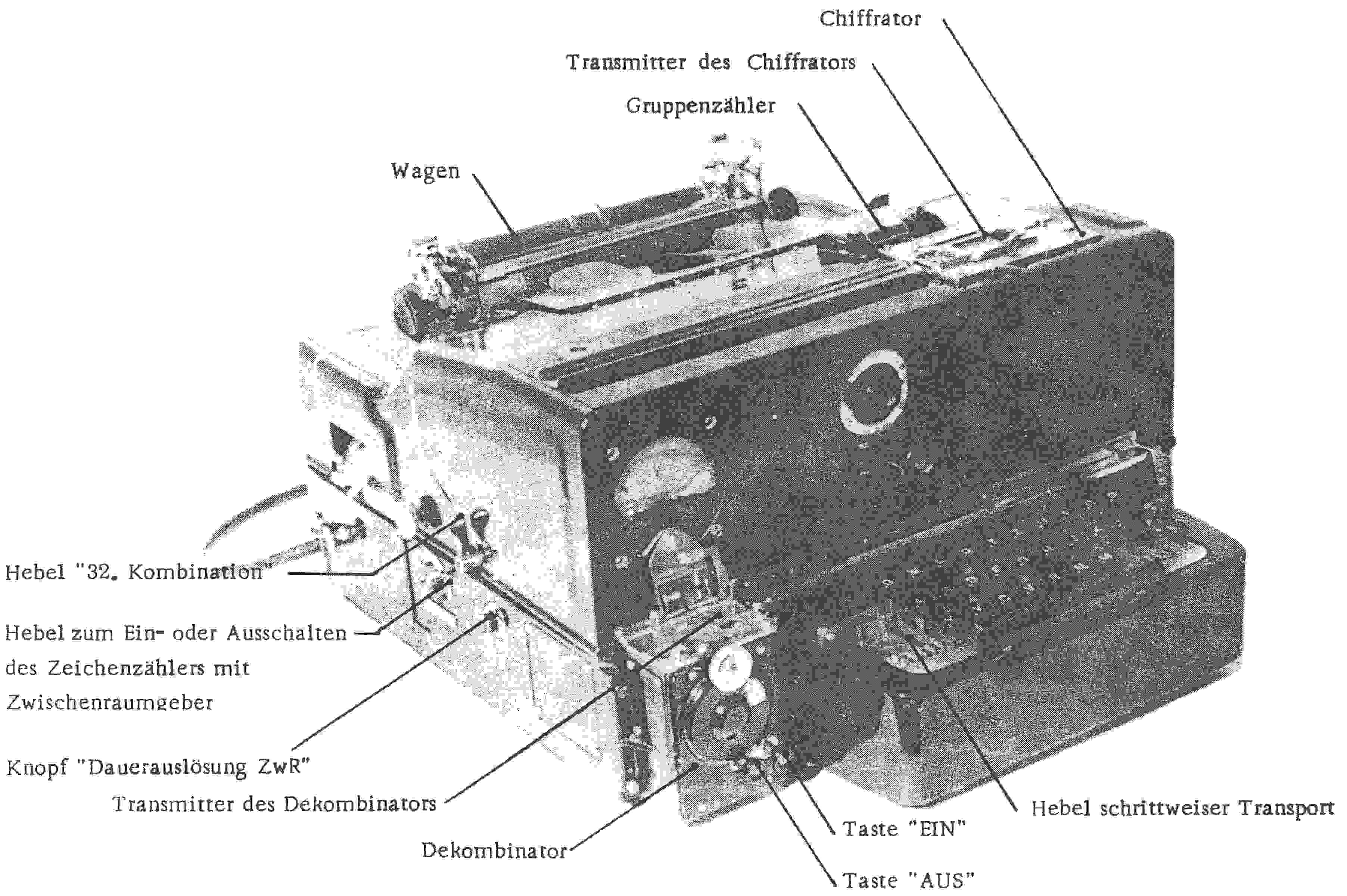
Abbildung 4
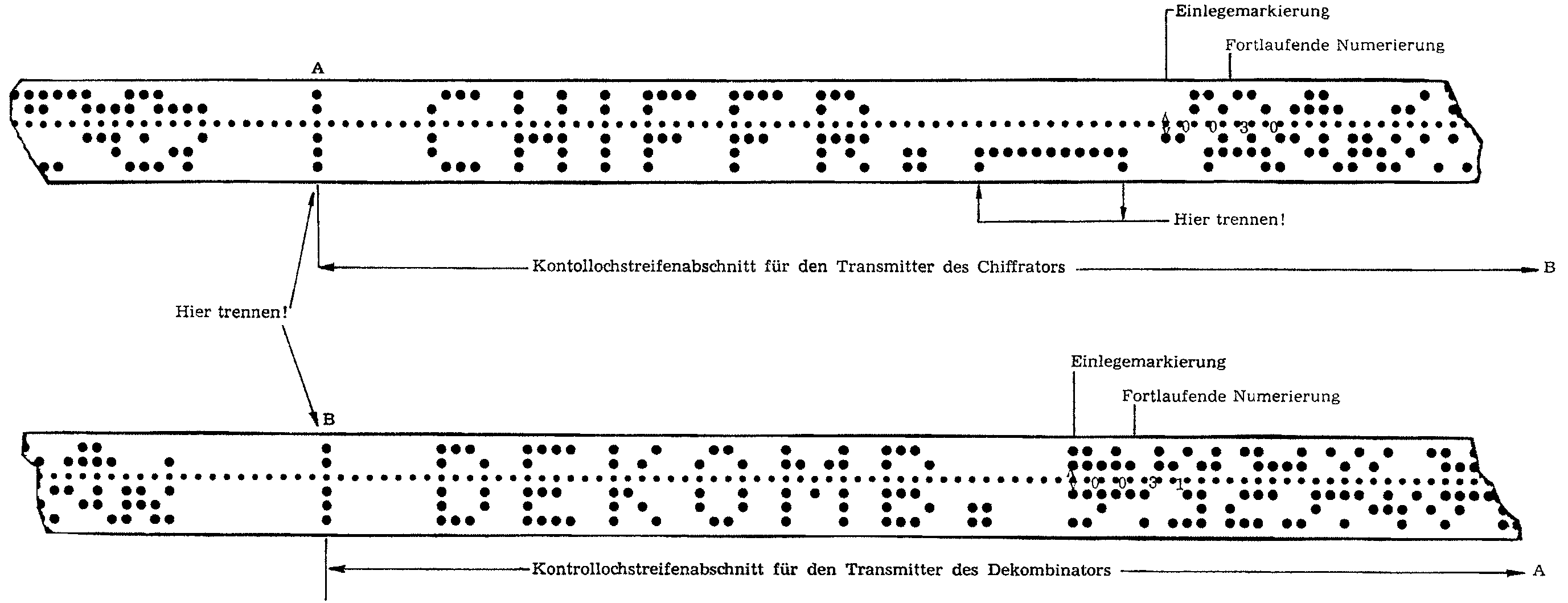
Abbildung 5
Kontrollochstreifenabschnitte
qwertzuioplkjhgfdsayxcvbnmryryryryryryryryryryryryryryryryr
rrrrr rrryy yyyyy yyyrr rrrrr rrree eeeee eeenn nnnnn nnntt
ttttt tttii iiiii iiizz zzzzz zzzrr rrrrr rrryy yo
kaufen sie jede woche vier gute bequeme pelze y
kaufen sie jede woche vier gute bequeme pelze y
Ausgedruckter Chiffre- und Klartext nach dreifacher Benutzung der Kon-
trollochstreifenabschnitte.
(nach jeder Benutzung derselben Kontrollochstreifenabschnitte ergibt sich
eine weiter Verschiebung der ausgedruckten Chiffretextbuchstaben.)
Abbildung 6
Kontrolltext
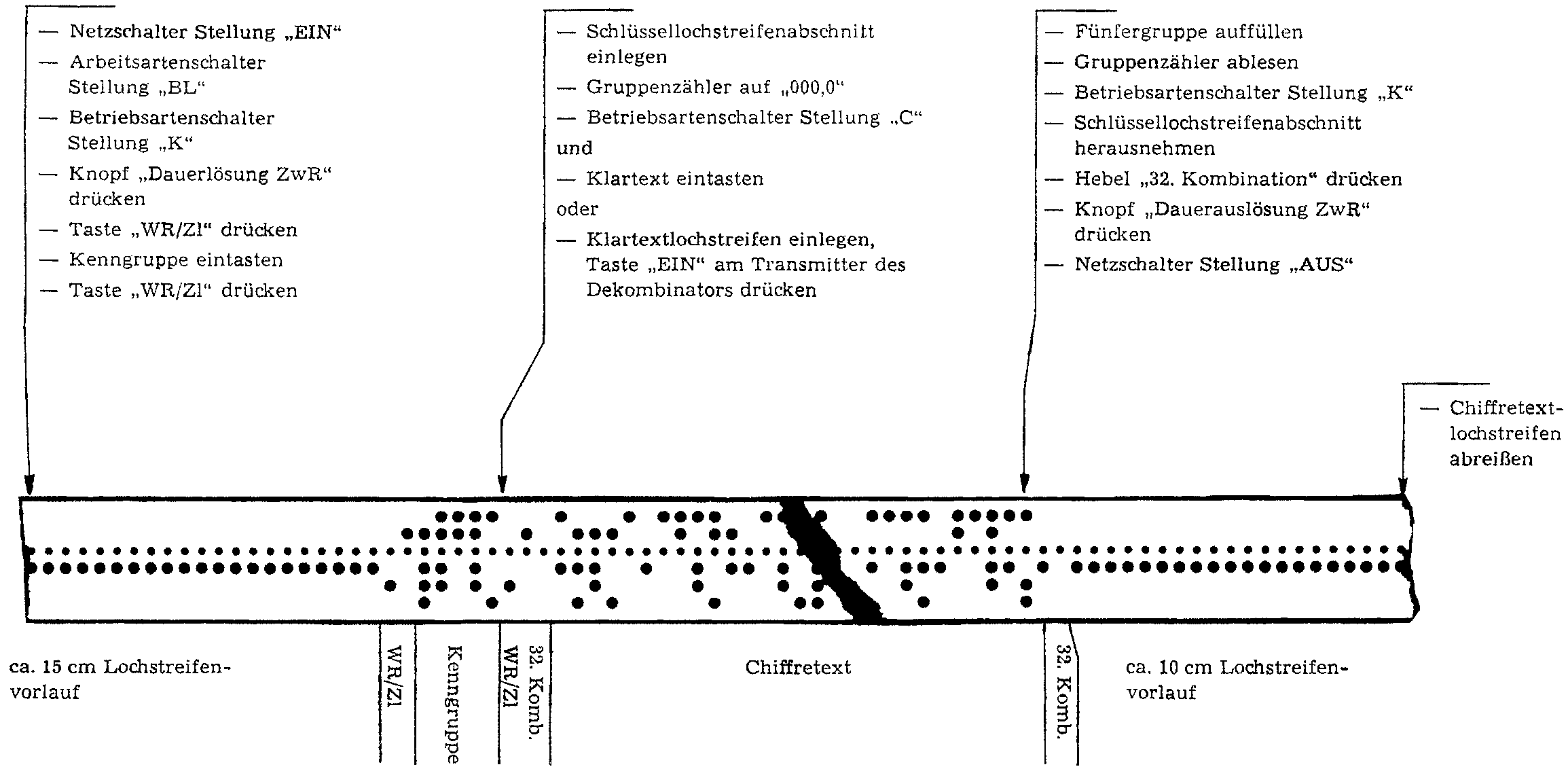
Abbildung 7
Arbeitsablauf beim Chiffrieren / individueller Verkehr (Spruchlänge unter 100 Gruppen)
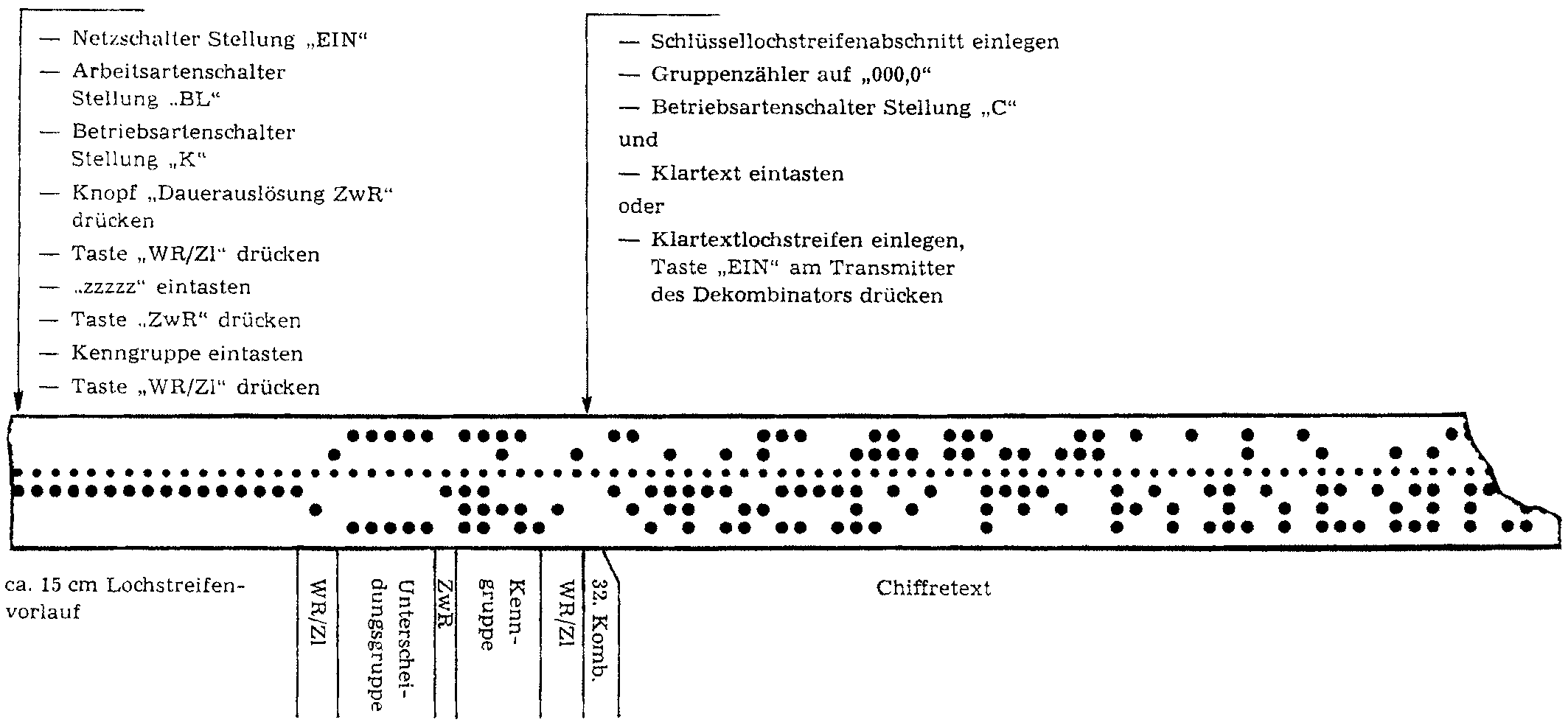
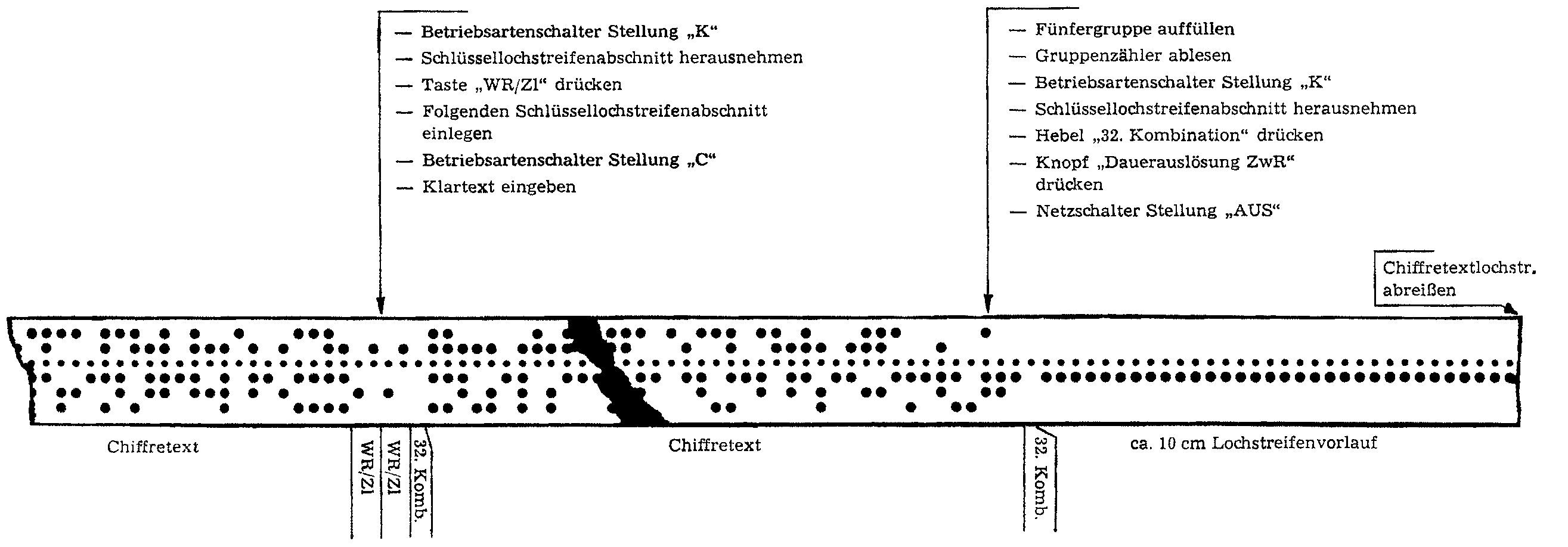
Abbildung 8
Arbeitsablauf beim Chiffrieren / zirkularer Verkehr (Spruchlänge über 100 Gruppen)
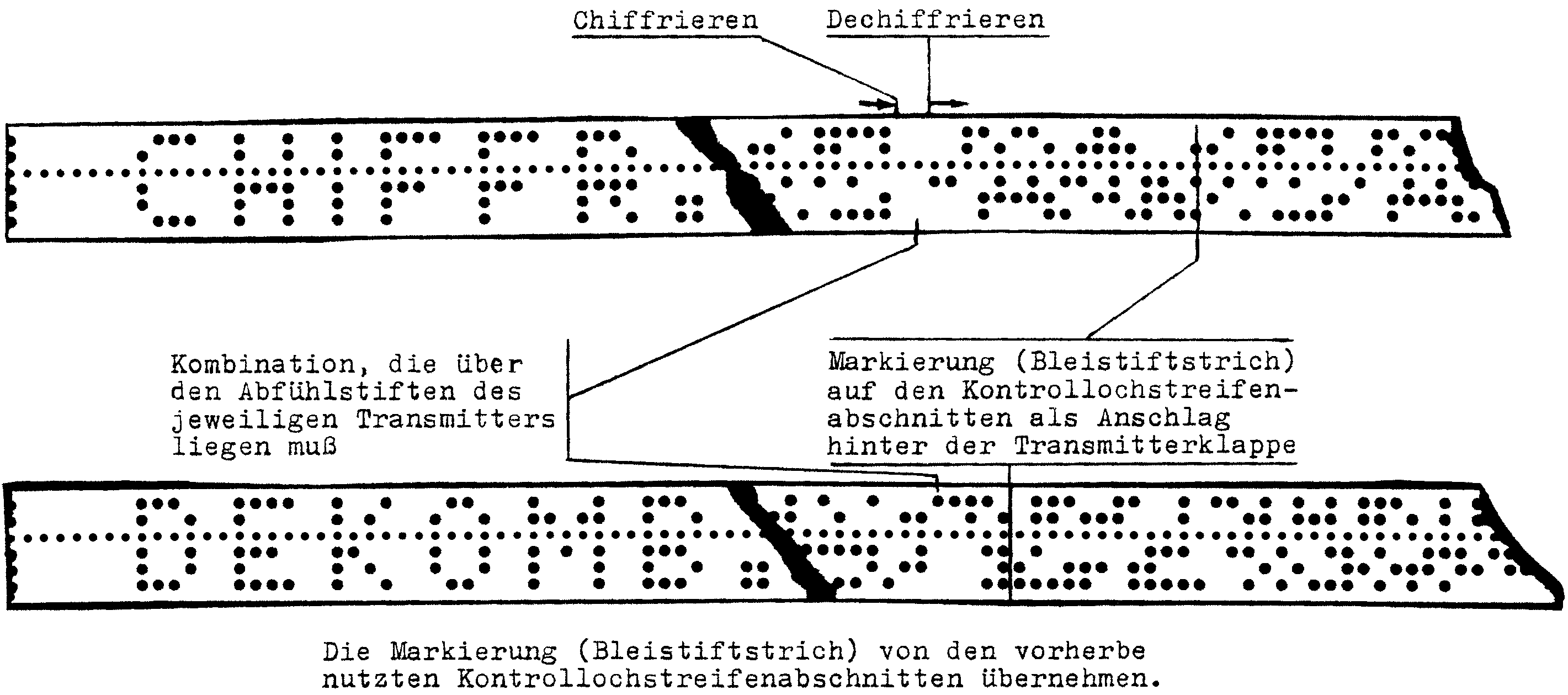
Abbildung 9
Markierung der Kontrollochstreifen
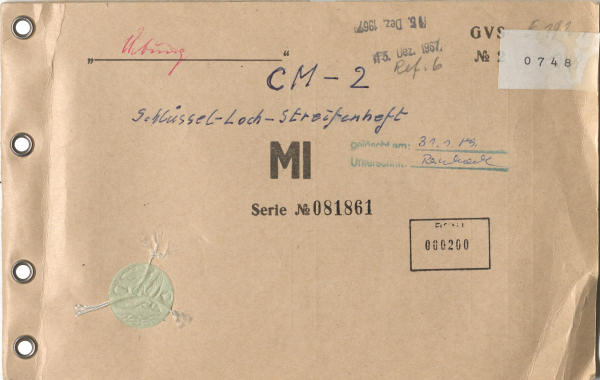
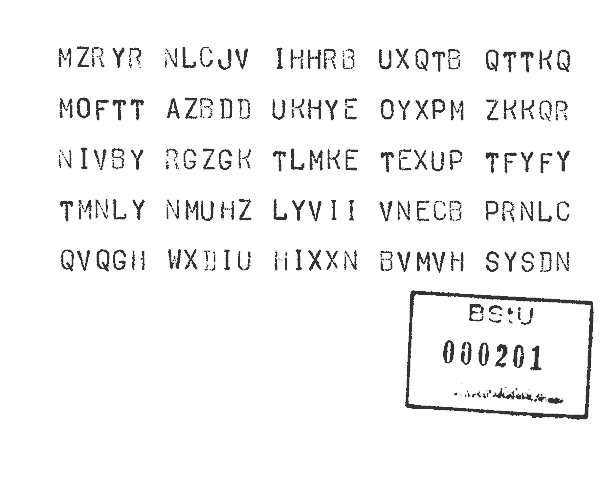
Abbildung des Schlüsselheft Chiffrieren Individuell und Kenngruppentabellen
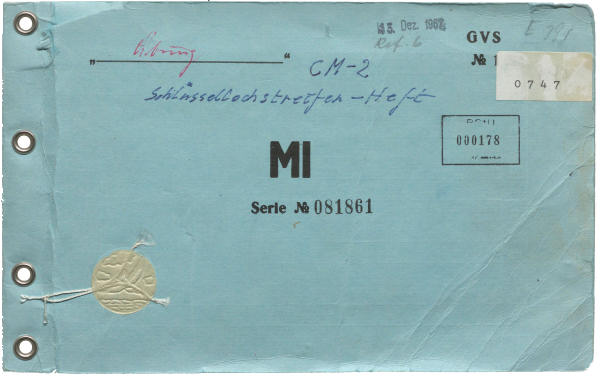
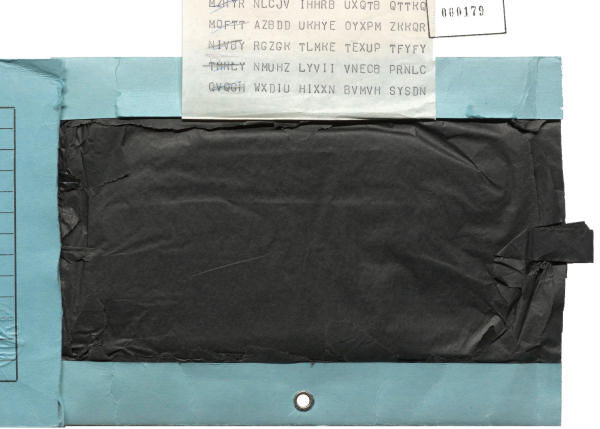
Abbildungen der Schlüsselheft Dechiffrieren Individuell und Kenngruppentabellen
| Zentrales Chiffrierorgan der DDR |
Geheime Verschlußsache!
GVS-XI/144/73
Ausfertigung 0055 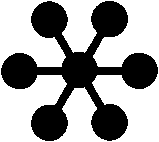 Inhalt: 24 Blatt
Inhalt: 24 Blatt
| Gebrauchsanweisung B zum Verfahren |
| CM-2 |
DieGebrauchsanweisung B zum Verfahren CM-2wird erlassen und tritt mit Wirkung vom 1.5.1973 in Kraft. Berlin, den 1.5.1973 Leiter ZCO Schürrmann Oberst
| Inhaltsverzeichnis |
1. Zweckbestimmung 2. Chiffriermittel 2.1. Allgemeines 2.2. Chiffriergerät T 304 2.3. Schlüsselunterlagen 2.3.1. Schlüssellochstreifenheft 2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt 2.3.2.1. Aufbau 2.3.2.2. Entnahme 2.3.2.3. Nichtbenutzte Schlüssellochstreifenabschnitte 2.3.2.4. Beschädigte Schlüssellochstreifenabschnitte 2.3.2.5. Vernichtung 2.3.3. Kenngruppentafel 2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen 3. Herrichtung der Klartexte 3.1. Telegrammgliederung 3.2. Kürzungen 3.3. Interpunktionszeichen 3.4. Einfacher Zwischenraum 3.5. Zweifacher Zwischenraum 3.6. Fünffacher Zwischenraum 3.7. Aufzählung und tabellarische Aufstellungen 3.8. Umlaute und Schriftzeichenßundx3.9. Zahlen und Buchstabenfolgen 3.10. Ordnungszahlen 3.11. Römische Zahlen 3.12. Uhrzeiten 3.13. Monatsangaben 3.14. Jahreszahlen 3.15. Wiederholungen 3.16. Irrungen 3.17. Fortsetzungen 3.18. Bearbeitung von Telegrammen mit zirkularem und individuellen Text 3.19. Weiterleitungen 4. Herstellung von Klartextlochstreifen 5. Einlegen und Herausnehmen des Lochstreifens 5.1. Einlegen des Lochstreifens 5.2. Herausnehmen des Lochstreifens 6. Chiffrieren 6.1. Erkennungsgruppen 6.1.1. Kenngruppe 6.1.2.. Unterscheidungsgruppe 6.2. Arbeitsablauf beim Chiffrieren 7. Dechiffrieren 7.1. Allgemeines 7.2. Arbeitsablauf beim Dechiffrieren 8. Entstümmelungen 8.1. Entstümmelungsversuche zum Spruchanfang 8.2. Entstümmelung des Chiffretextes vom Blatt 8.3. Entstümmelung des Chiffretextlochstreifens 9. Rückfragen 10. Sicherheitsbestimmungen 10.1. Allgemeines 10.2. Vorkommnisse und Sofortmaßnahmen 11. Beispiele Abbildungen Abbildung 1 Schlüssellochstreifenabschnitt Abbildung 2 Kenngruppentafel Abbildung 3 Arbeitsablauf beim Chiffrieren/ind. Verkehr (Spruchlänge unter 100 Gruppen) Abbildung 4 Arbeitsablauf beim Chiffrieren/zirk. Verkehr (Spruchlänge über 100 Gruppen) 1. Zweckbestimmung Die Gebrauchsanweisung B ermöglicht die Realisierung des Ver- fahrens CM-2 mittels Gerät T-304. Das Verfahren CM-2 mit der Gebrauchsanweisung B gilt für stationären Einsatz und dient unter Berücksichtigung des Ab- schnittes 3. zur Bearbeitung deutscher Klartexte. Mit dem Verfahren CM-2 ist nur Vorchiffrieren möglich. Das Verfahren CM-2 ist zur Bearbeitung von GVS- und VVS- Nachrichten zugelassen und gewährleistet bei ordnungsgemäßer Anwendung absolute Sicherheit für die chiffrierte Nachricht. Die mit dem Verfahren CM-2 chiffrierten Nachrichten können mit beliebigen Nachrichtenmitteln, einschließlich über Funk, übermittelt werden. Mit dem Verfahren können individuelle und zirkulare Verkehre abgewickelt werden. 2. Chiffriermittel 2.1. Allgemeines Zum Verfahren CM-2 gehören folgende Chiffriermittel: - Chiffriergerät T-304 mit VerknüpfungsprogrammVK Bu allg.und Bedienungsanweisung - Schlüsselunterlagen: Schlüssellochstreifenhefte mit Kenngrup- pentafeln - Gebrauchsanweisung B zum Verfahren CM-2 2.2. Chiffriergerät T 304 Die Kenntnis derBedienungsanweisung Chiffriergerät T 304und die ordnungsgemäße Bedienung des benutzten Gerätes wer- den vorausgesetzt. 2.3. Schlüsselunterlagen 2.3.1. Schlüssellochstreifenheft Die Additionsreihen, in Form von Schlüssellochstreifenabschnit- ten (5-Kanallochstreifen), sind in Heften untergebracht. Jedes Exemplar einer Serie enthält eine Kenngruppentafel, die soviel Kenngruppen umfaßt wie das Heft Schlüssellochstreifenabschnitte enthält. Auf der Verpackung sind folgende Kennzeichnungen enthalten: - Geheimhaltungsstufe -MI(Maschine individuell: Auflage 2), -MZ(Maschine zirkular: Auflage 3 und höher) - Serien- und Exemplarnummer: Ex. 1 dient zum Chiffrieren, die übrigen Exemplare zum Dechiffrieren. Auf der Innenseite der Hefte befindet sich Raum für folgende Eintragungen: - Nummer des entnommenen Schlüssellochstreifenabschnittes - Datum der Entnahme des Schlüssellochstreifenabschnittes - Unterschrift des Bearbeiters. Das öffnen der Hefte und die Entnahme von Schlüssellochstrei- fenabschnitten darf nur erfolgen, wenn sie unmittelbar zum Chiffrieren bzw. Dechiffrieren verwendet werden sollen. 2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt 2.3.2.1. Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, einzeln durch lichtun- durchlässiges Papier gegen vorzeitige Einsichtnahme geschützt, im Heft untergebracht. Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt enthält 500 Schrittgruppen. Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, mit 01 beginnend, fort- laufend numeriert. Sie sind in dieser Reihenfolge zu verwenden. Die Schlüssellochstreifenabschnitte für die Chiffrierung enthalten vor der erste Schrittgruppe eine Steuerlochung (Abb. 1).
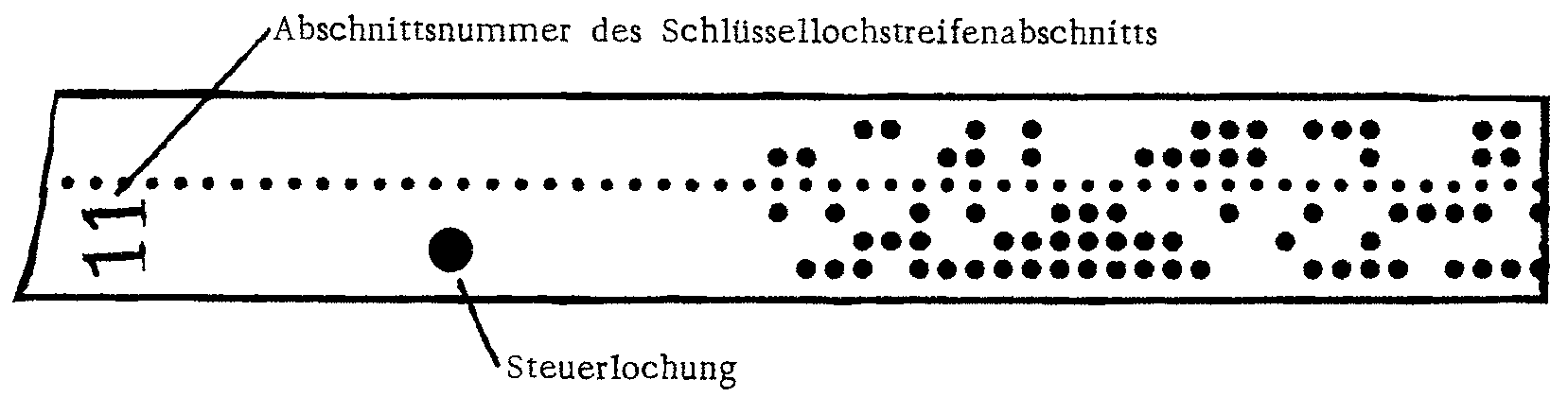
Abb. 1 Schlüssellochstreifenabschnitt
Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt darf zum Chiffrieren nicht
mehr als einmal benutzt werden!
2.3.2.2. Die Entnahme der Schlüssellochstreifenabschnitte ist in der Ent-
nahmetabelle durch Datum und Unterschrift nachzuweisen.
Auf entnommenen Schlüssellochstreifenabschnitten ist die Serien-
nummer des Heftes einzutragen.
2.3.2.3. über freigelegte nicht benutzte Schlüssellochstreifenabschnitte
ist zusätzlich Nachweis zu führen.
Auf dem Heftumschlag ist zu vermerken Nr. …………
bis …… nicht benutzt (Datum, Unterschrift)
.
Falls nicht anders angewiesen, sind diese Schlüssellochstreifen-
abschnitte bis zur Bearbeitung es nächsten Spruches im Heft,
bei Dienstschluß im versiegelten Umschlag beim Schlüsselloch-
streifenheft mit Angabe der Geheimhaltungsstufe (GVS), aufzu-
bewahren.
Bei Benutzung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist auf dem
Heftumschlag zu vermerken Benutzt (Datum, Unterschrift)
.
2.3.2.4. Schlüssellochstreifenabschnitte mit Beschädigungen, die das Chif-
frieren beeinträchtigen, dürfen nicht zum Chiffrieren verwendet
werden. Das Chiffrieren des Klartextes ist dann mit dem nächst-
folgenden noch nicht verwendeten Schlüssellochstreifenabschnitt
neu zu beginnen.
2.3.2.5. Wenn nicht anders angewiesen, sind zur Bearbeitung benutzte
und aus dem Heft gelöste unbenutzte Schlüssellochstreifenab-
schnitte innerhalb von 48 Stunden zu vernichten.
über die Vernichtung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist Nach-
weis zu führen.
2.3.3. Kenngruppentafel
Die Kenngruppentafel ist durch lichtundurchlässiges Papier ge-
gen vorzeitige Einsichtnahme abgesichert, als Tabelle im Heft
befestigt untergebracht.
Die Kenngruppentafel enthält als Kenngruppen fünfstellige Buch-
stabengruppen (lateinisch). Jedem Schlüssellochstreifenabschnitt
des Heftes ist entsprechend der Abschnittsnummer eindeutig eine
Kenngruppe zugeordnet. Die Kenngruppen sind spaltenweise von
oben nach unten, in der Reihenfolge der Spalten von links nach
rechts, aus der Kenngruppentafel zu entnehmen (Abb. 2).
QPVYA | VLHCG | VKAKZ | KHXCA | OXMZV |
TUQKL | GCRCW | XXJBT | MMDLV | IVBVT |
YQHHT | CAQZT | YNGJO | IDWVS | CZREZ |
REMEN | ACFTS | GZDDT | VCTKG | ONEES |
IPYXM | SFTLX | GNENM | OWMYP | QXGBL |
Dem Schlüssellochstreifenabschnitt 11 ist die Kenngruppe
VKAKZ zugeordnet.
Abb. 2 Kenngruppentafel
Die Kenngruppe, die dem zum Chiffrieren benutzten Schlüssel-
lochstreifenabschnitt zugeordnet ist, wird an den Anfang des
Chiffretextes gesetzt.
Werden mehrere Schlüssellochstreifenabschnitte zum Chiffrieren
eines Klartextes verwendet, so wird nur die Kenngruppe des
zuerst benutzten Schlüssellochstreifenabschnittes an den Anfang
des Chiffretextes gesetzt. Kenngruppen benutzter Schlüsselloch-
streifenabschnitte sind in der Kenngruppentafel zu streichen
(Abb. 2).
2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen
Die Leitstelle des Schlüsselbereiches (verantwortliche Chiffrier-
stelle) ordnet den Wechsel und die Außerkraftsetzung von
Schlüsselunterlagen an.
Die Chiffrierstellen haben von der Leitstelle rechtzeitig neue
Schlüsselunterlagen anzufordern, so daß ein kontinuierlicher
Chiffrierverkehr gewährleistet ist.
3. Herrichtung der Klartexte
3.1. Falls nicht anders angewiesen, ist jeder zu chiffrierende Klartext
wie folgt zu gliedern:
(1) VS-Einstufung (VS-Nr.)
(2) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Empfängers
(3) eigentlicher Text (ggf. mit Wiederholungen)
(4) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Absenders.
Im Verkehr der Chiffrierstellen untereinander können Empfän-
ger und Absender weggelassen werden. Dasselbe trifft zu bei
ständig wiederkehrenden Meldungen, Berichten usw. aus denen
klar hervorgeht, wer Empfänger und Absender sind.
3.2. Kürzungen des Klartextes sind statthaft, wenn Sinnentstellungen
ausgeschlossen sind und keine buchstabengetreue Wiedergabe des
Klartextes gefordert wird.
3.3. Die Interpunktionszeichen sind folgendermaßen darzustellen:
, - komma - - strich
· - pkt / - sstrich
: - dkpt
() - kl
Interpunktionszeichen können weggelassen werden, wenn Sinn-
entstellungen ausgeschlossen sind (beachte die Abschnitte 3.4.
und 3.5.).
(Beispiele 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16)
Alle weiteren Zeichen sind als Wörter voll auszuschreiben
(Beispiel 2).
3.4. Einfacher Zwischenraum ist zu ersetzen:
(1) zwischen aufeinanderfolgenden Wörtern, zwischen Stunden-
und Minutenangaben, vor und nach einfachen Zahlenanga-
ben, zwischen gebildeten Zifferngruppen, allgemein gebräuch-
lichen Abkürzungen usw.
(Beispiele 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15);
(2) zwischen Buchstaben wichtiger bzw. schwieriger Eigennamen
(Beispiel 3, 16);
(3) anstelle von Satzzeichen (Bindestrich usw.) bei Orts- und
Straßennamen (Beispiel 4).
3.5. Zweifacher Zwischenraum ist zu setzen:
(1) vor und nach Eigennamen, geschlossenen Ausdrücken, Begrif-
fen, Zahlenangaben und Bezeichnungen, die bereits durch
einfache Zwischenräume zum besseren Verständnis oder aus
anderen Gründen unterteilt wurden (Beispiele 1, 3, 4, 5, 13,
14, 15);
(2) vor und nach Wiederholungen von Eigennamen und Bezeich-
nungen (Beispiel 16).
(3) anstelle des Kommas, wenn Sinnentstellungen ausgeschlossen
sind (Beispiel 15).
3.6. Fünffacher Zwischenraum ist zu setzen, wenn im Klartext ein
Absatz vorgesehen ist.
Die Schreibwerktaste  darf nicht benutzt werden.
3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen sind in der Reih-
henfolge herzurichten, wie sie vom Absender angegeben wurden.
Um bei tabellarischen Aufstellungen die einzelnen Positionen der
Tabellen eindeutig den Spalten zuzuordnen, sind den jeweiligen
Spaltenbenennungen und den zugehörigen Positionen die gleichen
Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets voranzustellen
(Beispiel 5).
Bei einfachen Aufzählungen sind arabische Zahlen durch Buch-
staben in der Reihenfolge des Alphabets unter Auslassung des
Buchstabens x zu schreiben (Beispiel 6). Vor und nach diesen Buch-
staben ist ein zweifacher Zwischenraum zu setzen (Beispiel 5).
3.8. Umlaute und die Schriftzeichen
darf nicht benutzt werden.
3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen sind in der Reih-
henfolge herzurichten, wie sie vom Absender angegeben wurden.
Um bei tabellarischen Aufstellungen die einzelnen Positionen der
Tabellen eindeutig den Spalten zuzuordnen, sind den jeweiligen
Spaltenbenennungen und den zugehörigen Positionen die gleichen
Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets voranzustellen
(Beispiel 5).
Bei einfachen Aufzählungen sind arabische Zahlen durch Buch-
staben in der Reihenfolge des Alphabets unter Auslassung des
Buchstabens x zu schreiben (Beispiel 6). Vor und nach diesen Buch-
staben ist ein zweifacher Zwischenraum zu setzen (Beispiel 5).
3.8. Umlaute und die Schriftzeichen ß
und x
sind wie folgt zu ersetzen (Beispiele 4, 7, 9, 10, 13, 14) und bei
gesperrt geschriebenen Wörtern als eine Einheit zu behandeln
(Beispiel 3):
ä - ae ö - oe ü - ue ß - sz x - yy
3.9. Zahlen und Buchstaben-Ziffernfolgen sind in der Reihenfolge
ihrer Elemente, die Ziffern als Zahlwörter bzw. entsprechend
ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiele 1, 4, 8, 9, 10, 16).
Satzzeichen innerhalb von Ziffern- bzw. Buchstaben-Zifferngrup-
pen können, falls Sinnentstellungen ausgeschlossen sind, wegge-
lassen und durch Zwischenräume ersetzt werden (Beispiel 5).
Positionsangaben nach Längen- und Breitengraden sind in der
Reihenfolge - Gradangabe, Minutenangabe, Komma, Zehntel-
minutenangabe, Breiten- bzw. Längenbezeichnungen zu schreiben
(Beispiel 11).
3.10. Ordnungszahlen sind in der Reihenfolge ihrer Ziffern, die Ziffern
als Zahlwörter mit der Abkürzung pkt
bzw. entsprechend
ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 12).
Steht das Tagesdatum so in Verbindung mit der Monatsangabe,
daß Mißverständnisse ausgeschlossen sind, kann die Abkürzung
pkt
entfallen (Beispiel 15).
3.11. Römische Zahlen sind als Grundzahlen zu schreiben.
Vor jeder römischen Zahl ist zur Unterscheidung von Grund-
zahlen die Abkürzung roem
zu setzen (Beispiel 13).
3.12. Bei Uhrzeiten sind
- volle Stunden als zweistellige Zahlen;
- Stunden mit Minutenangaben als vierstellige Zahlen ohne
Satzzeichen
bzw. entsprechend ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 14).
3.13. Monatsangaben sind in folgender Form als Kurzwörter zu
schreiben:
jan, febr, maerz, april, mai, juni, july, aug, sept, okt, nov, dez
(Beispiel 15).
3.14. Jahreszahlen können, sofern Mißverständnisse ausgeschlossen
sind gekürzt oder weggelassen werden (Beispiel 15).
3.15. Wiederholungen von Wörtern (z.B. Eigennamen) und anderen
Zeichengruppen (z.B. polizeiliche Kennzeichen oder Typenbe-
zeichnungen) sind vorzunehmen, wenn durch Verstümmelungen
einzelner Zeichen Sinnentstellungen auftreten könnten oder die
zeichengetreue Wiedergabe er Originalschreibweise gewähr-
leistet sein muß.
Je nach den Anwendungsbedingungen können Wiederholungen
unmittelbar im Anschluß an das zu wiederholende Wort oder an
Wortgruppen angefügt werden (Beispiele 9, 16).
Wichtige Angaben sind zur Vermeidung von Rückfragen durch
eine zweite Wiederholung abzusichern (Beispiel 16). Wiederho-
lungen sind durch das Wiederholungssignal rpt
anzukündigen.
In zu wiederholenden Wörtern sind die Bigramme ae
, oe
,
ue
und sz
, wenn sie mit der Originalschreibweise identisch
sind, zu verdoppeln (Beispiel 16).
3.16. Beim Verschreiben ist das Irrungszeichen vv
zu setzen und
anschließend mit dem berichtigten Wort neu zu beginnen.
3.17. Fortsetzungen sind zu bilden, wenn Klartexte aus praktischen
Erwägungen geteilt werden.
(1) Jeder Teil ist als selbständiger Klartext, d.h. unter Ver-
wendung eines neuen Spruchschlüssels, zu bearbeiten.
(2) Der erste Teil muß enthalten: VS-Einstufung, Empfänger,
den ersten Teil des Textes, der zur Kennzeichnung am Ende
den Fortsetzungsvermerk a ff
erhält, der angibt, daß ein
weiterer Teil folgt.
(3) Jeder weitere Teil ist in der Reihenfolge des Alphabets am
Anfang des Textes mit einem der Buchstaben b
, c
, d
… und am Ende des Textes (außer dem letzten Teil) mit dem
Fortsetzungsvermerk ff
zu kennzeichnen.
(4) der letzte Teil muß den Absender enthalten.
(Beispiel 17)
Werden mehrere Sprüche mit Fortsetzungen gleichzeitig an einen
Empfänger übermittelt, so erhalten die weiteren Sprüche zur
Unterscheidung einen weiteren Buchstaben in der Reihenfolge
des Alphabets zugewiesen (Beispiel 18).
3.18. Zirkulare Telegramme mit individuellen Textteilen sind wie folgt
zu bearbeiten:
(1) Jeweils die zirkularen und individuellen Textteile zusammen-
fassen.
(2) Anstelle des zirkularen Textes im individuellen Text und des
individuellen Textes im zirkularen Text nacheinander die
gleichen Kennzeichen ia
, ib
, ic
… einsetzen.
(3) Die Kennzeichen vom eigentlichen Text durch zweifachen
Zwischenraum trennen.
(4) Die zirkularen und individuellen Textteile getrennt als einen
zirkularen und einen individuellen Spruch bearbeiten.
(Beispiel 19)
3.19. Weiterleitungen sind grundsätzlich nur gestattet, wenn keine di-
rekte Chiffrierverbindung von einer Dienststelle zu einer ande-
ren besteht bzw. die Chiffrierverbindung zeitweilig unterbrochen
ist.
Der Spruch ist dann chiffriert über die nächstvorgesetzte Dienst-
stelle, die mit dem Empfänger Chiffrierverbindung hat, zu Wei-
terleitung zu geben.
(1) Von der absendenden Dienststelle sind wwwww
(Weiter-
leitung) als erste Klartextgruppe, der gesamte letztendliche
Empfänger und der Absender zu chiffrieren.
(2) Von der weiterleitenden Dienststelle ist der dechiffrierte
Spruch mit neuem Spruchschlüssel zu bearbeiten. Der Emp-
fänger und der gesamte ursprüngliche Absender sind zu
chiffrieren.
(Beispiel 20)
4. Herstellung von Klartextlochstreifen
Bei der Herstellung von Klartextlochstreifen sind in der Reihen-
folge nachstehende Arbeitsgänge einzuhalten:
(1) Taste EIN
am Gerät drücken.
(2) Ein Blatt Papier in den Wagen einspannen.
(3) Schreibwerktaste Bu
und  drücken.
(4) Taste
drücken.
(4) Taste S-Lo
drücken.
(5) taste Vorlauf D
drücken und Lochstreifen ca. 10 cm vor-
laufen lassen.
(6) Hergerichteten Klartext über die Tastatur eintasten.
(7) Nach Eintasten des letzten Klarelements des Klartextes:
Taste Vorlauf E
einmal drücken.
(8) Taste Vorlauf D
drücken und Lochstreifen ca. 30 cm vor-
laufen lassen.
(9) Klartextlochstreifen deutlich mit der Aufschrift KLAR-
TEXT
kennzeichnen.
(10) Lochstreifen abreißen und Blatt mit Klartext aus dem Wa-
gen spannen.
(11) Taste S-Lo
herausnehmen.
(12) Taste AUS
am Gerät drücken.
5. Einlegen und Herausnehmen des Lochstreifens
5.1. Einlegen des Lochstreifens
Der Lochstreifen kann bei eingeschaltetem Gerät und muß bei
gedrückter Taste Stopp
eingelegt werden.
(1) Leserklappe des Lesers öffnen.
(2) Anschlagsteller des Lesers auf K
stellen.
(3) Lochstreifen (Schlüssellochstreifenabschnitt vor dem Einlegen
glätten) seitlich nach vorn unter die Führungsplatte und den
Streifenendkontakt des Lesers schieben.
Erste zu bearbeitende Schrittgruppe muß auf der Kontakt-
schiene des Lesers liegen. Das Transportband muß einwand-
frei in die Transportlöcher des Lochstreifens greifen.
(4) Leserklappe schließen.
(5) Anschlagsteller des Lesers auf 5
stellen.
(6) Taste 5K
drücken.
(7) Taste 32
=  drücken.
Alle weiteren Lesertasten herausnehmen.
5.2. Herausnehmen es Lochstreifens
Der Lochstreifen kann bei eingeschaltetem Gerät herausgenom-
men werden.
(1) Anschlagsteller des Lesers auf
drücken.
Alle weiteren Lesertasten herausnehmen.
5.2. Herausnehmen es Lochstreifens
Der Lochstreifen kann bei eingeschaltetem Gerät herausgenom-
men werden.
(1) Anschlagsteller des Lesers auf K
stellen.
(2) Leserklappe des Lesers öffnen.
(3) Lochstreifen seitlich nach vorn unter der Führungsplatte des
Lesers herausziehen.
(4) Leserklappe schließen.
6. Chiffrieren
6.1. Erkennungsgruppen
Zu den Erkennungsgruppen gehören die Unterscheidungsgruppe
und die Kenngruppe (siehe Abbildungen 3 und 4).
6.1.1. Die Kenngruppe bestimmt die Abschnittsnummer der ersten zu
verwendenden Schlüssellochstreifenabschnittes beim Chiffrieren
und Dechiffrieren.
Sie ist bei Chiffrieren vor die erste Chiffretextgruppe zu setzen.
6.1.2. Die Unterscheidungsgruppe kennzeichnet einen zirkularen Spruch
und besteht aus der fünfstelligen Buchstabengruppe zzzzz
.
Sie ist beim Chiffrieren vor die Kenngruppe zu setzen.
6.2. Arbeitsablauf beim Chiffrieren
6.2.1. (1) Taste Ein
am Gerät drücken. (Alle Betriebsartentasten
müssen herausgenommen sine.)
(2) Ein Blatt Papier in den Wagen einspannen.
(3) Gruppenzähler in Nullstellung bringen.
(4) Taste Vorlauf D
drücken und Lochstreifen ca. 10 cm vor-
laufen lassen.
6.2.2. (1) Taste S-L-Bu
drücken.
(2) Schreibwerktaste  einmal drücken.
(3) Bei zirkularem Verkehr Unterscheidungsgruppe eintasten.
(4) Kenngruppe eintasten.
(5) Taste
einmal drücken.
(3) Bei zirkularem Verkehr Unterscheidungsgruppe eintasten.
(4) Kenngruppe eintasten.
(5) Taste S-L-Bu
herausnehmen.
(6) Zum Chiffrieren des hergerichteten Klartextes nächstfolgen-
den, noch nicht benutzten Schlüssellochstreifenabschnitt in
den Leser 2 einlegen.
6.2.3. Bei Eingabe des hergerichteten Klartextes über
Schreibwerk Leser 1
(1) Rechten Randanschlag (1) Klartextlochstreifen in
einstellten. den Leser 1 einlegen.
(2) Taste Bu allg-S
drücken. Taste S/VK
drücken,
(3) Schreibwerktaste  wenn Chiffretext zu-
drücken. sätzlich auf Blatt aus-
(4) Hergerichteten Klartext gegeben werden soll.
über Schreibwerktastatur (2) Taste
wenn Chiffretext zu-
drücken. sätzlich auf Blatt aus-
(4) Hergerichteten Klartext gegeben werden soll.
über Schreibwerktastatur (2) Taste Bu allg-Le
eingeben. drücken.
(Klartext wir über Schreib- (3) Taste Start
drücken.
werk, Chiffretext über Locher (Chiffretext wird über
ausgegeben.) Locher, bei gedrückter
Taste S/VK
über
Schreibwerk und Locher
ausgegeben.)
6.2.4. Bei überschreiten von jeweils 100 Chiffretextgruppen stoppt das
Gerät automatisch.
(1) Taste Vorlauf E
einmal drücken.
(2) Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Leser 2 herausnehmen
und nächstfolgenden gültigen Abschnitt einlegen.
(3) Eingabe des Klartextes über (3) Taste Start
drücken.
Schreibwerktastatur fort-
setzen.
6.2.5. Bei Ende des Klartextes:
(1) Zeichenzähler ablesen.
(2) Zwischenraum eintasten bis (2) Taste Schritt
so oft
Kontrollampe 0
leuchtet. drücken, bis die Kontroll-
lampe 0
leuchtet.
(3) Taste Vorlauf D
drücken und Lochstreifen ca. 30 cm vor-
laufen lassen und abreißen.
(4) Taste Bu allg-S
heraus- (4) Taste Bu allg-Le
und,
nehmen. falls gedrückt, Taste
S/VK
herausnehmen.
(5) Blatt mit Klartext aus dem (5) Blatt mit Chiffretext aus
Wagen herausnehmen. dem Wagen und Klar-
textlochstreifen aus dem
Leser 1 herausnehmen.
(6) Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Leser 2 herausnehmen.
(7) Chiffretext oder Anfang des Chiffretextes entsprechend Ab-
schnitt 7.2.3. ff dechiffrieren, falls eine Kontrolle auf einwand-
freies Chiffrieren erforderlich ist.
(8) Taste Aus
am Gerät drücken.
7. Dechiffrieren
7.1. Allgemeines
(1) Der Chiffretext muß zur Durchführung in Form eines 5-Ka-
nallochstreifens vorliegen. Liegt der Chiffretext auf Blatt vor,
so ist entsprechend Abschnitt 4. und unter Beachtung der Ab-
bildung 3 und 4 ein Chiffretextlochstreifen herzustellen.
(2) Chiffretextlochstreifen, die entsprechend Gebrauchsanwei-
sung A zum Verfahren CM-2
hergestellt wurden, weisen fol-
gende wesentliche Besonderheiten auf:
- beim Vorlauf und Nachlauf ist anstelle der 32. Kombi-
nation
die Steuerkombination ZwR
enthalten.
- Vor der Kenn- bzw. Unterscheidungsgruppe ist keine
Steuerkombination Bu
enthalten.
- Nach jeweils 100 Chiffretextgruppen ist einmal anstelle der
Steuerkombination Zl
die Steuerkombination WR
ent-
halten.
7.2. Arbeitsablauf beim Dechiffrieren
Folgende Arbeitsgänge sind bei Notwendigkeit und unter Beach-
tung der Art der Vorlage des Chiffretextes in nachstehender Rei-
henfolge durchzuführen:
7.2.1. (1) Taste EIN
am Gerät drücken.
(2) Ein Blatt Papier in den Wagen des Schreibwerkes einspan-
nen.
(3) Rechten Randanschlag des Wagens einstellen.
7.2.2. Bei Vorlage des Spruches auf Lochstreifen und Notwendigkeit
der Erkennungsgruppen:
(1) Lochstreifen mit erster Schrittgruppe der Kenn- bzw. Unter-
scheidungsgruppe in den Leser 1 einlegen.
(2) Schreibwerktasten Bu
und  drücken.
(3) Taste
drücken.
(3) Taste Le-S
drücken.
(4) Taste Start
drücken.(Erkennungsgruppen werden ausge-
druckt. Das Gerät stoppt nach Lesen der 32. Kombination au-
tomatisch.)
(5) Taste Le-S
herausnehmen.
(6) Blatt mit Erkennungsgruppen aus dem Wagen nehmen.
Anhand der Kenngruppe den ersten für den Spruch zu be-
nutzenden Schlüssellochstreifenabschnitt bestimmen und dem
Heft entnehmen.
7.2.3. Zum Dechiffrieren des Chiffretextes:
(1) Chiffretextlochstreifen mit erster Chiffretextschrittgruppe in
den Leser 1 einlegen.
(2) Schlüssellochstreifenabschnitt in den Leser 2 einlegen.
(3) Ein leeres Blatt in den Wagen einspannen.
(4) Gruppenzähler in Nullstellung bringen.
(5) Taste Lo/VK
drücken, wenn der Klartext zusätzlich auf
Lochstreifen ausgegeben werden soll.
(6) Taste Bu allg
drücken.
(7) Taste Schritt
mehrmals drücken.
(8) Erscheint Klartext: Taste Start
drücken.
7.2.4. Nach Eingabe von 100 Chiffretextgruppen stoppt das Gerät auto-
matisch.
(1) Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Leser 2 herausnehmen.
(2) Folgenden gültigen Schlüssellochstreifenabschnitt in den Le-
ser 2 einlegen.
(3) Taste Schritt
mehrmals drücken.
(4) Erscheint Klartext: Taste Start
drücken.
7.2.5. Bei Ende des Chiffretextlochstreifens stoppt das Gerät automa-
tisch.
(1) Taste Bu allg
und, falls gedrückt, Taste Lo/VK
heraus-
nehmen.
(2) Blatt aus dem Wagen spannen.
(3) Bei Ausgabe auf Lochstreifen Taste Vorlauf D
drücken.
Lochstreifen ca. 30 cm vorlaufen lassen, deutlich mit der Auf-
schrift KLARTEXT
kennzeichnen und abreißen.
(4) Chiffretextlochstreifen aus dem Leser 1 und Schlüssellochstrei-
fenabschnitt aus dem Leser 2 herausnehmen.
(5) Taste Aus
am Gerät drücken.
7.2.6. Im erhaltenen Klartext die notwendigen Korrekturen vornehmen.
Aus dem Textzusammenhang erkennbare Verstümmelungen be-
richtigen.
8. Entstümmelungen
8.1. Entstümmelungsversuche zum Spruchanfang
(1) Überprüfen, ob das Chiffrieren mit dem Schlüssellochstreifen-
abschnitt nächstniedriger oder nächsthöherer Nummerierung
erfolgte.
(2) Überprüfen, ob zum Chiffrieren Schlüsselunterlagen der Chif-
frierverbindung eines anderen möglichen Schlüsselbereiches
verwendet wurden.
(3) Überprüfung der ersten Chiffretextgruppen auf Verstümme-
lungen.
(4) Ist die Kenngruppe im gültigen Schlüssellochstreifenheft bzw.
auf dem ausgedruckten Formular nicht auffindbar, ist es
statthaft, Kenngruppentafeln nächstfolgender Schlüsselloch-
streifenhefte freizulegen.
8.2. Entstümmelung des Chiffretextes vom Blatt
| Art der Verstümmelung | Auswirkung | Beseitigung | |
|---|---|---|---|
| 8.2.1. | Unvollständige Gruppe | Der Klartext ist von dieser Stelle ab Ver- stümmelt, da eine Ver- schiebung der Additions- reihe zum Chiffretext erfolgt ist. | (1) Stelle des fehlenden Buchstabens bzw. der fehlenden Buchstaben feststellen. (2) Beliebige Buchstaben so oft eintasten, bis die Gruppe aufgefüllt ist. |
| 8.2.2. | Gruppe mit mehr als fünf Buchstaben | Siehe Abschnitt 8.2.1. | Stelle der zusätzlichen Buchstaben feststellen, zusätzliche Buchstaben weglassen. |
| 8.2.3. | Fehlende Gruppen | Siehe Abschnitt 8.2.1. | (1) Gruppenanzahl entsprechend Spruchkopf überprüfen. (2) Ab Verstümmelung folgende Gruppe so oft eintasten, bis sinnvoller Klartext erscheint. |
| 8.2.4. | Zusätzliche Gruppen | Siehe Abschnitt 8.2.1. | (1) Gruppenanzahl entsprechend Spruchkopf überprüfen. (2) Gleiche zusätzliche Gruppen im Chiffretext streichen. (3) Werden gleiche Gruppen nicht festgestellt, so ab Verstümmelung nach jeder weiteren eingetasteten Chiffretextgruppe - Schlüssellochstreifenabschnitt mit der Handkurbel um fünf Schrittgruppen zurückdrehen, bis sinnvoller Klartext erscheint; - eine Chiffretextgruppe überspringen, bis sinnvoller Klartext erscheint. |
| 8.3. | Entstümmelung des Chiffretextlochstreifens | ||
| 8.3.1. | Fehlende Chiffretext- schrittgruppen (1) Fehlende Fünfer- gruppen (2) Unvollständige Fünfergruppen | Der Klartext ist von dieser Stelle ab Ver- stümmelung, da eine Ver- schiebung der Additions- reihe zum Chiffretext erfolgt ist. | 1. Möglichkeit Schlüssellochstreifenabschnitt um so viele Schrittgruppen nach vorn transportieren wie Schrittgruppen im Chiffretextlochstreifen fehlen. Schreibwerkstaste ZwRso oft drücken wie Schrittgruppen des Schlüssellochstreifenab- schnittes übersprungen wurden. Ausgefallene Klartextbuchstaben gegebenen- falls einfügen. 2. Möglichkeit Chiffretextlochstreifen um so viele Schritt- gruppen zurücklegen, wie Schrittguppen im Chiffretextlochstreifen fehlen. Auf Blatt erschienen für fehlende Schrittgrup- pen beliebige Buchstaben. |
| 8.3.2. | Zusätzliche Chiffretext- schrittgruppen (1) Zusätzliche Fünfergruppen. (2) Gruppen mit mehr als fünf Schritt- gruppen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | (1) Feststellen, welche Schrittgruppen zusätz- lich im Chiffretextlochstreifen enthalten sind. Diese Schrittgruppen nicht bearbeiten. Auf Blatt erschienen keine zusätzlichen oder falsche Buchstaben (2) Ist eine Feststellung zusätzlicher Schritt- gruppen nicht möglich, so Chiffretextloch- streifen um so viele Schrittgruppen nach vorn transportieren, wie zusätzliche Schritt- gruppen im Chiffretextlochstreifen ent- halten sind. Auf dem Blatt erscheinen beliebige Buchstaben, die aus dem Zusammenhang zu berichtigen sind. |
| 8.3.3. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen befinden sich die Steuerkombinationen WR, Zl, ZwR im Chiffretextlochstreifen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | |
| 8.3.4. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen befinden sich die 32. Kombination im Chiffretextlochstreifen. | Das Gerät stoppt. Bei erneutem Start er- folgt eine Verschiebung der Additionsreihe zum Chiffretext, und der Klar text ist verstümmelt. | Siehe Abschnitt 8.3.1. |
| 8.3.5. | Anstelle der Steuer- kombination WR, Zl und ZwR befinden sich Chiffretextschritt- gruppen im Chiffretext- lochstreifen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | Siehe Abschnitt 8.3.2. |
| 8.3.6. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen stehen die Steuerkom- binationen Bu und Zi. | Für diese Steuerkombi- nationen erschient auf Blatt ein Zwischenraum und im Lochstreifen eine 32. Kombination. | Die fehlenden Buchstaben sind aus dem Zusammenhang zu ergänzen. |
9. Rückfragen
9.1. Eine Rückfrage hat zu erfolgen, wenn in einem empfangenen
Spruch Verstümmelungen enthalten sind, die nicht aus dem
Zusammenhang oder durch Entstümmelungsversuche berichtigt
werden können.
9.2. Es ist offen eine Wiederholung der Übermittlung des Spruches
oder der verstümmelten Gruppen des Spruches bei der absen-
denden Chiffrierstelle anzufordern (Beispiel 21).
Es ist verboten, weiter Mitteilungen offen zu geben.
9.3. Treten nach wiederholter Übermittlung des Spruches oder der
verstümmelten Gruppen des Spruches im Wesentlichen die glei-
chen Fehler auf, und ist ein Dechiffrieren nicht möglich, ist offen
eine Neubearbeitung des Spruches bzw. der betreffenden Teile
des Spruches (nur vollständige Wörter) bei der absendenden Chif-
frierstelle anzufordern (Beispiel 22).
Es ist verboten, weitere Mitteilungen offen zu geben.
Der angeforderte Spruch bzw. die angeforderten Teile des Spru-
ches (nur vollständige Wörter) sind dann von der absendenden
Chiffrierstelle mit neuen Spruchschlüssel zu chiffrieren.
10. Sicherheitsbestimmungen
10.1. Allgemeines
(1) Chiffrierunterlagen sind nach den entsprechenden grundsätz-
lichen Weisungen zu behandeln.
(2) Bei besonderen Vorkommnissen ist vor Einleitung weiterer
Sofortmaßnahmen entsprechend den bestehenden Bestim-
mungen Meldung zu erstatten.
(3) Mitteilungen über Kompromittierung sind bei Übertragung
über Nachrichtenkanäle unter Verwendung der folgenden
für diesen Verkehr vorgesehenen, nichtkompromittierten
Schlüsselunterlagen zu chiffrieren.
10.2. Vorkommnisse und Sofortmaßnahmen
Vorkommnisse Sofortmaßnahmen
(1) Kompromittierung von
Klartext
a) vor Übermittlung: Mitteilung über Kompromittierung an Absender der Nachricht. Weitere
Bearbeitung erst nach Rücksprache mit diesem.
b) durch offene Über- Mitteilung über Kompromittierung an Absender und Empfänger der
mittlung oder nach Nachricht.
Übermittlung:
(2) Kompromittierung
eines Exemplars einer
Schlüsselserie
a) vor Übermittlung Außerkraftsetzung aller Exemplare der betreffenden Schlüsselserie.
damit bearbeiteter
Sprüche:
b) nach Übermittlung Außerkraftsetzung aller Exemplare der betreffenden Schlüsselserie. Mit-
damit bearbeiteter teilung über Kompromittierung an Absender und Empfänger damit
Sprüche: übermittelter Nachrichten.
(3) Kompromittierung von
Schlüssellochstreifen-
abschnitten
a) vor Übermittlung - Bereits bearbeitete Klartexte mit den nächsten für diesen Verkehr
damit bearbeiteter vorgesehenen nichtkompromittierten Schlüssellochstreifenabschnitten
Sprüche: neu chiffrieren.
- Mitteilung über Kompromittierung an Chiffrierstelle(n) desselben
Schlüsselbereiches.
- Kompromittierte Schlüssellochstreifenabschnitte, falls nicht anders an-
gewiesen, innerhalb 48 Stunden vernichten.
b) nach Übermittlung Mitteilung über Kompromittierung der betreffenden Textteile an Ab-
damit bearbeiteter sender und Empfänger der Nachricht.
Sprüche:
(4) Wiederholtes Benutzen
von mehr als 10 Schritt-
gruppen eines Schlüs-
sellochstreifenabschnit-
tes zum Chiffrieren
a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.
des Spruches:
b) und Übermittlung Mitteilung über Kompromittierung der betreffenden Textteile an Absen-
des so bearbeiteten dende oder empfangende Chiffrierstelle und Mitteilung an Absender und
Spruches: Empfänger der Nachricht.
(5) Einsetzen einer falschen
Kenngruppe, Chiffrieren
der Kenngruppe, Fehlen
der Kenngruppe
a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.
des Spruches:
b) und Übermittlung Bei Notwendigkeit Mitteilung der richtigen Kenngruppe an empfangende
des Spruches: Chiffrierstelle.
(6) Kompromittierung der Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.
Kenngruppentafel.
(7) Benutzung verfahrens-
fremder Schlüsselloch-
streifenabschnitte
a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.
des chiffrierten
Spruches:
b) und Übermittlung - Mitteilung über Benutzung falscher Schlüsselunterlagen an Absender
des chiffrierten und Empfänger der Nachricht.
Spruches: - Ursache und Auswirkung des Fehlers ermitteln und die sich dar-
aus ergebenden Sofortmaßnahmen durchführen.
(7) Beschädigung des Sie- Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.
gels des Chiffrierge-
rätes durch unbefugte
Personen.
(8) Feststellen des Ausfalls
von Kanälen beim
Leser2 nach Chiffrieren
durch das Kontrollpro-
gramm für das Gerät
a) ohne Übermittlung - Nachricht nicht absetzen.
damit bearbeiteter - Arbeit mit dem Gerät einstellen.
Sprüche: - Wartungsmechaniker benachrichtigen.
- Bereits bearbeiteter Klartexte mit einem anderen Gerät bzw. Ver-
fahren nochmals bearbeiten.
b) und Übermittlung - Mitteilung über Kompromittierung an Absender und Empfänger der
damit bearbeiteter Nachricht.
Sprüche: - Arbeit mit dem Gerät einstellen.
- Wartungsmechaniker benachrichtigen.
- Sämtliche chiffrierte Sprüche seit letzter Kontrolle des Gerätes mit-
tels Kontrollochstreifen zur Untersuchung an Leitstelle oder nächst-
höhere Dienststelle übergeben.
(9) Kompromittierung des Sofortmeldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.
Chiffriergerätes.
(10) Chiffrieren und De-
chiffrieren trotz
Mängel am Chiffrier-
gerät
a) ohne Übermittlung - Klartext mit funktionstüchtigem Gerät und noch nicht benutzten
des chiffrierten Schlüsselunterlagen neu bearbeiten.
Spruches: - Reparatur des Gerätes veranlassen.
b) und Übermittlung - Sofortmeldung erforderlich.
des chiffrierten - Ursachen und Auswirkungen des Fehlers ermitteln und die sich dar-
Spruches: aus ergebenden Sofortmaßnahmen durchführen.
- Reparatur des Gerätes veranlassen.
11. Beispiel
Abkürzungen: KT = Klartext
hKT = hergerichteter Klartext
Beispiel 1:
KT: Polizeiliches Kennzeichen IA 07-03 Typ …
hKT: polizeiliches kennzeichen ia nullsieben strich null
drei typ …
Beispiel 2:
KT: … + …… § …
hKT: … plus … paragraph …
Beispiel 3:
KT: … Major Gäbler …
hKT: … major g ae b l e r …
Beispiel 4:
KT: … in Karl-Marx-Stadt Kurt-Fischer-Str. …
hKT: … in karl maryy stadt kurt fischer str …
KT: Polizeiliches Kennzeichen XY 63-75 Typ …
hKT: polizeiliches kennzeichen yy y dreiunsechzig str
ich fuenfundsiebzig typ …
Beispiel 5:
KT:
| Positions-Nr. | Benennung | Nummer des Teiles |
|---|---|---|
| 16 | Schneckenrad | 16.374.001 |
| 17 | Kegelrad | 18.440.003 |
| 18 | Zwischenwelle | 18.464.000 |
hKT: lies drei spalten a positions nr b benennung c
nummer des Teiles a einssechs b schneckenrad
c einssechs dreisiebenvier nullnulleins a einsie
ben b kegelrad c einsacht vierviernull nullnulldr
ei a einsacht b zwischenwelle c einsacht viers
echsvier nullnullnull
bzw. hKT: lies drei spalten a positions nr b benennung c
nummer des teiles a sechzehn b schneckenrad
c sechzehn dreihundertvierundsiebzig nullnullein
s a siebzehn b kegelrad c achtzehn vierhunder
tvierzig nullnulldrei a achtzehn b zwischenwell
e c achtzehn vierhundervierundsechzig nullnulln
ull
Beispiel 6:
KT: hKT:
1. a
2. b
· ·
· ·
· ·
23. w
24. y
25. z
26. aa
27. ab
· ·
· ·
· ·
Beispiel 7:
KT: Faszbinder fährt über Baerenburg nach Großenhain.
hKT: faszbinder faehrt ueber baerenburg nach groszenha
in pkt
Beispiel 8:
KT: hKT: bzw. hKT:
8 acht acht
11 einseins elf
287 zweiachtsieben zweihundertsiebenu
ndachzig
Beispiel 9:
KT: … D-48 …
hKT: … d strich vieracht …
bzw. hKT: … d strich achtundvierzig …
KT: … BA 137 …
hKT: … ba rpt ba einsdreisieben …
bzw. hKT: … ba einhundertsiebenunddreiszig …
KT: … P 6024 …
hKT: … p sechsnull zwei vier …
bzw. hKT: … p sechzig vierundzwanzig …
KT: … 73 405 …
hKT: … siebendrei viernullfuenf …
bzw. hKT: … dreiundsiebzig vierhundertfuenf …
Beispiel 10:
KT: … 1534568 …
hKT: … eisfuenfdrei vierfuenfsechs acht …
bzw. hKT: … einhudertdreiundfuenfzig vierhundertsechsun
undfuenfzig acht …
Beispiel 11:
KT: … 54° 14,8′ N … … 13° 27′ E …
hKT: … fuenfvier grad einsvier komma acht min n…
… eindrei grad zweisieben min e …
bzw. hKT: … vierundfuenfzig grad vierzehn komma acht m
in m …
… dreizehn grad sienundzwanzig min e …
Beispiel 12:
KT: Der 22. Jahrestag
hKT: der zweizwei pkt jahrestag
bzw. hKT: der zweiundzwanzigste jahrestag
Beispiel 13:
KT: Abshnitt IX/XII …
hKT: abschnitt roem neuen sstrich roem einszwei …
bzw. hKT: abschnitt roem neun sstrich roem zwoelf …
Beispiel 14:
KT: um 9 Uhr … um 7 Uhr 15 Minuten …
hKT: um nullneun uhr … um nullsieben einsfuenf
uhr
bzw. hKT: um neun uhr … um sieben uhr fuenfzehn m
in …
Beispiel 15:
KT: Ankommen am 17.8.1969 um …
hKT: ankommen am einssieben aug sechsneun um …
bzw. hKT: ankommen am siebzehten aug neunundsechzig
um …
KT: … eingetroffen, um die …
hKT: … eingetroffen um die …
bzw. hKT: … eingetroffen komma um die …
Beispiel 16:
KT: Siegfried Lehmann
hKT: l e h m a n n siegfried rpt lehmann
KT: Armin Saeger
hKT: s ae g e r armin rpt saeaeger …
KT: … IA 37-01 befindet sich …
hKT: … ia dreisieben strich nulleins rpt ia befindet
sich …
bzw. hKT: … ia dreisieben strich nulleins rpt ia rpt ia b
findet sich …
Beispiel 17:
Dreiteiliger Klartext:
1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text a ff
2. Teil: b Text ff
3. Teil: c Text Absender
Beispiel 18:
1. Spruch: Vierteiliger Klartext:
1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text aa
ff
2. Teil: ab Text ff
3. Teil: ac Text ff
4. Teil: ad Text Absender
2. Spruch: Dreiteiliger Klartext:
1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text ba
ff
2. Teil: bb Text ff
3. Teil: bc Text Absender
Beispiel 19:
Klartext: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger A, B, C
1. zirkularer Textteil
1. individueller Textteil für A
1. individueller Textteil für B
1. individueller Textteil für C
2. zirkularer Textteil
2. individueller Textteil für A
2. individueller Textteil für B
2. individueller Textteil für C
3. zirkularer Textteil Absender
Zirkularer Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger
(für A, B, C) (allgemein) 1.zirk.Textteil ia 2.zirk.
Textteil ib 3. zirk. Textteil Absen-
der
Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.
(für A) Textteil für A ib 2. ind Textteil
für A
Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.
(für B) Textteil für B ib 2. ind Textteil
für B
Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.
(für B) Textteil für B ib 2. ind Textteil
für B
Beispiel 20:
Schema der Übermittlung
(A) -> (B) -> (C)
Zu chiffrierender Klartext durch Stelle A:
WWWWW VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger C Text
Absender A
zu chiffrierender Klartext durch Stelle B:
VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger C Text Absen-
der A
Beispiel 21:
Rückfrage: Spruch Nr. … wiederholen
oder
Spruch Nr. … 30. bis 40 Gruppe wieder-
holen
Antwort: Spruch Nr. … (Chiffretext
oder
Spruch Nr. … 30. bis 40. Gruppe (Chiffre-
text)
Beispiel 22:
Spruch Nr. … neu bearbeiten
oder
Spruch Nr. … 12. bis 13. und 21 Gruppe neu bearbeiten
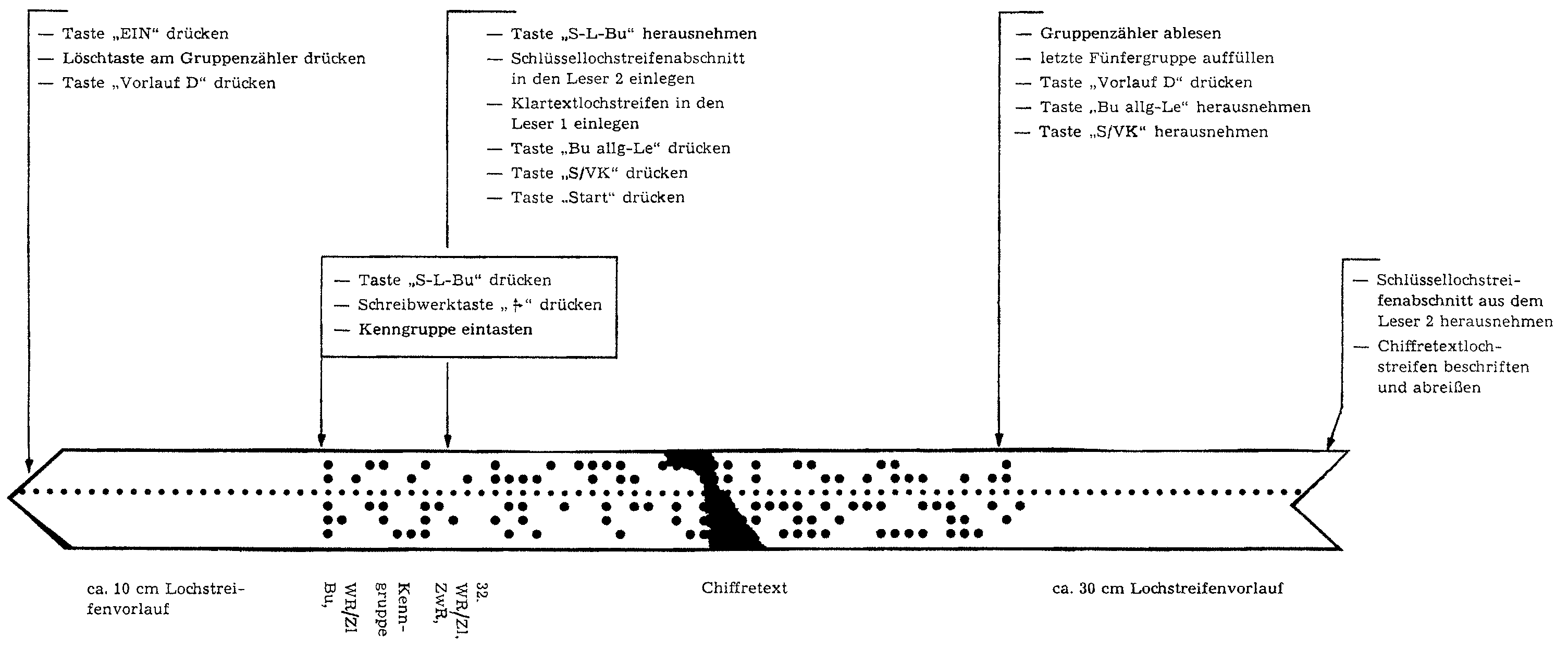
Abb. 3
Arbeitsablauf des Chiffrierens mit Eingabe über Leser 1 / individueller Verkehr (Spruch-
länge unter 100 Gruppen)
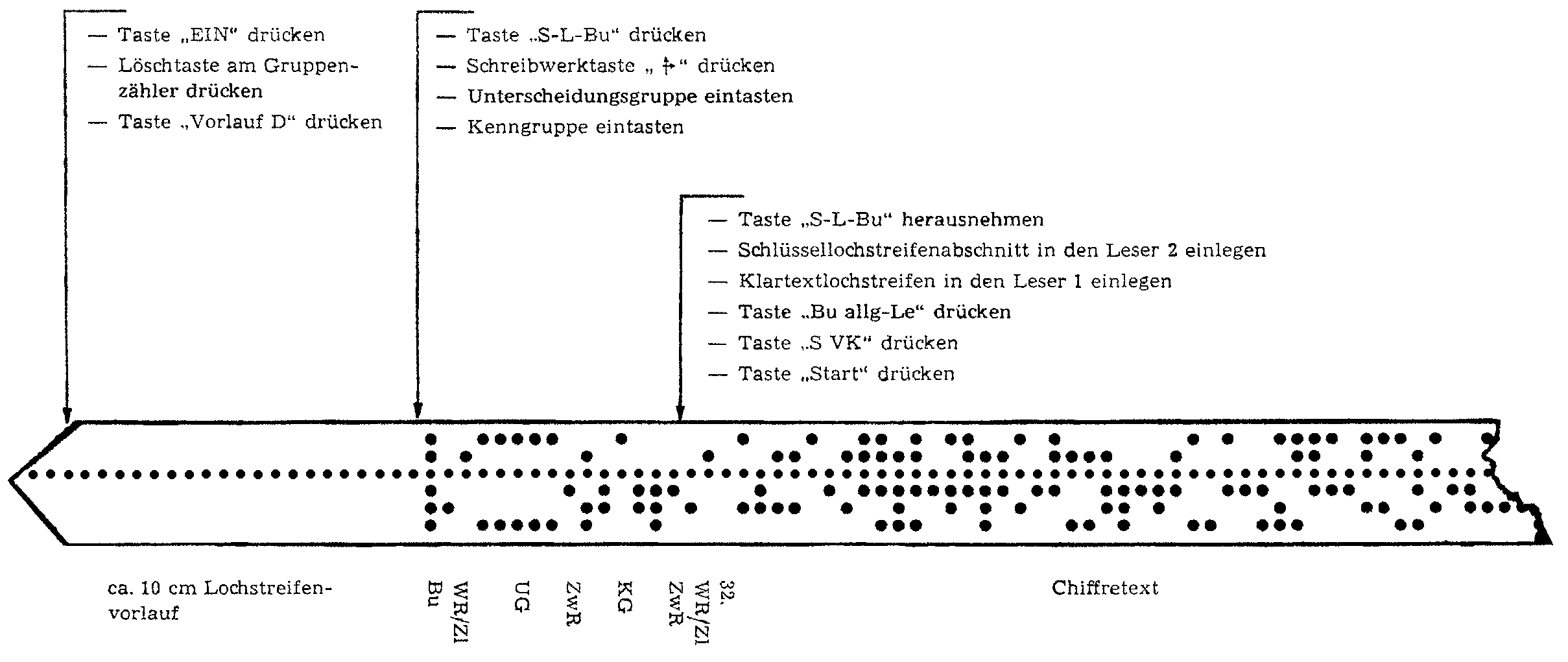
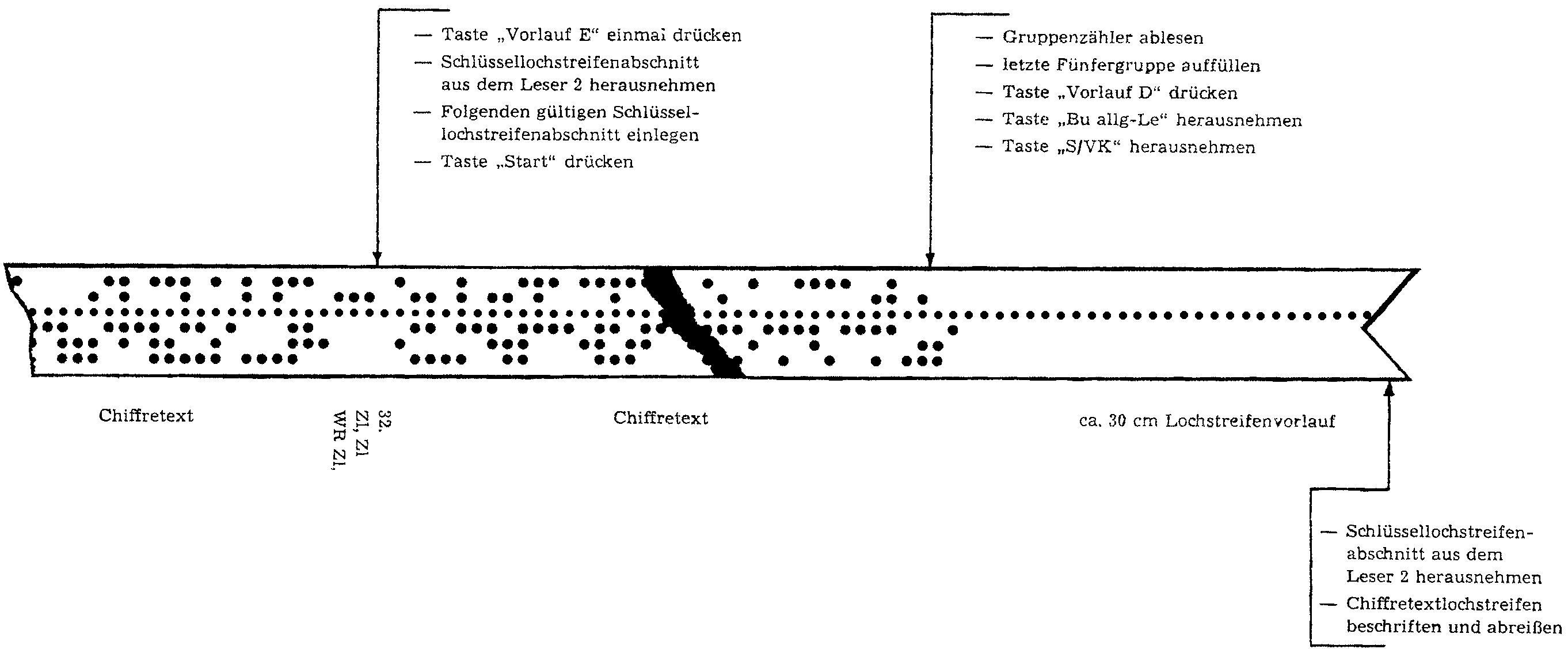
Abb. 4
Arbeitsablauf des Chiffrierens mit Eingabe des Klartextes über Leser 1 / zirkularer Verkehr (Spruchlänge
über 100 Gruppen)
Beispielbelege: Chiffriergerät T-301 arbeitet mit dem Chiffrierverfahren CM-2. Anstatt Stanzabfälle wird der BegriffKonfettioderausgestanzten Papierteilchenverwendet. Benzing = Lösungsmittel, Benzin - Alkoholhaltig Kontaktpimpel = Linsenförmiger Kontakt Alsiferringe = Aluminium-Silizium-Ferrit Ringe, magnetischer Ring.
Geheime Verschlußsache
MfS 020 Nr. 2180/61
46. Ausfertigungen
5. Ausfertigung
Beschreibung und Bedienungsanleitung der Chiffrierma-
schine "CM-2"
I. Allgemeine Hinweise
Die automatische buchstabenschreibende Chiffriermaschine
CM-2 (Abb.1) kann auf drei Betriebsarten eingestellt
werden :
a) Klartext - K
b) Chiffrieren - C
c) Dechiffrieren - D
Die Umschaltung von einer Betriebsart zur anderen er-
folgt mit dem Betriebsartenumschalter (21). Die Eingabe
des Textes erfolgt manuell von Tastatur (25) oder auto-
matisch, indem ein Lochstreifen in den Transmitter des
Dekombinators eingegeben wird. Das Schreiben des Textes
erfolgt auf DIN A4 Bogen. Die Lochung des Textes erfolgt
nach dem Internationalen Telegraphenalphabet Nr. 2
( 5 Kanäle) in einen 17,5 mm breiten Streifen.
Die Maschine gestattet die Anwendung von drei Arbeits-
arten.
a) Schreiben des Textes auf Blatt - B
b) Schreiben des Textes auf Blatt bei gleich-
zeitiger Lochung im Streifen - LB
c) Lochung in Streifen - L
Der Übergang von einer Arbeitsart auf die andere erfolgt
mit Hilfe des Umschalters (20). Im Prinzip arbeitet die
Maschine elektromechanisch.
Die nominelle technische Geschwindigkeit der Maschine
ist 500 Zyklen / min.
Die mechanischen Teile der Maschine werden durch einen
Universal-Elektromotor Typ SL 369 U/A1 in Bewegung ge-
setzt. Die Speisung erfolgt vom Wechselstromnetz mit
einer Spannung von 100 - 250 V und einer Frequenz von
50 Hz, oder Gleichstrom mit einer Nennspannung von
110 V.
Zur Ausrüstung der Maschine gehören :
a) Chiffriermaschine CM - 2
b} 1 Kasten mit Ersatzteilen (SIP - I)
c) 1 Kasten mit Werkzeug und Zubehör
d) 1 Transportkiste für die Maschine
e) 1 Transportkiste für Ersatzteil- und
Werkzeugkasten
Für je 5 Sätze der Chiffriermaschine ist ein Ersatzteil-
kasten (SIP - II) vorgesehen.
Abmessungen der Maschine: 509 x 488 x 285 mm
Gewicht der Maschine ohne
Verpackung: 46,75 kg
Abmessungen der Transportkiste
für die Maschine: 618 x 548 x 327 mm
Gewicht der Maschine mit Ver-
packung: 62.2 kg
Abmessungen der Transportkiste
für Ersatzteil- und Werkzeug-
kasten: 520 x 438 x 115 mm
Gewicht: 10,25 kg
Gewicht der Maschine mit Zu-
behör: 72,45 kg
Baugruppen der Maschine CM-2
Die Maschine CM-2 besteht aus einzelnen Baugruppen.
Die mechanische Verbindung zwischen den einzelnen Bau-
gruppen erfolgt durch Zahnradgetriebe und Zugstangen;
die elektrische Verbindung durch Kontaktleisten. Alle
Baugruppen der Maschine sind auf einer Grundplatte mon-
tiert.
Die Maschine hat folgende Baugruppen:
a) Tastatur
b) Selektionsdruckwerk
c) Antrieb
d) Wagen
e) Transmitter mit Dekombinator
f) Locher mit Zählwerk und Zwischenraumgeber
g) Automatikantrieb
h) Chiffrator
i) Gehäuse mit Konzepthalter
j) Stromversorgung
k) Filter
l) Grundplatte
Abb. 1 zeigt die Maschine.
Alle Baugruppen der Maschine sind auf einem gemeinsamen
Chassis, der Grundplatte mit 4 Füßen befestigt (7).
Von unten wird die Grundplatte mit einer Bodenplatte ver-
schlossen. Der Anschluß der Maschine ans Netz erfolgt
durch Schukostecker (34).
Entsprechend der Art des Stromes, wird der Hebel 13 auf =
(Gleichstrom) oder ~ (Wechselstrom) gestellt und der
Spannungswahlschalter (27) wird entsprechend der auf der
Skala angezeigten Nennspannung für Wechselstrom einge-
stellt. Gleichzeitig wird der Stecker am Motor der Ma-
schine, der auf der Grundplatte unter dem Deckel (16)
des Gehäuses (2) liegt, entsprechend eingestellt. Bei
Speisung vom Wechselstromnetz wird die Spannung auf der
Skala des Voltmeters (28) kontrolliert. Das Gehäuse, das
die Baugruppen der Maschine verdeckt, besitzt drei Klapp-
deckel (12), (16), (35). Dadurch ist es möglich, das Ge-
häuse abzunehmen, ohne den Wagen der Maschine entfernen
zu müssen. Das Gehäuse ist an der Grundplatte durch zwei
unverlierbare Schrauben (9) befestigt. Auf das Gehäuse
kann man einen abnehmbaren Konzepthalter zur Ablage von
Formblättern mit dem zu bearbeitenden Text stellen.
Formblätter, auf die der Text geschrieben wird, werden
in den Wagen (11) eingespannt. Durch den Schalter (23)
wird die Maschine an das Netz angeschlossen. Die Ein-
stellung der Maschine erfolgt gemäß der durchzuführenden
Arbeit, indem man den Betriebsartenumschalter (21) auf
K, D oder C stellt. Der Arbeitsumschalter (20) wird
ebenfalls entsprechend der durchzuführenden Arbeit
in eine der drei angeführten Stellungen (B, LB, L) ge-
bracht.
Das Eintasten des zu bearbeitenden Textes geschieht auf
der der Tastatur; sie hat 26 Tastenhebel (25), die Zwischen-
raumtaste (26) und die Wagenrücklauftaste. Die Tasten-
hebel haben Buchstabenbezeichnung, die Taste für Wagen-
rücklauf ist nicht besonders gekennzeichnet. Die Tasta-
tur ist mit einer Verkleidung versehen.
Bei automatischer Texteingabe wird der gelochte Streifen
die Streifenführung des Transmitters am Dekombina-
tor eingelegt und die Klappe (36) geschlossen. Der
Transmitter wird eingeschaltet, indem man auf den Knopf
"Ein" drückt. Bei Drücken des Knopfes "Aus" erfolgt die
Abschaltung.
Das Auslösen des Transmitters nur für einen Zyklus erfolgt
durch Drücken des Knopfes "Aus". Durch Drehen der Scheibe
(29) kann der Lochstreifen um die erforderliche Anzahl
von Schritten in beiden Richtungen fortbewegt werden.
Beim Chiffrieren oder Dechiffrieren wird der Schlüssel-
lochstreifen in die Streifenführung des Transmitters des
Chiffrators (24) gelegt und die Klappe (22) geschlossen.
Die verschlüsselten bzw. entschlüsselten Zeichen werden
durch den vierstelligen Zähler (18) gezählt. Beim De-
chiffrieren ist die Möglichkeit, den Schlüssellochstrei-
fen von Hand aus mit der Kurbel (15) in beiden Rich-
tungen zu bewegen, vorgesehen.
Bei Schreiben von Klartext und beim chiffrieren kann der
bearbeitete Text mit Hilfe des Lochers (14) im Fünfer-
code in den Streifen gestanzt werden. Der Locher hat ein
Zählwerk mit Zwischenraumgeber, der nach je 5 Zeichen-
kombinationen die Kombination Zwischenraum bringt. Die-
se Vorrichtung gibt auch nach je 10 Fünfergruppen die
Kombination Wagenrücklauf und Zeilenvorschub. Das Ein-
und Ausschalten des Zählwerkes mit Zwischenraumgeber er-
folgt durch Einlegen des Schalters (8) in die Stellung
"Ein"" bzw. "Aus" .
Das Einschalten des Lochers für Streifenvorlauf erfolgt
durch Drücken des Knopfes (5). Das Einschalten des Lochers
für einen Schritt, wobei nur das Transportloch gestanzt
wird, erfolgt durch den Schalthebel (3). Die ausgestan-
zten Papierteilchen fallen in den Abfallkasten (10).
Die Vorratsrolle mit dem Lochstreifen ist in einer Kassette,
die sich in der Grundplatte befindet. Beim Rollenwech-
sel wird die Kassette am Knopf (19) herausgezogen.
Der Text, der beim Chiffrieren gedruckt wird, wird au-
tomatisch in Fünfergruppen zu je 10 Gruppen pro Zeile
geteilt. Diese Teilung in Fünfergruppen kann auch bei
Arbeiten mit Klartext erfolgen, wenn der Hebel (17)
in die Stellung "Ein" gebracht wird.
II. Beschreibung der Baugruppen der Maschine
Tastatur
Die Tastatur ist dazu bestimmt, den Text einzutasten
und durch Druck auf die Tastenhebel, deren Anordnung auf
Abb. 3 gezeigt ist, die Hauptwelle der Maschine für
einen Arbeitszyklus auszulösen.
Die Tastatur hat 26 Tastenhebel, auf deren Tastenknöp-
fen die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabetes ein-
graviert sind. Außerdem hat die Tastatur eine Leertaste,
um die geschriebenen Wörter zu trennen und einen Tasten-
hebel Wagenrücklauf. Nach Drücken dieser Taste fährt der
Wagen automatisch an den Anfang der neuen Zeile zurück.
An die Teile der Tastatur werden zusätzlich folgende
Forderungen, die die Arbeit an der Maschine erleichtern,
gestellt:
a) Arretierung des betätigten Tastenhebels für die
Zeit eines Arbeitszyklus der Maschine in der
unteren Stellung.
b) Es muß unmöglich sein, die Hauptwelle auszulö-
sen, wenn zwei oder mehrere Tastenhebel gleich-
zeitig gedrückt werden.
c) Es muß unmöglich sein, die Hauptwelle durch
Drücken einer Taste auszulösen, wenn der auto-
matische Wagenrücklauf erfolgt.
d) Die Tastenhebel, die bei der gegebenen Arbeit
nicht gebraucht werden, müssen blockiert werden
können.
Diese Forderungen und auch die Auslösung der Hauptwelle
der Maschine für einen Arbeitsgang werden durch folgende
mechanische Gruppen erfüllt:
a) Tastenhebel
b) Auslösevorrichtung
c) Auslösesperre bei Drücken von zwei oder mehr Tasten
d) Sperrvorrichtung
e) Sperrschienen
f) Tastenhebel Wagenrücklauf
g) Zwischenraumtaste
Das Funktionsschema ist auf der Zeichnung 2 abgebildet.
Tastenhebel
Die Tastenhebel Abb. 4 drehen sich frei auf der Achse
(11). Das rechte Ende des Tastenhebels wird von der
Feder (12) heruntergezogen. Die Federspannung kann man
verstärken, indem man die Feder in das Gewinde der
Leiste, die an der Tastaturplatte befestigt ist, hinein-
schraubt. Die Spannung dieser Feder ist ausschlaggebend
für den auf den Tastenhebel auszuübenden Anfangsdruck.
Die linken Enden der Tastenhebel liegen in den Aus-
schnitten des Führungskammes. Auf der Tastaturplatte
sind Kontaktgruppen in zwei Reihen angeordnet (13) und
(15).
Jeder Tastenhebel hat ein Gleitstück (9), das sich in
Längsrichtung des Tastenhebels auf den Stiften (8) und
(10), die in den Hebel eingenietet sind, verschieben kann.
Jedes Gleitstück hat ein Prisma (16) oder (14), das aus
Isolierstoff besteht, dieses steht in der Ausgangsstel-
lung des Tastenhebels entweder über der ersten oder der
zweiten Reihe der Kontaktgruppen. Am linken Teil des
Tastenhebels befindet sieh ein Messer (4), das beim Be-
tätigen einer Taste die Rollen der Auslösesperre so
verschiebt, daß ein Anlaufen der Hauptwelle der Maschine
bei Drücken von 2 oder mehr Tasten verhindert wird.
Bei bestimmten Arbeitsbedingungen muß der Anlauf der
Hauptwelle bei Betätigen gewisser Tasten ausgeschlossen
sein. Diese Forderung wird durch die Sperrschienen er -
füllt, die mit den Nasen der linken Enden der Tastenhebel
zusammenwirken.
Bei Betätigen eines Tastenhebels wird der Auslöse-
rahmen (5) nach unten verschoben und wirkt seinerseits
auf die Auslösevorrichtung ein und bewirkt das Anlaufen
der Hauptwelle der Maschine. Dabei nehmen die Nase (18)
des Gleitstückes (9) und der Auslösebügel (17) eine
Stellung ein, wie es in Abb. 4 B gezeigt ist; bei An-
sprechen der Auslösevorrichtung wird das Gleitstück von
dem Bügel (17) in die rechte Endstellung gebracht.
Die obere Nase (6) des Gleitstückes schiebt sich unter
die Schiene (7) und verhindert dadurch die Rückkehr des
Tastenhebels in die obere Ausgangsstellung, nachdem die
Taste losgelassen wird (Abb. 4 C). Das Prisma (16) oder
(17) liegt zwischen den Kontakten (15) oder (13) und
schließt sie. Kurz vor Ende des Arbeitszyklus der Ma-
schine kehrt der Tastenhebel in seine obere Ausgangs-
stellung zurück.
Auslösevorrichtung Abb. 2
Nachdem eine Taste betätigt wurde, spricht die Auslöse-
vorrichtung an. Die Kontaktgruppe der Tastatur wird ge-
schlossen. Die Hauptwelle der Maschine wird für einen
Arbeitszyklus, der einer Umdrehung der Welle entspricht,
freigegeben.
Die Auslösevorrichtung arbeitet wie folgt :
Bei Betätigen der Taste E, z.B., drückt die untere Kante
des Tastenhebels den rechten Teil des Auslöserahmens (13)
nach unten und dreht ihn um die Achse (16). Dabei wirkt
der Hebel (40), der starr mit der Achse des Auslöse-
rahmens verbunden ist, mit seinem unteren Arm auf die
Hebel (39) und (47) ein und klinkt den Hebel (45) aus dem
dreiarmigen Hebel (43) aus.
Die rechten Arme der Hebel (43) und (82) sind durch eine
verstellbare Zugstange (15) verbunden. Die mittleren Arme
sind durch die Begrenzungshebel (41) und (83) mit dem
Auslösebügel (48) verbunden. Nach Freigabe der Hebel
(45) und (43) bewegt sich der Auslösebügel (48) zusammen
mit dem eingefallenen Gleitstück (60) unter dem Ein-
fluß der Feder (57) nach links. Das Prisma des Gleit-
stückes schließt die Kontaktgruppe (58). Dabei klinkt
der Hebel (81), der starr mit dem dreiarmigen Hebel (82)
verbunden ist, durch die Zugstange (80) die Halteklinke
aus dem getriebenen Teil der Start-Stopp-Kupplung der
Hauptwelle der Maschine aus. Die Hauptwelle macht eine
Umdrehung und gegen Ende der Umdrehung wird die Aus-
lösevorrichtung durch einen Nocken, der auf der Haupt-
welle sitzt, in die Ausgangsstellung gebracht.
Indem der Auslösebügel am Ende des Ganges auf den abge-
chrägten Arm. des Hebels (49) aufläuft, wird der Hebel
(39) aus dem Hebel (47) ausgerastet und der Eingriff der
Hebel (43) und (45) bei der Rückkehr des Auslösebügels
in die Ausgangsstellung vorbereitet. Nach Betätigen der
Taste eines Tastenhebels bleibt dieser bis gegen Ende des
Zyklus in der unteren Stellung, weil die obere Nase des
Gleitstückes (60) sich unter der unteren Kante der
Schiene (78) befindet. Das Gleitstück wird erst wieder
vom Auslösebügel (48) bei der Rückkehr mit weggezogen.
Auslösesperre
Die Auslösesperre Abb. 5 verhindert das Anlaufen der
Hauptwelle der Maschine, wenn gleichzeitig zwei oder
mehr Tastenhebel gedrückt werden.
Als Grundplatte für die Auslösesperre dient der Bügel
(2) mit den eingefrästen Schlitzen, in denen die Messer
(4) der Tastenhebel liegen. Durch die vordere und hin-
tere Wand der Grundplatte (2) gehen die Achsen (3) um
die sich U-Bügel (8) frei drehen können. Auf den Achsen
dieser Bügel liegen Rollen (7). Auf der Zeichnung 5 ist
die Auslösesperre dargestellt, nachdem das Messer (4)
des Tastenhebels die untere Stellung eingenommen hat.
Ein Teil der Rollen sind dadurch nach rechts und ein
Teil der Rollen nach links verschoben. Die äußeren
Rollen stoßen an die Anschläge (6) und (9), deren Stel-
lung durch die Schrauben (1) mit Kontermuttern ein-
justiert werden kann. Diese Stellung der Auslösevorrich-
tung entspricht dem Zeitpunkt, in dem die Hauptwelle der
Maschine anläuft.
Wenn gleichzeitig 2 oder mehr Tastenhebel betätigt werden,
dann verhindern die Rollen (7) eine Bewegung der Messer
in die untere Grenzstellung, und der Anlauf der Haupt-
welle ist nicht möglich.
Sperrvorrichtungen
Vorrichtung, die die Arbeit der Tastatur während des
automatischen Wagenrücklaufes verhindert (Abb. 2)
Die Hebel (84) und (102) sind mit dem rechten Arm des
Hebels (82) verbunden. Zusammen mit ihm führen sie wäh-
rend eines jeden Zyklus eine Hin- und Herbewegung aus.
Nachdem das 58. Zeichen der Zeile auf dem Papier abge-
druckt ist, wird die Zugstange (74) durch den Wagen nach
links verschoben, und mit ihr drehen sich die Hebel (84)
und (85). Der Ansatz des Hebels. (101) stellt sich gegen-
über den Ansatz des Hebels (86). Beim folgenden 59.
Zyklus klinkt der Hebel (109) mit seinem Ansatz den
Hebel (86) aus der Sperrschiene (22) aus. Unter dem Ein-
fluß der Feder verschiebt diese sich nach rechts. Die
Zähne der Sperrschiene legen sich unter die nichtge-
drückten Tastenhebel und verhindern, daß sie gedrückt
werden. Ein betätigter Tastenhebel wird in der unteren
Stellung von einem Zahn festgehalten, indem er in die
Aussparung am rechten Ende des Tastenhebels einfällt.
Beim Wagenrücklauf verschiebt sich die Zugstange (74)
nach rechts und stellt mit dem Hebel (85) die Ausgangs-
stellung der Sperrelemente wieder her.
Sperrvorrichtung, die das Anlaufen der Hauptwelle der
Maschine verhindert, wenn die Bedienungsperson den
Schlüssellochstreifen nicht richtig anwendet (Abb.2)
Wenn bei der Betriebsart Klartext im Transmitter des
Chiffrators ein Schlüssellochstreifen eingelegt wurde,
so wird die Stange (68), die mit dem in der Streifen-
führung hervorstehenden Knopf verbunden ist, herunter-
gedrückt. Über Zwischenelemente (69, 72, 62, 52)
werden die Hebel (47) und (39) ausgehakt, deshalb ist
ein Anlaufen der Hauptwelle nach Betätigung eines
Tastenhebels nicht möglich.
Sperrvorrichtung, die ein Anlaufen der Hauptwelle der
Maschine ausschließt, wenn der Schlüssellochstreifen
zu Ende ist (Abb. 2)
Nachdem der Schlüssellochstreifen, der in den Trans-
mitter am Chiffrator eingelegt wurde, zu Ende ist, d.h.
wenn im Streifen keine Schlüsselkombinationen mehr vor-
handen sind, sprechen die Bauelemente an, die die Zug-
stange (96) freigeben. Diese geht in die untere Stellung.
Dabei entfernt sich der rechte Arm (8) des Hebels (93)
von der 2. Sperrschiene (9) und gibt dieser die Möglich-
keit, sich nach rechts zu verschieben, die Tastenhebel
zu blockieren und das Anlaufen der Hauptwelle unmöglich
zu machen. Die Hebel (92) und (91) und die Zugstange
(90) schalten den automatischen Transmitter aus, indem
sie auf die Auslöseelemente einwirken.
Sperrschiene
In der Tastatur befindet sich eine Sperrschiene (20)
Abb. 2 die es ermöglicht, bestimmte Tastenhebel in Ab-
hängigkeit von der Stellung des Betriebsartenumschalters
zu betätigen und andere nicht.
Die Sperrschiene wird durch den Nocken (6) Abb. 6 ge-
steuert.Wird der Betriebsartenumschalter auf K gestellt
Abb. 6a bewegt sich die Sperrschiene 3 in Längsrich-
tung auf 2 Stiften (2) und (7) und verhindert nicht das
Herunterdrücken der Zwischenraumtaste (1), der Taste X
(4) und der Wagenrücklauftaste (5). Steht der Betriebs-
artenumschalter auf D, so sperrt die Schiene die Zwischen-
raumtaste (1) und die Wagenrücklauftaste (5). Steht der
Betriebsartenumschalter auf C, so sperrt die Schiene
die Tasten X (4) und Wagenrücklauf (5).
Die Wagenrücklauftaste
Die Wagenrücklauftaste dient dazu, den Wagen aus einer
beliebigen Stellung in die Anfangsstellung zu bringen.
Bei Betätigen der Wagenrücklauftaste läuft die Haupt-
welle der Maschine an und der Elektromagnet im Zeichen-
zählwerk mit Zwischenraumgeber, der die Auflagestücke
von Wagenrücklauf und Zeilenvorschub steuert, zieht an.
Bei Drücken der Wagenrücklauftaste wird der Hebel (79)
Abb. 2 gedreht und die Zugstange (73), die in den Zahn
(65) des Hebels (66) eingreift, bewegt. Am Ende der Be-
wegung rastet die Zugstange (73) aus dem Zahn des Hebels
(66) aus. Der Hebel (66) schaltet mit der Stange (74)
die Kupplung für den Wagenrücklauf ein. Bei Ende des
Wagenrücklaufes wird der Hebel (66) durch die Zugstange
(74) in seine Ausgangsstellung gebracht. Nachdem die
Wagenrücklauftaste losgelassen wird, rastet die Zug-
stange (73) wieder in den Zahn des Hebels (66) ein.
Die Zwischenraumtaste
Die Zwischenraumtaste besteht aus der Leiste (18) Abb. 2
und 2 Hebeln (11), (21), die durch die Zugstange (14)
verbunden sind. Die Bewegung dieses Systems bei Drücken
der Leiste (18) wird über die Zugstange (23) und den
Hebel (31) auf den Hebel (54) übertragen, der auf die
Auslösevorrichtung der Tastatur einwirkt.
Das Selektionsdruckwerk
Das Selektionsdruckwerk dient zum Drucken des Textes
auf das Papier und zur Steuerung der Auflagestücke
des Stanzblockes mit Hilfe der Wählschienen des Kombi-
nators.
Der prinzipielle Aufbau des Selektionsdruckwerkes ist im
Funktionsschema dargestellt Abb. 7.
Auf Grund der Aufgabenstellung enthält das Selektions-
druckwerk:
a) Exzenterantrieb
b) Druckwerk
c) Kombinator
d) Farbbandgabel
e) Farbbandtransport und Farbbandumkehrung
f) Nockenwellen
g) Zusätzliche Bauteile.
In Abhängigkeit von der Stellung des Arbeitsumschalters
führt das Selektionsdruckwerk folgende Arbeiten aus :
a) Drucken des Textes auf Papier
b) Einstellung einer Kombination von Ansatz-
stücken des Lochers
c) Drucken des Textes auf Papier und Einstellung
einer Kombination von Ansatzstücken des Lochers.
Exzenterantrieb
Der Exzenterantrieb Abb. 8 dient zur Umwandlung der
Drehbewegung des Exzenters in Hin-und Herbewegung der
Stange (4) mit dem Bügel (5). Das Bewegungsgesetz der
Stange (4) wird durch das Profil des Exzenters (11)
bestimmt. Der Exzenterantrieb besteht aus dem Hebel
(8) mit der Rolle (10), der Feder (9), der Zugstange
(6), die die Hebel (2) und (8) miteinander verbindet.
Die Lage des Hebels (2) auf der Achse (1) kann in ge-
wissen Grenzen durch Schrauben und Andruckleiste (12)
verändert werden. Die Achse (1) ist starr mit dem He-
bel (3) verbunden, der die Stange (4) mit dem Bügel
(5) bewegt. Auf der Abb. 8 ist die Stoppstellung des
Exzenterantriebes dargestellt. In diesem Falle befindet
sich die Rolle (10) des Hebels (8) auf dem maximalen
Radius des Exzenters (11) und wird durch die Feder (9),
deren Spannung mit Hilfe der Mutter (7) reguliert werden
kann, an den Exzenter gedrückt. Die Stange (4) mit dem
Bügel (5) sind in ihrer linken Endstellung.
Bei Drehung der Hauptwelle der Maschine läuft die Rolle
(10) auf dem Exzenter (11). Die Zugstange (6) und der
Hebel (2) dreht die Achse (1) entgegen dem Uhrzeiger-
sinn. Der Hebel (3) schiebt die Stange (4) mit dem
Bügel (5) in die rechte Endlage, wie es in Abb. 9
dargestellt ist.
Druckwerk
Das Druckwerk Abb. 10 dient dem Abdrucken der Zeichen,
die von der Tastatur eingegeben werden und zur Steue-
rung der Wählschienen des Kombinators.
Das Druckwerk besteht aus den Elektromagneten (1), aus
den Freigabehebeln (14) , dem Druckbügel (5), den Stoß-
hebeln (11) und den Typenhebeln (8).
Bei Stoppstellung der Hauptwelle der Maschine sind die
linken Enden der Stoßhebel (11) durch den Druckbügel
in die untere Stellung gebracht, so daß ein Spalt
zwischen ihnen und der Sperrnase des Freigabehebels
(14) vorhanden ist. Bei Betätigen eines Tastenhebels
wird die Hauptwelle für einen Arbeitszyklus freigegeben
und die Wicklung eines der Elektromagneten (1) erhält
einen Stromimpuls.
Der Anker des Elektromagneten überwindet die Kraft der
Feder (1)) und bewegt die Stange (2) nach rechts. Der
Freigabenebel (14) nimmt die punktiert gezeichnete Stel-
lung ein. Nach Anziehen des Elektromagneten beginnt
sich der Hebel (3) zu bewegen und schiebt die Stange
(4) mit dem Druckbügel (5) nach rechts.
Das linke Ende des Stoßhebels (11), der nicht vom Frei-
gabehebel (14) festgehalten wird, wird durch die Kraft
der Feder (15) an die obere Kante des Druckbügels (5)
gedrückt und greift bei Rechtsbewegung des letzteren
ein.
Von diesem Moment an bewegen sich der Druckbügel (5)
und der Stoßhebel (11) gemeinsam. Da der Typenhebel
(8) mit dem Stoßhebel (11) verbunden ist, wird er um
die Achse (9) gedreht. Die Bewegung des Druckbügels (5)
und des Stoßhebels (11) geht im Laufe eines Arbeits-
zyklus in einem kurzen Zeitabschnitt (t = 30 ms) vor
sich, infolge dessen erhält der Typenhebel eine bedeu-
tende Geschwindigkeit.
Auf der Abbildung 11 ist eine Zwischenstellung der
Teile des Druckwerkes und auf Abb. 12 der Zeitpunkt,
an dem der Typenkopf auf das Papier auf der Wagen-
walze schlägt, dargestellt. Vor dem Schlag des Typen-
kopfes an die Wagenwalze läuft der Typenhebel (8) in
einer Führungsgabel, die die Stelle des Abdruckes auf
dem Papier festlegt und mit deren Hilfe ein gleichmäs-
siger Abstand zwischen den gedruckten Zeichen erreicht
wird. Die Einfärbung des Buchstabens erfolgt durch das
Farbband, das durch die Farbbandführung (7) gehalten
wird, die durch den Hebel (6) gesteuert wird. Der Hebel
(6) nimmt vor dem Anschlag der Type auf die Walze Abb.
11, 12 die obere und in der Stopplage des Druckwerkes
Abb. 10 die untere Stellung ein.
Die Deutlichkeit des abgedruckten Zeichens hängt von
der Endgeschwindigkeit des Typenhebels ab, die durch
den Abwurfbügel (12) bestimmt wird.
Praktisch wird der Abwurfbügel (12) so angeordnet, daß
er den Stoßhebel (11) von dem Druckbügel (5) bereits vor
dem Anschlag des Typenhebels auf die Wagenwalze ab-
streift Abb. 11. Infolge dessen legt dieser den letzten
Teil des Weges auf Grund seiner Trägheit zurück, wo-
durch der Schlag der Type abgeschwächt und folglich
auch die Deutlichkeit geringer wird. Nach dem Anschlag
auf die Wagenwalze wird der Typenhebel durch die Kraft
der Feder (15) wieder in die Ausgangsstellung gebracht,
die durch den Lederkissen (16) begrenzt ist.
Kombinator
Der Kombinator Abb. 7 dient zur Steuerung der Auflage-
stücke des Lochers und besteht aus 5 Wählschienen (29)
mit Federn (30). Die Wählschienen sind als Teile eines
Kreisbogens ausgeführt und mit Aussparungen versehen,
in die beim Anziehen der Elektromagnete (31) die unteren
Arme der Freigabehebel (36) einfallen.
In der Stoppstellung der Welle mit dem Nocken (15)
befindet sich die Rolle des Hebels (20) auf dem maxi-
malen Radius des Exzenters (19). Mit dem Regelarm des
Hebels (27) werden die Wählschienen in die rechte Stel-
lung gebracht, bei der sich in allen. Schienen für die
unteren Arme der Freigabehebel eine Aussparung befindet.
In diese kann bei Ansprechen eines beliebigen Elektro-
magneten des Selektionsdruckwerkes der untere Arm des
Freigabehebels einfallen. Bei Drehung der Welle mit dem
Nocken (15) geht die Rolle des Hebels (20) auf den klei-
nen Radius des Exzenters(19) über. In diesem Falle be-
wegen sich die Schienen unter dem Einfluß der Federn
(30) nach links.
Die Drehung der Nockenwelle erfolgt erst nach den An-
sprechen eines der Elektromagneten des Selektionsdruck-
werkes, d.h. nach dem Einfallen des Freigabehebels (36)
in die Aussparungen der Schienen. Die Abmessungen der
Aussparungen der Wählschienen sind in der Länge
verschieden und so berechnet, daß jeder Freigabehebel
eine nur ihm eigene Stellung der Wählschienen (29) und
der mit letzteren verbundenen Hebel (26) gewährleistet.
Die oberen Arme der Hebel (26) sind mit den Auflage-
stücken des Lochers verbunden.
Die unteren Arme der Hebel (26), die mit dem Feststell-
hebel (23) zusammenwirken, dienen zum Verriegeln der
Wählschienen bis zur Beendigung des Stanzens des ent-
sprechenden Zeichens.
Der Feststellhebel (23) wird durch den Nocken (22) und
die Feder (24) gesteuert.
Nach Einstanzen der Kombination in die Streifen wird der
Feststellarm des Hebels (23) losgelassen und die wähl-
schienen (29) werden durch den Exzenter (19) und die
Hebel (20) und (27) in die Ausgangsstellung gebracht.
Farbbandgabel
Während der Stoppstellung der Hauptwelle der Maschine
befindet sich das Farbband, mit dessen Hilfe die Typen
eingefärbt werden, unter der zu schreibenden Zeile und
behindert nicht die Kontrolle des geschriebenen Textes.
Zum Moment des Anschlages wird das Farbband angehoben
und zwischen Type und Papier gelegt. Das Heben und Senken
des Farbbandes erfolgt durch die Farbbandgabel. Am
rechten Ende der Stange (38) Abb. 7 ist eine frei dreh-
bare Rolle angebracht, die mit der unteren Nase des
Hebels (46) zusammenwirkt. In der Nut des Hebels (46)
liegt ein Finger, der starr mit der Farbbandgabel (47),
in deren oberen Ende das Farbband durchgeführt wird,
verbunden ist.
Bei Bewegung der Stange (38) nach rechts läuft die Rolle,
die an ihrem einen Ende befestigt ist, an der Schräge
des Hebels (46) entlang, verschiebt denselben und die mit
ihm verbundene Farbbandgabel (47) vor dem Anschlag der
Type in die obere Stellung vor das Blatt; der Hebel
(46) mit der Farbbandgabel (47) wird durch eine Feder
in die untere Lage gezogen.
Farbbandtransport und Farbbandumkehrung
Beim Abdrucken von Text bewegt sich das Farbband auto-
matisch nach Abdruck des Zeichens weiter. Die Weiter-
schaltung des Farbbandes erfolgt durch den Farbbandtrans-
port. In der Maschine wird ein Farbband von 13 mm Breite
verwandt. Die Enden des Farbbandes sind auf 2 Spulen, die
starr mit den Achsen (54) Abb. 7 verbunden sind, be-
festigt. Der Hebel (57), der der Umlaufbahn des Druck-
exzenters (58) folgt, bewegt das Schaltrad (1) um einen
Zahn weiter. Die Achse (6) mit dem auf ihr befestigten
Schaltrad (1), den 2 Zahnrädern (9) und den abgeschrägten
Buchsen (4) und (8) nimmt im Laufe. der Arbeit entweder
die rechte oder linke Endstellung ein.
In der rechten Endstellung der Achse (6) greift das
rechte Zahnrad in das Zahnrad (2) ein, das auf der
Achse (54) mit der Spule, auf die das Farbband gewickelt
wird, sitzt. In dieser Stellung sind die Zahnräder (9)
und (11) nicht im Eingriff und das Farbband kann un-
gehindert aufgewickelt werden. Das Fähnchen wird durch
die Feder (10) an das Band gedrückt. In dem Maße wie
sich das Band aufgewickelt, nähert sich das untere gebo-
gene Ende der Achse der abgeschrägten Buchse (8) und
greift letzten Endes in die Abschrägung ein. Bei einer
weiteren Drehung der Achse (6) wird diese nach links ge-
schoben. Die Zahnräder (9) und (11) kommen zum Eingriff,
folglich ändert sich die Bewegungseinrichtung des Farb-
bandes.
Deshalb hängt der Moment der Umkehrung des Farbbandes
von der minimalen Anzahl der Farbbandlagen auf der Spule
ab, auf die es aufgewickelt wird.
In jeder Endstellung wird die Achse (6) festgehalten, da-
mit ein Ausrasten der arbeitenden Zahnräder verhindert
wird.
Zusatzvorrichtungen
Zu den Zusatzvorrichtungen gehören :
1. der Feststellhebel (61) Abb. 7. der durch den
Nocken (62) gesteuert wird. Steht der Arbeits-
umschalter auf L, so wird durch den Hebel (61)
der Hebel (57) blockiert.
2. der Hebel (48). der die Bauteile für die Teilung
des Geheimtextes in Fünfergruppen vornimmt. Die
Steuerung des Hebels erfolgt vom Betriebsarten-
umschalter durch die Zugstange (59).
3. das System von Zugstangen (51), (44), (42), (35),
(34), das von dem Nocken der Hauptwelle gesteuert
wird und die Fortbewegung des Wagens in jedem
Zyklus bewirkt.
Antrieb
Das Getriebe Abb. 13 ist für den Antrieb der mechanischen
Bauteile der Maschine bestimmt.
Es enthält:
a) den Elektromotor SL - 369 U/A1 mit Regler
b) die Hauptwelle der Maschine
c) die Welle für den Wagenrücklauf
d) die Steuerung für die Kupplung der Welle für
den Wagenrücklauf
e) den Zähler für die Arbeitszyklen der Maschine
f) den Impulskontakt IK
g) Zwischenübertragungselemente
Der Elektromotor SL - 369 U/A 1
Der Elektromotor SL - 369 U/A1 wird vom Gleichstrom-
netz mit einer Spannung von 110 Volt oder vom Wechsel-
stromnetz mit einer Spannung von 127 V über einen Trafo,
der im Stromversorgungsteil eingebaut ist, gespeist.
Die elektrische Verbindung der Wicklungen des Elektro-
motors mit den Bauelementen, die sich in der Grundplatte
der Maschine befinden, erfolgt durch einen Stecker. An
einem Ende der Welle des Elektromotors ist eine Schnecke
(5) angebracht, die in das Schneckenrad (70) auf der
Hauptwelle der Maschine eingreift, und am anderen Ende
ein Fliehkraftregler Abb. 86.
Der Regler sitzt auf der Welle des Elektromotors. Um die
Welle des Elektromotors bequem mit der Hand drehen zu
können, was beim Einstellen der Maschine erforderlich
ist, besitzt der Regler eine Kappe mit gerändelter Ober-
fläche. Unter der Kappe befinden sich auf Achsen zwei
Winkel (2) und (5), die frei drehbar sind.
In dem Winkel (2) ist eine Schraube (3) zum Spannen der
Feder (4) eingeschraubt, die zwischen den Winkeln (2)
und (5) befestigt ist. Die Konsole (11) ist an der
Haube des Elektromotors befestigt. Die Kontaktfedern
(6) und (7) sind am Winkel (8) befestigt. Die Umdrehungs-
geschwindigkeit der Welle des Elektromotors verändert
sich je nach dem Abstand der Kontaktfedern vom Winkel
(5). Der Abstand wird von Hand aus durch die Rändel-
mutter (9) eingestellt. Diese ist auf das Gewinde der
stange (10) aufgeschraubt. Alle Teile des Motors sind
im Gußgehäuse untergebracht.
Die Hauptwelle der Maschine
Auf der Hauptwelle der Maschine Abb. 13 befinden sich :
a) eine Start-Stopp-Kupplung, die aus einem ge-
triebenen Teil (69) und einem treibenden Teil,
der mit dem Schneckenrad (70) fest verbunden
ist, besteht
b) ein Nocken (60), der die Stopp-Stellung der
Hauptwelle durch den Hebel (59) mit der Feder
(58) fixiert.
c) ein Nocken (61), der die Arbeit des Impulskon-
taktes (62) steuert.
d) ein Zahnrad (64), das die Bewegung über das
Zahnrad (65) auf die Antriebswelle des Chiffra-
tors überträgt.
e) ein Nocken (66), der die Stoppstellung der
Auslösevorrichtung der Tastatur wieder her-
stellt.
f) ein Nocken (17), der den Wagen in jedem Ar-
beitszyklus der Maschine schrittweise weiter-
schaltet.
g) eine Schnecke (18) für die mechanische Über-
tragung zum Zähler (13).
h) ein Nocken (20), der den Antrieb des Selek-
tionsdruckwerkes steuert.
i) ein Nocken (19) der die Start-Stopp-Kupplung
des Lochers einschaltet.
Vom treibenden Teil der Hauptwelle der Maschine wird die
Bewegung über das Zahnrad (52) und die Welle mit der Kar-
dangabel des Kreuzgelenkes (24) auf das Automatikgetrie-
be übertragen und über die Zwischenwelle (41) mit den
Rädern (42) und (40} auf die Welle für den Wagenrücklauf.
Die Start-Stopp-Kupplung
Auf der Hauptwelle der Maschine wurde eine Start-Stopp-
Kupplung mit Stirneingriff verwendet Abb. 14. Die Kupplung
besteht aus 2 Teilen - dem treibenden und dem getriebenen.
Bei eingeschalteter Maschine wird der treibende Teil der
Kupplung unaufhörlich durch den Elektromotor SL -369
U/A 1 gedreht.
Nachdem eine der Tasten gedrückt wurde, greift der ge-
triebene Teil der Kupplung in den treibenden Teil ein
und vollführt eine Umdrehung. Eine Umdrehung der Haupt-
welle entspricht einem Arbeitszyklus der Maschine.
Nach einer Umdrehung wird der getriebene Teil vom trei
benden Teil gelöst und in einer bestimmten Stoppstellung
festgehalten.
Die Scheibe (7) mit den Stirnzähnen auf der rechten Seite
ist der treibende Teil der Kupplung und mechanisch fest
mit dem Schneckenrad (18), der Buchse (19) und dem Zahn-
rad (20) verbunden.
Die angeführten Elemente sind auf (2) Kugellagern ge-
lagert und können sich auf der Welle (1) drehen. Die
beiden Scheiben (8) und (9), die mit den Schrauben (22)
verschraubt sind, bilden den getriebenen Teil der Kupp
lung. Auf der linken Seite der Oberfläche der Scheibe
(8) sind Stirnzähne eingeschnitten.
Die Scheiben (8) und (9) sind auf der Buchse des Hebels
(16) angebracht. Sie können sich in bestimmten Grenzen
axial darauf verschieben.
Die Welle (1) bewegt sich frei in der Buchse des Hebels
(16). Der Nocken (11), der durch Stiftverbindung fest
mit der Welle (1) verbunden ist, hat im linken Stirn-
teil Klauen, die in die Nuten der Scheibe (9) eingrei
fen. Durch diese Stirnkupplung wird eine feste mecha-
nische Verbindung des getriebenen Teils der Kupplung mit
der Welle (1) und den auf ihnen angebrachten Bauteilen
erreicht. Der dreiarmige Hebel (16) und die Scheibe
(9) besitzen je 3 konische Lagerpfannen, die im Winkel
von 120° zueinander stehen. Die Lagerpfannen im Hebel
(16) liegen den Lagerpfannen in der Scheibe (9) gegen-
über. In jedem sich gegenüberliegenden Pfannenpaar be-
lung findet sich eine Stahlkugel (10).
Der Eingriff des getriebenen Teils der Kupplung in den
treibenden Teil wird durch die 4 Federn (12) gewährlei-
stet, die den getriebenen Kupplungsteil bis zum Eingriff
der Klauen ineinander nach links verschieben. Der linke
Teil der Lagerbuchse des Hebels (16) legt sich dabei auf
das Lager (11). Das Lager kann sich nicht nach links
verschieben, da der Hebel (5) starr mit der Welle (1)
verbunden ist.
In Abb. 14 ist die Hauptwelle mit der geschlossenen
Start-Stopp-Kupplung dargestellt. In diesem Falle wird
die Drehung des treibenden Teils der Kupplung über die
in Eingriff befindlichen Klauen auf den getriebenen
Teil übertragen und über den Nocken (11) auf die Welle
(1) mit den darauf angebrachten Bauteilen. Bei der ein-
gerasteten Start-Stopp-Kupplung wird der Hebel (16)
durch die Feder (21) entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.
Dabei liegt der untere rechte Arm des Hebels (16) auf
einer der Klauen (23) der Scheibe (9) und die konischen
Lagerpfannen mit den Kugeln (10) im Hebel (16) und
in der Scheibe (9) liegen sich gegenüber. Um den getrie-
benen Kupplungsteil vom treibenden Teil zu lösen, ist
es erforderlich, den Hebel (16) zu stoppen, indem unter
seinen oberen Arm der über den Umfang der Scheibe hinaus-
ragt, ein fester Anschlag geschoben wird.
Nach dem Stoppen des Hebels (16) dreht sich der getrie-
bene Kupplungsteil noch um einen bestimmten Winkel und
rastet dann aus, da die Kugeln (10), indem sie sich
an den schrägen Oberflächen der konischen Lagerpfannen
abwälzen, den Spielraum zwischen Hebel (16) und Scheibe
(9) vergrößern.
Bei der Vergrößerung dieses Spielraumes kann sich der
Hebel (16) nicht nach links verschieben, da seine Lager-
buchse auf das Lager (17) drückt. Die Kugeln (10)
drücken die Scheibe (9) und die fest mit ihr verbundene
Scheibe (8) nach rechts bis der getriebene Kupplungs-
teil aus der Zahnkupplung des treibenden Teils ausrastet.
Der ausgerastete getriebene Kupplungsteil und die Welle
(1) mit den darauf befindlichen Bauteilen wird nach
dem Stopp durch den Nocken (13) und einen Hebel mit
Rolle und Feder in einer bestimmten Stellung fixiert.
Das Ein-und Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung der
Hauptwelle erfolgt durch einen Hebel, der auf dem Ge-
triebeblock angebracht und mit dem Auslösebügel der
Tastatur mechanisch verbunden ist.
In der Start-Stopp-Kupplung befindet sich eine Vor-
richtung (6), die eine Erhöhung der Umdrehungsgeschwin-
digkeit des getriebenen Teiles der Kupplung im Ver-
gleich zum treibenden Teil verhindert. Das ist prak-
tisch möglich, wenn über Zwischenelemente Federkräfte,
die durch die starken Federn der mechanischen Baugruppen
der Maschine entstehen, auf den getriebenen Kupplungs-
teil einwirken.
Diese Vorrichtung besteht aus dem Nocken (5), der auf
der Welle (1) verstiftet ist, der Kugel (2?), der
Zarge (26) und der Feder (25). Bei Erhöhung der Umdre-
hungsgeschwindigkeit des getriebenen Kupplungsteils
im Vergleich zum treibenden Teil keilt sich die Kugel
(27) zwischen die schrägen Oberflächen der Scheibe (7)
und des Nockens (5). Dadurch ist ausgeschlossen, daß die
beiden Kupplungsteile sich mit verschiedener Geschwindig-
keit drehen.
In Abb. 14 ist angeführt, wie die Nocken auf der Haupt-
welle der Maschine bei Stoppstellung der Start-Stopp-
Kupplung liegen.
Die Welle für Wagenrücklauf
Die Welle für Wagenrücklauf dient dazu, den Wagen
aus einer beliebigen Stellung in die Stellung "Zeilenan-
fang" zurückzuführen. Die Welle für Wagenrücklauf wird
von dem sich ständig drehenden Teil der Hauptwelle der
Maschine über die Zahnräder (52), (42), (40) und (27)
Abb. 13 in Umdrehung versetzt. Beim Schließen der Kupp-
lung (34) wird die Bewegung über das Schraubenrad (33)
auf das Rad (32) übertragen. Das befindet sich am Selek-
tionsdruckwerk und ist mit einer Trommel mit Spiralfeder
im Unterbau des Wagens mechanisch verbunden.
Auf der Welle (1) Abb. 15 befinden sich ein Zahnrad (2),
das vom Getriebe der Maschine bewegt wird, eine Reibungs-
kupplung und eine Kupplung (9), (10) mit Stirnzähnen.
Die Reibungskupplung dient zur Abschwächung des Stoßes
auf die Wagenteile, der in dem Augenblick auftritt, wenn
die Kupplungsteile (9), (10) ineinander eingreifen.
Die Zahnkupplung besteht aus dem treibenden Teil (9)
und dem getriebenen Teil (10).
Die Reibungskupplung besitzt 3 Stahlscheiben (6), (7),
und (12). Die Scheibe (12) ist mit der Welle durch den
Keil (8) verbunden und trägt die Scheiben (6) und (7).
Die Scheiben (6) und (12) sind miteinander gekuppelt.
Zwischen den Scheiben (6), (7) und (12) sind Filzbeläge
(13) angebracht.
Die Reibungskraft zwischen den Scheiben (6), (7) und
(12) und den Filzbelägen (13) wird durch die Federn
(14) hervorgerufen, deren Spannung von der Mutter (4)
eingestellt wird. Diese Einstellung wird von der
Kontermutter (3) fixiert. Die Scheibe (7) hat zwei Na-
sen, die in die Aussparungen der getriebenen Buchse
(11) eingreifen. Die letztere ist mit dem treibenden
Teil (9) der Kupplung, deren Stellung auf der Welle
(1) durch den Wagensteuerungshebel verändert wird,
durch Klauen verbunden. Nach Schreiben des 59. Zeichens
auf einer Zeile rastet der Wagen, indem er an der Zeile
entlang gleitet über ein Hebel- und Stangensystem den
treibenden Teil (9) der Kupplung mit den getriebenen
Teil (10) ein. Dabei wird die Umdrehung des Zahnrades
(2) über den Keil (8), die Scheiben (6), (12) und die
Zwischenbeläge (13) auf die Scheibe (7), die Buchse.
(11) und die in Eingriff befindliche Kupplung (9),
(10) übertragen.
Diese Stellung nehmen die Bauteile der Welle bis Zei-
lenvorschub und Wagenrücklauf beendet ist ein. Danach
wird der treibende Teil (9) der Kupplung mit Stirnzäh-
nen selbsttätig außer Eingriff mit dem getriebenen Teil
(10) gebracht.
Steuerung der Kupplung der Welle für Wagenrücklauf
Die Steuerung ist auf dem Funktionsschema Abb. 13 dar-
gestellt. Auf der Achse (53), die sich in Gleitlagern
auf dem Getriebeblock der Maschine dreht, sind die He-
bel (47), (51) und (54) angebracht. Der Hebel (47) ist
an der Achse (53) befestigt und wird über die Stange
(43) durch den Wagen gesteuert, wenn dieser die Zeile
entlanggleitet.
Der Hebel (51) mit der Zugstange (45) ist mit dem Hebel
(37) verbunden, der den Führungsteil (34) der Zahnkupp-
lung der Welle für Wagenrücklauf steuert.
In ausgerasteter Stellung des treibenden Teils (34) der
Kupplung verbleibt letzteres in dieser Stellung durch
die Hebel (50) und (51), die mit den Sperrnasen ein-
rasten.
Beim Schreiben des Textes auf das Blatt verändert sich
bis zum 57. Zeichen der Zeile die Stellung der Bauteile
der Steuerung nicht. Nach dem Schreiben des 58. Zeichens
verschiebt der Wagen den Hebel (47) über die Zugstange
(43) in die mittlere Stellung, die durch den Hebel (55)
und Feder (56) fixiert wird. Dabei drückt die untere
Schraube im Hebel (47) auf den linken Arm des Hebels
(50) und dreht ihn teilweise vom Hebel (51) weg.
Es handelt sich hierbei um eine vorbereitende Stellung
der Bauteile. Nach dem Schreiben des 59. Zeichens in
der Zeile verschiebt der Wagen bei seiner Bewegung den
Hebel (47) in der gleichen Richtung. Die untere Schrau-
be im Hebel (47) rastet die Hebel (50) und (51) aus.
Durch die Feder (44) schließt der Hebel (37) über die
Zugstange (45) die Kupplung (34), (33). Die Walze springt
auf eine neue Zeile über. Danach beginnt der Wagenrück-
lauf.
Nach dem Rücklauf schlägt der Wagen mit der rechten
Seite auf den Anschlag (46) und dreht ihn mit dem Hebel
(54) und der Achse (53) zurück.
Durch die Schraube (57) werden die Hebel (50) und (51)
wieder eingerastet. die Kupplung (33), (34) auagerastet,
und durch die Schraube (48) wird der Hebel (47) und die
Zugstange (43) in die rechte Ausgangsstellung zurück-
gebracht.
Der Zähler für die Arbeitszyklen der Maschine
Für jeden Arbeitszyklus der Maschine wird die Drehung
des Start-Stopp-Teils der Hauptwelle auf den Zähler (13)
Abb. 13 über das Schneckenradpaar (18), (23), die Welle
(15) und die Schnecke (14) übertragen. Der Zähler be-
sitzt 4 Ziffernscheiben. Jede Zähleinheit einer Scheibe
des Zählers entspricht 5000 Arbeitszyklen der Maschine.
Die Periode des Zählers entspricht 50 Mill. Arbeitszyklen
der Maschine.
Der Impulskontakt IK
Der Impulskontakt (62) Abb. 13 wird durch den Nocken
(61) gesteuert und von ihm für einen bestimmten Teil des
Arbeitszyklus der Maschine geschlossen.
Nach Drücken einer Taste und Auslösen der Hauptwelle
der Maschine schließt der Impulskontakt den Stromkreis
für eine der Spulen der Elektromagneten im Selektions-
druckwerk. Entsprechend der gedrückten Taste wird ge-
währleistet, daß ein Stromimpuls durch die Wicklung
eines der Elektromagneten läuft und dieser anzieht.
Die Zwischengetriebeelemente
Von der Hauptwelle wird die Bewegung auf den automatik-
antrieb übertragen. Dieses geschieht durch das Zahnrad
das auf der Zwischenwelle mit der Kardangabel (24)
angebracht ist und sich im ständigen Eingriff mit dem
Zahnkranz der Buchse des Schneckenrades (70) befindet.
Der Wagen
Der Wagen hat folgende Funktionen zu erfüllen :
a) Halten des Blattes beim Schreiben des Textes
b) Horizontales Verschieben des Blattes um 2,8 mm
nach Schreiben eines jeden Zeichens.
c) Vorschub des Blattes auf eine neue Zeile.
Der Wagen ist für Blätter vom Format DIN A 4 berechnet.
Auf jeder Zeile des Blattes finden 59 Zeichen Klartext
oder 10 Fünfergruppen Geheimtext mit Zwischenräumen
Platz.
Der Wagen Abb. 16 besteht aus dem Unterbau (2) und dem
beweglichen Teil (3).
Im Unterbau des Wagens befinden sich zwei Führungsbolzen
(8) und (24), die in die Führungsbuchsen im Selektions-
druckwerk hineinragen. Der bewegliche Teil des Wagens
kann sich längs des Unterbaus mit Hilfe eines Rollen-
käfigs bewegen, der in Führungsprismen liegt. In den
Führungsprismen werden sie durch Zahnscheiben gehalten,
indem diese in die Zahnstangen (14) eingreifen.
Zum Verschieben des beweglichen Wagenteils dient die
Spiralfeder (7), die in der Zahnradtrommel (6) liegt.
Das eine Ende der Spiralfeder ist am Bolzen (8) befestigt,
das andere Ende an der Trommelwand (6).
An der unteren Seite der Trommel befinden sich zwei
Zapfen, die in die Löcher des Zahnrades (4) eingreifen,
das durch die Kupplung der Welle für Wagenrücklauf be-
wegt wird. Nach dem Schreiben des 59. Zeichens einer
Zeile bewirkt die Welle für Wagenrücklauf einen Sprung
der Walze (53) auf die nächste Zeile und den Rücklauf
des beweglichen Wagenteils an den Anfang dieser Zeile.
Gleichzeitig wird die Spiralfeder aufgezogen.
Die Kraft der Spiralfeder überträgt sich über die
Zahnräder (9), (10), (11) und die Zahnstange (29)
auf den beweglichen Wagenteil, dessen Bewegung durch die
Rastklinken (39) und (40) verhindert wird. Die Nasen
der Rastklinken greifen in die Zähne der Zahnstange
(41) ein, die mit dem beweglichen Wagenteil fest ver-
bunden ist.
Die Walze auf die das Blatt aufgelegt wird, besteht
aus dem Holzzylinder (54) mit Gummiüberzug (53).
Auf den Stirnflächen sind das Rastrad (55) und das
Schaltrad (23) befestigt.
Durch den Holzzylinder (54) geht eine Stahlachse (31)
mit 2 Drehknöpfen (1), (32), die zum Drehen der Walzen
von Hand aus dienen. Die Achse (31) dreht sich in La-
gern auf den Ständern (33), (60).
Unter der Walze (53) befindet sich die Papierführung
(51), die an den Bügeln (17), (61) befestigt ist. Zwischen
den Bügeln liegen auf 4 Spitzen (63) zwei Papieran-
druckwalzen (16). Die letzteren sind unter den Ein-
schnitten in der Papierführung (51) angebracht und
ragen etwas über deren Oberfläche hinaus. Die Bügel
(17) und (61) liegen auf, den Zapfen (18) der beiden He-
bel (19), die sich auf der Achse (44) drehen können.
Die beiden Federn (42), deren Spannung über die Zahn-
kupplungen (15) und (43) eingestellt wird, drücken
die Papierandruckwalzen (16) an die Walze (53).
Zum Einspannen des Blattes in den Wagen wird die Pa-
pierführung durch Zurückdrücken des Hebels (57) nach
unten geführt.
Der untere Arm des Hebels (57) bewegt den Hebel (58),
der mit der Achse (44) verbunden ist. Dadurch gehen
die Hebel (20) und (19) mit der Papierführung (51)
in die untere Stellung, wobei sich zwischen den
Papierandruckwalzen (16) und der Walze (53) ein
Zwischenraum bildet, der zum Einlegen des Blattes
genügt.
Bei Rückführung des Hebels (57) in die Ausgangsstel-
lung wird das Blatt durch die Walzen der Führung (51)
an die Walze (53) des Wagens gedrückt.
Nach dem Schreiben des Zeichens wird der bewegliche
Teil des Wagens mit dem Blatt einen. Schritt weiterbe-
wegt.
Die Arbeit des Systems, das die Weiterbewegung des be-
weglichen Wagenteils steuert, geht in folgender Weise
vor sich: Abb. 17
Die Zahnstange (7) ist mit dem beweglichen Wagenteil fest
verbunden. In die Zähne der Stange (7) greifen die Nasen
der Rastklinken (5) und (6) ein. Die Rastklinken besitzen
Langlöcher, durch die eine Achse (3) geht. Durch die Fe-
dern (4) werden die Klinken nach rechts gezogen. Ihre
stabile Stellung in der horizontalen Ebene wird durch
die entsprechenden Führungen gewährleistet.
Die Stange (7) mit dem beweglichen Wagenteil strebt durch
die Kraft der sie bewegenden Spiralfedern danach, sich
nach links zu verschieben. Das wird jedoch durch die
Nase der Rastklinke (6) verhindert. Die rechte Kante
des Langloches stößt auf die Achse (3) Abb. 17a. Nach
Schreiben des Zeichens rastet der Vorschubhebel (2) die
Rastklinke (6) aus der Stange (7) Abb. 17b aus.
Der bewegliche Wagenteil bewegt sich so weit nach links,
wie es das Langloch der Rastklinke zuläßt.
Nach Schreiben des nächsten Zeichens rastet der Vorschub-
hebel (2) die Rastklinke (5) aus der Stange (7) aus.
Die Bewegung des beweglichen Wagenteils wird durch die
Klinke (6) Abb. 17 b begrenzt.
Bei der Arbeit mit Klartext schiebt sich der bewegliche
Wagenteil nach Schreiben eines jeden Zeichens schritt-
weise vorwärts. Bei der Arbeit mit Geheimtext muß der
Text in Fünfergruppen geteilt werden. Zwischen den
Fünfergruppen muß ein Zwischenraum sein. Diese Forderung
wird durch ein System erfüllt, das in Abb. 18 darge-
stellt ist.
An dem beweglichen Wagenteil ist die Stange (9) befestigt.
Auf der Stange läuft der Hebel (8), der auf dem Gleit-
stück (10) des unbeweglichen Wagenteils drehbar gelagert
ist. Wird der Betriebsartenumschalter auf "C" gestellt,
so schiebt der Hebel (11) das Gleitstück (10) mit dem
Hebel (8) nach links.
In Abb. 18a ist die Stellung der Bauteile vor dem
Schreiben des 5. Zeichens einer der Fünfergruppen dar-
gestellt.
Nachdem der Vorschubhebel (2) des Hebels (1) die Rast-
klinke (6) aus der Stange (7) ausgerastet hat, müßte die
Bewegung des beweglichen Wagenteils durch.die Klinke (5)
und die Achse (3) begrenzt werden. Die Klinke (5) wird
jedoch durch die Nase der Stange (9) und den Hebel (8)
aus der Stange (7) Abb. 18b ausgerastet. Dadurch bewegt
sich der bewegliche Wagenteil zwei Schritte vorwärts und
wird durch die Rastklinke (6) gestoppt Abb. 18b.
Die 4 nächsten Zeichen werden geschrieben, wenn sich der
Hebel (8) in der Vertiefung der Stange (9) befindet,
d.h. der Wagen bewegt sich immer um einen Schritt
weiter. Nach Schreiben des 5. Zeichens schiebt sich der
bewegliche Wagenteil um 2 Schritte vorwärts usw.
Wird der Betriebsartenumschalter auf "K" oder "D" ge-
stellt, so wird das Gleitstück (10) mit dem Hebel (8)
durch den Hebel (11) nach rechts verschoben, und die
automatische Teilung des Textes in Fünfergruppen hört
auf. Damit sich der bewegliche Wagenteil durch Neigen
oder Stöße nicht nach rechts bewegt, besitzt er eine
Zahnstange (45) Abb. 16, in die die Sperrklinke (50)
einrastet.
Zum Einstellen des beweglichen Wagenteils auf einen be-
liebigen Punkt der Zeile von Hand aus ist es erforder-
lich, den Hebel des Wagenauslösebügels (48) nach vorn
zu ziehen.
Dabei werden die Rastklinken (39) und (40), die Sperr-
klinke (50) und der Hebel (47) durch den Wagenauslöse-
bügel (48) aus den Zahnstangen ausgehoben und der beweg-
liche Wagenteil kann in die erforderliche Stellung ge-
bracht werden.
Nach Schreiben des 59. Zeichens wird die Walze mit dem
Blatt automatisch auf die nächste Zeile gestellt. Der
bewegliche Wagenteil wird an den Anfang der neuen Zeile
gebracht. Dieses geschieht wie folgt :
Nach Schreiben des 59. Zeichens einer Zeile wirkt der be-
wegliche Wagenteil beim Verschieben auf das Steuerungs-
system, das sich am Antrieb befindet, ein.
Die Kupplung der Wagenrücklaufwelle rastet dadurch ein.
Der getriebene Kupplungsteil ist durch ein Schraubenzahn-
rad mit dem Zahnrad (4) Abb. 16 verbunden, das frei dreh-
bar in der Buchse des Selektionsdruckwerkes gelagert ist.
Die Trommel (6) mit der Spiralfeder, die. durch die Zapfen
(5) mit dem Rad (4) verbunden ist, dreht sich im Uhrzeiger-
sinn, wobei sie durch die Zahnräder (9), (10), (11) die
Zahnstange (29) nach rechts schiebt. Der mit der Stange
verbundene Sektor (27) bringt mit dem Hebel (30) und dem
Gleitstück (28) den Hebel (26) in die Stellung, in der die
Schaltklinke (22) in Eingriff mit dem Schaltrad (23) kommt.
Dieses ist mit der Walze (54) starr verbunden. Es bewegt
sich bis zum Auftreffen der Schaltklinke auf den An-
schlag (37). Dabei wird die Wagenwalze in die Stellung ge-
bracht, die zum Schreiben der nächsten Zeile erforderlich
ist. Die Nase des Hebels (25), der im Unterbau des beweg-
lichen Wagenteils angebracht ist, hält den Sektor (27)
in der von ihm eingenommenen Stellung fest. Gleichzeitig
führt der Hebel (26) bei seiner Bewegung den rechten Arm
des Hebels (35) nach unten. Der Letztere dreht mit seinem
2. Arm den Wagenauslösebügel (48). Dadurch werden alle
Hebel aus den Zahnstangen des Unterbaues ausgehoben, da-
runter auch der Hebel (50), der eine Längsbewegung des
beweglichen Wagenteils nach rechts verhindert. Nachdem
sich die Zahnstange (29) so weit nach rechts verschoben
hat, daß der Bolzen an der linken Seite des Langlochers
anstößt, wird der bewegliche Wagenteil mit nach rechts ge-
nommen.
Nach Beendigung des Wagenrücklaufs wird die Kupplung der
Welle für Wagenrücklauf durch den beweglichen Wagenteil
über ein Hebelsystem ausgerastet.
Gleichzeitig wird der Hebel (25), wenn er auf den An-
schlag (13) des Unterbaus trifft, aus dem Zahn des Sek-
tors (27) ausgeklinkt.
Durch Federkraft kehren der Hebel (26) und der Sektor (27)
in ihre Ausgangsstellung zurück, in der die Schaltklinke
(22) auf den Anschlag (21) zu liegen kommt und nicht in
das Schaltrad (23) eingreift.
Der Transmitter und Dekombinator
Transmitter und Dekombinator sind zum automatischen Ein-
tasten der Zeichen vorgesehen. Das Funktionsschema des
Transmitters und des Dekombinators ist in Abb. 19 dar-
gestellt.
Der Transmitter
Der Transmitter besitzt :
a) eine Hauptwelle mit einer Start-Stopp-Kupplung
b) eine Auslösevorrichtung, die ein einmaliges An-
laufen der Hauptwelle und ihr Anhalten gewähr-
leistet.
c) eine Abfühleinrichtung
d) eine Streifentransportvorrichtung
e) eine Sperrvorrichtung
Die Hauptwelle
Die Hauptwelle des Transmitters besitzt eine ähnliche
Start-Stopp-Kupplung, wie die Hauptwelle der Maschine.
Der treibende Teil der Kupplung wird von dem sich stän-
dig drehenden Teil der Hauptwelle der Maschine über die
Kardangabel (19) und zwei Zahnräder bewegt.
Die Stoppstellung der Hauptwelle wird durch den Nocken
(33), den Hebel (31) mit Rolle und Feder (33) fixiert.
Die Start-Stopp-Kupplung besitzt eine Sperrnase (36), in
die der Hebel (16) einrastet und eine Sperrnase an der
Stirnfläche des getriebenen Kupplungsteils (32), in die
der Hebel (20) einrastet.
Die Auslösevorrichtung
Die Auslösevorrichtung des Transmitters besteht aus 2
Stangen mit den Knöpfen (1) "EIN" und (2) "AUS", den
Gleitstücken (11), (13), dem Hebel (16) und dem Sperr-
bügel (3) mit der Feder (5).
Wird auf den Knopf "EIN" gedrückt, so verschiebt die
Stange das Gleitstück (11). Dieses dreht mit dem auf ihm
befindlichen Finger den Hebel (16). Dadurch wird die
Sperrnase (36) der Start-Stopp-Kupplung freigegeben und
die Umdrehung der Hauptwelle ist möglich.
Der Sperrbügel (3) wird durch, die Feder (5) in die rech-
te Kerbe der Stange (1) eingerastet. Dadurch wird sie in
dieser Stellung festgehalten und gewährleistet so eine
blockierungsfreie Arbeit der Hauptwelle.
Zum Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung und damit zum An-
halten der Hauptwelle muß der Knopf "AUS" gedrückt werden.
Dabei wird der Sperrbügel durch die Schräge der Kerbe
der Stange, die mit dem Knopf "AUS" verbunden ist, ange-
hoben und das Gleitstück (11) kehrt mit Stange (1) in
seine Ausgangsstellung zurück. Die Kupplung wird ausge-
rastet.
Das Anlaufen der Hauptwelle für einen Arbeitszyklus er-
folgt durch Drücken auf den Knopf "AUS".
Dabei führt das Gleitstück (13) und der mit ihm verbun-
dene Hebel (14) das Gleitstück (11) mit sich. Durch den
auf ihn befindlichen Finger wird der Hebel (16) ge-
schwenkt und die Sperrnase (36) freigegeben. Die Start-
Stopp-Kupplung rastet ein.
Am Ende der ersten Umdrehung der Hauptwelle wird der
Hebel (18), durch den Feststellhebel (31) nach oben ge-
schoben. Mit seinem rechten Arm rastet er den Hebel (14)
aus dem Gleitstück (11) aus, das unter Einwirkung seiner
Feder nach rechts geschoben wird. Der Hebel (16) legt sich
gegen die Sperrnase (36), wodurch die Kupplung ausgerastet
und die Hauptwelle angehalten wird.
Die Abfühlvorrichtung
Die Abfühlvorrichtung besteht aus den fünf Abfühlhebeln
(42), den 5 Ansatzstücken (43), dem Hebel (10), dem Nocken
(9) und den mit den Abfühlhebeln verbundenen Federn (51).
Nach dem Anlaufen der Hauptwelle wird der Hebel (10) durch
den Nocken (9) angehoben. Der rechte Arm des Hebels (10)
gibt die Abfühlhebel frei, die sich unter dem Einfluß der
Federn (51) heben. Wenn in dem in den Transmitter einge-
legten Streifen gegenüber einem Abfühlstift kein Loch vor-
handen ist, so hebt dieser sich bis er an den Streifen
stößt. Ist gegenüber einem Abfühlstift ein Loch vorhan-
den, so geht er hindurch und hebt die mit ihnen verbunde-
nen Ansatzstücke (43) mit an.
Nach einer gewissen Zeit, die durch das Zeitdiagramm der
Maschine angegeben wird, wer den alle Abfühlhebel durch
den Hebel (10) wieder in ihre Tiefstellung zurück ge-
bracht.
Die Streifentransportvorrichtung
In jedem Arbeitszyklus des Transmitters muß sich der
Lochstreifen um einen Schritt weiter bewegen.
Der Vorschub des Streifens erfolgt nach Abtasten der
Zeichenkombination durch die Abfühlstifte und deren
Rückkehr in die untere Stellung.
Der Streifentransport geht wie folgt vor sich :
Der Nocken (12) schwenkt den Hebel (15) mit der Schalt-
klinke (38). Diese greift in einen Zahn des Schaltrades
ein und dreht es weiter. Dadurch wird die Streifentrans-
porttrommel (40) ebenfalls, um einen Schritt weiter gedreht.
Die Stifte, die sich an der Streifentransporttrommel (40)
befinden, greifen in die Transportlöcher des Streifens
ein und bewegen diesen soweit vorwärts, bis die nächste
Zeichenkombination den Abfühlstiften der Abfühlhebeln
(42) gegenüberstehen. Die beiden Finger (37) begrenzen
die Bewegung der Schaltklinke (38) und verhindern eine
Bewegung auf Grund der Trägheit des Schaltrades
(39) und der Streifentransporttrommel (40).
Die Sperrvorrichtungen
Der Transmitter am Dekombinator besitzt Sperrvorrich-
tungen, die das Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung und
das Anhalten der Hauptwelle des Transmitters in drei
Fällen gewährleisten :
a) während des Zeilenvorschubs und Wagenrücklaufs
b) wenn die 32. Kombination (fünf mal minus) auf
dem Schlüssellochstreifen erscheint oder wenn
letzterer vom Transmitter am Chiffrator nicht
mehr weiter transportiert wird.
c) wenn die 32. Kombination auf dem in den Trans-
mitter am Dekombinator eingelegten Lochstreifen
erscheint.
Das Anhalten der Hauptwelle des Transmitters am Dekombi-
nator für die Zeit des Zeilenvorschubs und Wagenrück-
laufs erfolgt durch den Nocken (23), die Hebel (20),
(21), (22), (28), den Ansatz (29) und die Zugstange
(34).
Bei Weiterschaltung des Wagens vom ersten bis 57. Schritt
einschließlich nimmt die Sperrvorrichtung die in Abb. 19
angeführte Stellung ein.
Die Zugstange (34) ist nach rechts geführt, und das An-
satzstück (29) gelangt nicht unter die Einwirkung des He-
bels (28). Der Hebel (22) ist durch den Arm (25) des
Hebels (21) blockiert. Der Hebel (20) kann nicht in die
Sperrnase der Start-Stopp-Kupplung eingreifen.
Nach Vollendung des 58. Schrittes durch den Wagen wird die
Zugstange (34) vom Wagen über Zwischenelemente nach links
geschoben. Das Ansatzstück (29) befindet sich dann mit
einer Nase an der rechten Seite unter den Hebel (28).
Im 59. Zyklus des Transmitters drückt der Nocken (23)
über den Hebel (28), das Ansatzstück (29) und die Stange
(26) auf den unteren Arm des Hebels (21). Der. obere Arm
(25) des Hebels (21) gibt die Achse frei. Unter dem Ein-
fluß der Feder (27) dreht sich die Achse mit den Hebeln
(20), (22) und (24). Der Hebel (20) greift in die Sperr-
nase des Hebels (36) ein und rastet die Start-Stopp-
Kupplung aus. Am Ende des Wagenrücklaufs schiebt der Wagen
die Zugstange (34) nach rechts und schwenkt nach Über-
windung der Kraft der Feder (27) die Hebel (22), (24)
und (20). Der Hebel (21) dreht sich unter Einwirkung sei-
ner Feder und fällt in die Einkerbung des Hebels (24)
ein. Der Hebel (20) gibt die Sperrnase der Start-Stopp-
Kupplung frei.
Die Start-Stopp-Kupplung rastet ein und arbeitet blockie-
rungsfrei bis zum nächsten Wagenrücklauf.
Das Anhalten des Transmitters für die Zeit des Zeilenvor-
schubs und Wagenrücklaufs erfolgt dann, wenn die 59.
Kombination, die abgetastet wird, eine Zeichenkombination
und keine Steuerkombination ist, d.h. wenn es eine Kom-
bination ist, die vom Anlaufen der Hauptwelle der Ma-
schine begleitet ist. Z.B. kann beim Entschlüsseln der
59. Kombination eine Steuerkombination (Zwischenraum,
Wagenrücklauf, Zeilenvorschub) sein. In diesem Falle
läuft die Hauptwelle der Maschine nicht an.
Um ein vorzeitiges Anhalten auszuschließen, ist in das
Blockierungssystem des Transmitters beim Wagenrücklauf
eine Stange (26) einbezogen, die vom Auslösebügel der
Tastatur über die Stoßstangen (103), (102) Abb. 2 ar-
beitet.
Beim Anlaufen der Hauptwelle der Maschine gleitet die
Stange (26) Abb. 19 nach links und schiebt ihren Ansatz
unter den Hebel (29). Durch den Nocken (23) und die He-
bel (28), (29), (26), (21) und (20) wird der Transmitter
angehalten. Ist die 59. Schrittgruppe eine Steuergruppe,
so läuft die Hauptwelle der Maschine nicht an, der Ansatz
der Stange (26) befindet sich nicht unter dem Hebel (29).
Der Transmitter wird nicht gestoppt. Wenn eine Schritt-
gruppe in dem Schlüssellochstreifen, der in den Chiffra-
tor eingelegt ist, die 32. Kombination erscheint oder
der Streifen nicht mehr transportiert wird, wird der
Transmitter durch den Hebel (54) ausgeschaltet. Der He-
bel (54) ist mit der Stoßstange (52) verbunden. Sie wird
in einem solchen Falle nach links geschoben, und schwenkt
dadurch den Hebel (54). Der letztere hebt mit der abge-
schrägten Kante seines linken Armes den Sperrbügel (3)
an und löst ihn von der Knopfstange "EIN". Sie springt
nach rechts; die Start-Stopp-Kupplung des Transmitters
wird ausgerastet.
Das Blockieren des Transmitters bei der 32. Kombination
auf dem Lochstreifen erfolgt, wenn alle Wählschienen
(44) in Ausgangsstellung bleiben. Wird keine Wählschiene
verschoben, so fällt der Hebel (50) in die Aussparungen
der Wählschienen (44) ein und hebt mit seinem unteren
Arm den Bügel (3) aus der Knopfstange "EIN" aus.
Der Dekombinator
Der Dekombinator ist das ausführende Organ, das das An-
laufen der Hauptwelle der Maschine nach Drücken auf einen
bestimmten Tastenhebel je nach der Kombination im Loch-
streifen bewirkt.
Der Dekombinator ist als selbständiges Organ ausgeführt,
das sich auf dem Transmitter befindet.
Der Dekombinator besteht aus den 5 Wählschienen (44) Abb.
19 mit den Federn (48), den Hebeln (45) und dem Schlag-
bügel (47).
In Stoppstellung der Hauptwelle des Transmitters sind
alle Wählschienen (44) nach rechts verschoben. Zwischen
ihren linken Kanten und den Ansatzstücken (43) besteht
ein kleiner Spielraum. Die Hebel (45) werden durch den
unteren Teil des Schlagbügels (47) von den Kanten der
Wählschienen (44) entfernt. Nach Anlaufen der Hauptwelle
des Transmitters und Einstellung der Abfühlhebel (42)
und der Ansatzstücke (43) in Abhängigkeit von der Kombi-
nation im Streifen geht der Hebel (41), der die Linksbe-
wegung der Wählschienen (44) begrenzt, zurück und ermög-
licht den Wählschienen (44) sich unter der Wirkung der
Federn (48) in Richtung der Ansatzstücke (43) zu ver-
schieben.
Jede Wählschiene (44) hat ein Ansatzstück (43). Stehen die
Ansatzstücke unten, so verhindern sie die Linksbewegung
der Wählschienen (44).
Es bewegen sich nur die Schienen (44) hinter dem Hebel
(41) nach links, deren Ansatzstücke durch die Abfühlhebel
hochgezogen wurden.
In den Kanten der Wählschienen sind Aussparungen. Nachdem
sich der Hebel (41) nach links bewegt hat, nehmen je nach
der Kombination im Streifen die Wählschienen (44) eine
Stellung ein, wo einem der Hebel (45) die Aussparungen
aller 5 Schienen gegenüberliegen.
Nachdem die Schienen nach der Kombination im Streifen
eingestellt sind, tritt der Schlagbügel (47) in Aktion,
der durch den Hebel (46) vom Nocken (6) über die Zug-
stangen (4) und (49) gesteuert wird.
Der untere Arm des Bügels schwenkt nach rechts. Einer
der Hebel (45) kann unter Federeinwirkung in die in den
Wählschienen gemeinsam gebildeten Aussparung einfallen.
Bei der Weiterbewegung des Bügels schlägt dessen rechter
Arm auf den Ansatz des oberen Teils des Hebels (45), der
in die Aussparung eingefallen ist. Dabei wird ein bestimm-
ter Tastenhebel gedrückt. Die Hauptwelle der Maschine
läuft an.
Danach beginnt sich der Bügel (47) in entgegengesetzter
Richtung zu bewegen und führt den eingefallenen Hebel
wieder aus der Aussparung heraus. Die übrigen bringt er
in Ausgangsstellung. Zwischen den Hebeln (45) und den
Kanten der Wählschienen (44) ist etwas Spielraum. Am
Ende des Zyklus werden die Schienen (44) durch den Hebel
(41) in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht.
Der Locher
Der Locher hat die Aufgabe, den von Tastatur mit der
Hand oder automatisch eingegebenen Text im Fünfercode
des internationalen Telegraphenalphabetes Nr. 2 in einen
Streifen zu lochen.
Beim Verschlüsseln können die Kombinationen, die in den
Streifen gelocht werden, selbsttätig durch die Kombina-
tion "Zwischenraum" in Fünfergruppen jeweils nach 10
Fünfergruppen durch die Kombinationen "Wagenrücklauf" In
und "Zeilenvorschub" getrennt werden.
Dazu besitzt der Locher einen Zeichenzähler mit Zwischen-
raumgeber, der beim Verschlüsseln in die Arbeit mit ein-
bezogen werden kann. Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber
arbeitet im gleichen Zyklus wie der Locher und erfordert
keinen zusätzlichen Zeitaufwand. Bei der Arbeit mit Klar-
text und beim Durchlauf des Streifens wird der Zeichen-
zähler mit Zwischenraumgeber durch den Transportknopf
in Ausgangsstellung gebracht (für das erste Zeichen der
ersten Fünfergruppe der Zeile) und behält diese Stellung
In bis zum überegng zum Verschlüsseln bei.
Das Lochen der Steuerkombinationen "Zwischenraum", "Wa-
genrücklauf" und "Zeilenvorschub" erfolgt gleichzeitig
mit dem Lochen der fünften Textkombination einer Fünfer-
gruppe und je nach der Anzahl der gleichzeitig gelochten
Kombinationen erfolgt ein Streifentransport von 1, 2
oder 3 Schritten.
Beim Übergang zum Entschlüsseln schaltet sich der Locher
unabhängig von der Stellung des Arbeitsumschalters aus.
Zum Lochen findet Lochstreifenpapier mit einer Breite
von 17,5 mm Verwendung.
Eingabe und Lochen der Fünferschrittgruppen
Die Eingabe der Kombinationen in den Locher erfolgt durch
die Wählschienen des Kombinators des Selektionsdruckwerkes.
Die Wählschienen ändern bei ihrer Bewegung die Stellung
der Hebel (42) Abb. 20, deren vertikale Arme durch die
Zugstangen (41) und die Hebel (28) die Auflagestücke
(27) des Lochers steuern.
Der Locher besitzt 12 Lochstempel, die in drei Reihen an-
geordnet sind. (Abb. 20 - Schema für die Anordnung der
Auflagestücke).
In der ersten Reihe befinden sich 5 Stempel (18) zum
Lochen der Kombinationen und 1 Stempel (19) zum Lochen
der Transportlöcher.
In der zweiten Reihe liegen 3 Stempel zum Lochen der
Steuerkombinationen und 1 Stempel zum Lochen der Trans-
portlöcher.
In der dritten Reihe befindet sich 1 Stempel zum Lochen
einer Steuerkombination und 1 Stempel zum Lochen von
Transportlöchern.
Wir haben also im Locher insgesamt 9 Stempel zum Lochen
von Kombinationen und 3 Stempel zum Lochen von Transport-
löchern.
In Stoppstellung der Maschine befinden sich die 5 Auf-
lagestücke (27) unter dem Stanzbügel (31). Das dritte
Auflagestück von links liegt immer unter dem Stanzbügel
(31), über dem Stempel (19), der in jedem Zyklus die
Transportlöcher stanzt.
Der Zeichenzähler und Zwischenraumgeber
Die Schaltung des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber ist
in Abb. 21 dargestellt.
Der Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber ist zum Steuern
der Auflagestücke (29), (31) und (32) vorgesehen, die in
einer bestimmten Stellung über den Stempeln zum Lochen
der Steuergruppen angeordnet sind, sowie zum Steuern des
Bügels (18), mit dessen Hilfe der Vorschub des Streifens
um 1, 2 oder 3 Schritte erreicht wird.
Die Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber beim
Verschlüsseln
Beim Verschlüsseln werden die Elemente des Zeichenzählers
mit Zwischenraumgeber durch die Scheiben (21) und (23)
gesteuert, die auf der Achse (22) sitzen.
In Abb. 21 ist die Ausgangsstellung des Zeichenzählers
mit Zwischenraumgeber vor dem Verschlüsseln gezeigt.
In jedem Arbeitszyklus der Maschine vollführt der Nocken
(49) eine Umdrehung und der Hebel (48), der drehbar auf
dem Hebel (50) gelagert ist, vollzieht eine Vor- und
Rückwärtsbewegung, wobei er das Schaltrad (51) um eine
fünfzigstel Umdrehung verschiebt.
Die Schalträder (51) und (4) sind auf einer Buchse ange-
bracht, die sich auf der Achse (56) frei dreht.
Die Stellungen der Achse (56) werden durch den Hebel (7)
und die Scheibe (6) festgehalten, die mit der Achse (56)
starr verbunden ist.
An der Scheibe (6) befindet sich der Hebel (3), der auf
der Achse drehbar gelagert ist. Er greift in das Schalt-
rad (4) ein.
Die Umdrehung des Schaltrades (51) überträgt sich über das
Schaltrad (4), den Hebel (3) und die Scheibe (6) auf die
Achse (5b).
Die auf der Scheibe (56) angebrachte Scheibe (23) besitzt
9 Zähne, die jeweils unter einem Winkel von 36° angeordnet
sind. Der Winkel zwischen dem ersten und dem 9. Zahn be-
trägt 72°.
Die Scheibe (21) besitzt nur einen Zahn, der zwischen dem
9. und 1. Zahn der Scheibe (2) angeordnet ist.
In Ausgangsstellung des Zeichenzählers mit Zwischenraum-
geber liegen sich der Zahn auf der Scheibe (21) und der
Zahn auf dem Hebel (40) gegenüber.
Dabei bewegt sich der Bügel (33) mit den Auflagestücken
(29) entgegen dem Uhrzeigersinn und zwar durch die Span-
nung der Feder (40), die auf den Bügel (41) wirkt. Mit
einer Schraube drückt dieser auf den Arm des BÜgels
(27), der mit dem Bügel (33) verbunden ist.
Das linke Auflagestück (29) hat eine Nase, die bei
einer Bewegung das Auflagestück (31), das am Bügel (35)
befestigt ist, mitnimmt und nach links bewegt.
Die Ausgangsstellung der Auflagestücke (29), (31), (32) ist
in Abb. 20 Stellung 11 dargestellt.
Das Zusammentreffen des Zahnes am Hebel (20) mit den Zähnen
der Scheibe (23) erfolgt am Anfang des 5. Zyklus einer jeden
der ersten 9 Fünfergruppen des Geheimtextes. Beim Zusammen-
treffen des Zahnes am Hebel (20) mit den Zähnen der Scheibe
(23) geht der Bolzen (39) nach oben. Dadurch erhält der Bügel
(38) die Möglichkeit, sich zu drehen. Er drückt auf den Bügel
(34) mit dem Auflagestück (32). Dieser bewegt sich entgegen
dem Uhrzeigersinn. Bei seiner Bewegung zieht der Bügel (34)
mit einer Schraube den Bügel mit dem Auflagestück (31) mit.
Dabei erhalten die Auflagestücke eine Stellung, die ein Lochen
der Schrittgruppe (Zwischenraum)(Abb. 20 Stellung III) ermöglichen.
Der nach unten geführte linke Hebelarm (20) bringt über den
Hebel (17) den Bügel (18) in eine Stellung, bei der nach dem
Lochen der Schrittgruppe "Zwischenraum" ein Streifenvorschub
von 2 Schritten erfolgt. Wenn der Zahn des Hebels (20) zwischen
den Zähnen der Scheibe (2) liegt, werden die Bügel (38),
(34) und (35) durch Federspannung vom Stanzbügel weggeführt
(Abb. 20 Stellung I).
Vor dem Lochen der Schrittgruppe, die dem 5. Zeichen in der 10.
Fünfergruppe des Geheimtextes entspricht, werden der Zahn der
Scheibe (21) und der Zahn des Hebels (46) einander gegenüber-
gestellt. Das Auflagestück wird in die oben beschriebene Stel-
lung gebracht,in der auf dem Streifen gleichzeitig mit dem Lochen
der Kombination, die dem getasteten Zeichen entspricht, die
Kombinationen "Wagenrücklauf" und "Zeilenvorschub" (Stellung
IV Abb. 20) gelocht werden. Dabei bringt der linke Arm des
Hebels (46) über den Hebel (17) den Bügel (18) in eine Stellung,
in der im Arbeitszyklus ein Streifenvorschub von 3 Schritten
erfolgt.
Die Stellung des Bügels (18) verändert sich unter der Einwir-
kung der Hebel (19), (20), (46), die die Anzahl der Schritte
in jedem Arbeitszyklus angeben.
Wenn die Rolle der Hebel (45) auf dem kleinen Radius des Nocken
(44) sitzt, ist die Streifenvorschubklinke (16) in ihrer oberen
stellung. Sie liegt mit ihrer Nase auf dem Bügel (18).
Der Bügel (18), der durch den Hebel (17) eingestellt
wird, läßt die Klinke (16) bei Vollführung ihres Arbeits-
ganges in den ersten, zweiten oder dritten Zahn am Schalt-
rad (15) (von der Sperrstellung ausgerechnet) einfallen
und die Achse (14) in dem entsprechenden Winkel drehen.
Beim Verschlüsseln drückt der Hebel (11), der mit dem
Bügel (54) starr verbunden ist, auf den Anschlag (12).
Dieser geht zurück und der Schaltbügel (13) kann ohne Be-
hinderung zurückgehen.
Das Abschalten des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber
erfolgt beim Umstellen des Betriebsartenumschalters auf
"K" und "D". Dabei schwenkt der Hebel (55) den Bügel (54)
im Uhrzeigersinn. Sein unterer Arm stellt sich über den
Zwischenhebel (1). Der Hebel (5) kann sich nicht mehr im
Uhrzeigersinn drehen. Er stellt sich dem unteren Teil
des Hebels (3) in den Weg, der beim Auftreffen auf den
Hebel (5) aus dem Schaltrad (4) ausrastet. Die Mitnehmer-
scheibe (6) bleibt in ihrer festen Lage, die der Aus-
gangslage vor der Verschlüsselung entspricht. Der Hebel
(11), der mit dem Bügel (54) verbunden ist, gibt dem
Anschlag (12) die Möglichkeit, sich als Stützfläche
unter den Bügel (13) zu stellen und den Leer-und Ar-
beitslauf der Schaltklinke (16) zu begrenzen, indem er
im Arbeitszyklus nur einen Streifenvorschub von einem
Schritt zulässt. Der rechte Arm des Bügels (54) schwenkt
die Bügel (38) und (41) im Uhrzeigersinn. Durch die Span-
nung der Federn verschieben sich die Bügel mit den Auf-
lagestücken (29), (31), (32) in der Gleichen Richtung.
Die Einstellung der Auflagestücke für diesen Fall ist
in Abb. 20 Stellung I dargestellt.
Die Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber,
wenn der Betriebsartenumschalter auf "K" steht.
Wenn die Maschine mit Klartext arbeitet, sprechen nur
einige Teile des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber an,
wenn auf die Taste für Wagenrücklauf gedrückt wird.
In diesem Falle müssen in den Streifen die Kombinationen
Wagenrücklauf und Zeilenvorschub gelocht werden. Das
Drücken auf die Taste für Wagenrücklauf ist vom Anlaufen
der Hauptwelle begleitet. Die Wicklung des Elektromagneten
erhält einen Stromimpuls. Die Stange (25) bringt bei An-
sprechen des Magneten den Hebel (24) außer Eingriff mit
dem Bügel (26).
Der Bügel (26) dreht sich unter Einwirkung der Spannung
der Feder (28) entgegen dem Uhrzeigersinn. Er nimmt mit
seinem Bolzen (30) den Bügel (33) mit dem Auflagestück
(29) und das Auflagestück (31) mit dem Bügel (35) mit.
Die Auflagestücke werden zum Lochen der Schrittgruppen
"Wagenrücklauf" und "Zeilenvorschub" nach links gescho-
ben. (Abb. 20 Stellung V).
Der Bügel (27) bringt mit seinem Arm (19) den Bügel (18)
in eine Stellung, in der der Lochstreifen um 2 Schritte
vorwärts gerückt wird.
Am Ende eines Arbeitszyklus der Maschine rastet der He-
bel (37), der auf dem Nocken (36) läuft, den Bügel (26)
in den Hebel (24) ein. Der Bügel (33) mit den Auflage-
stücken (29) kehrt unter Federspannung in seine Ausgangs-
stellung zurück.
Automatikantrieb
Die Funktionsschaltung für den Automatikantrieb ist in
Abb. 22 dargestellt. Die Automatikgetriebewelle (32)
ist mit der Kardangabel (36) und der Kardanwelle mit dem
sich ständig drehenden Teil der Hauptwelle der Maschine
verbunden. Die ständige Umdrehung wird auf folgende Bau-
teile der Maschine übertragen :
a) über das Zahnrad (34) auf den treibenden Teil (31)
der Start-Stopp-Kupplung des Lochers
b) über die Zahnräder (26), die Welle (19), die Zahn-
räder (16) und die Kardangabel (15) auf den trei-
benden Teil der Start-Stopp-Kupplung des Transmitters
am Dekombinator.
Zum Automatikantrieb gehören Bauteile, die folgende
Funktionen zu erfüllen haben :
a) Steuern der Start-Stopp-Kupplung (31) des Lochers
b) Einschalten des Lochers für Dauerauslösung des
Streifentransportes
c) Einschalten des Lochers für einen Zyklus zum
Stanzen der 32. Kombination
Steuerung der Start-Stopp-Kupplung des Lochers
Der Locher arbeitet, wenn der Arbeitsumschalter auf "L"
oder "LB" bei Klartext oder bei Chiffrieren steht.
In diesen Fällen wird die Start-Stopp-Kupplung des Lochers
durch den Nocken (41) gesteuert, der sich auf der Haupt-
welle der Maschine befindet. Zu Beginn eines Zyklus wird
die Rolle (42) des Hebels (4)) durch den Nocken (41) nach
rechts geführt. Der untere Arm des Hebels (43) der auf die
Kupplungsnase (45) drückt, schiebt diese nach unten und
dreht die Welle (47) um einen bestimmten Winkel im Uhr-
zeigersinn. Dadurch wird der Hebel (40) mit der Achse (39)
und dem Hebel (38) gedreht. Der Hebel (38) rastet aus
der Sperrnase des getriebenen Teils der Start-Stopp-
Kupplung des Lochers aus.
Beim Einrasten der Start-Stopp-Kupplung überträgt sich
die Drehbewegung auf die Welle (29) und über die Zahn-
räder (37), (35) auf die Nockenwelle (33), des Selektions-
druckwerkes.
Am Ende der Umdrehung wird der getriebene Teil der Start-
Stopp-Kupplung durch den Hebel (38) ausgerastet und die
Stellung der Welle (29) durch den Nocken (27) und den He-
bel mit der Feder (22) fixiert.
Wenn der Betriebsartenumschalter auf "D" steht, wird der
getriebene Teil der Start-Stopp-Kupplung des Lochers
durch den Hebel (30) gesperrt, der auf dem Nocken (11)
der Welle, die mit dem Knopf des Betriebsartenumschalters
mechanisch verbunden ist, läuft.
Steht der Arbeitsumschalter auf "B" so wird der Locher
durch den Hebel (48) gesperrt, dessen unterer Arm unter
der Federspannung (49) in die Vertiefung des Nocken (50)
geführt wird. Der Nocken (50) befindet sich auf der Welle
des Arbeitsumschalters. Die Nase der Kupplung (45) wird
vom unteren Hebelarm (43), der die Start-Stopp-Kupplung
einrastet, zurückgeführt.
Einschalten des Lochers für Dauerauslösung des Streifen-
transports
Der Lochstreifen, in den die Fünfergruppen gestanzt werden,
muß ein Anfangsstück mit einigen eingelochten Schritt-
gruppen "Zwischenraum" besitzen.
Zu diesem Zweck wird der Locher von Hand aus, durch Drücken
des Knopfes (14) Abb. 22, der sich an der linken Wand der
Grundplatte befindet, für die Dauerauslösung des Streifen-
transports eingeschaltet. Dabei schiebt der mit dem Knopf
(14) verbundene Hebel (1)) das Gleitstück (2) nach rechts.
Das Messer (52), das aus Isolierstoff besteht, schließt
den Kontakt (1), der im Stromkreis der Wicklung des Elektro-
magneten für "Zwischenraum" liegt. Dieser spricht an. Der
Freigabehebel fällt in die Aussparungen der Wählschienen
des Kombinators des Selektionsdruckwerkes ein. Der Locher
wird zum Lochen der Schrittgruppe "Zwischenraum" vorbe-
reitet.
Der mit dem Gleitstück (2) verbundene Bolzen rastet den
Hebel (38) aus der Sperrnase des getriebenen Teils der
Start-Stopp-Kupplung (31) aus. Die Kupplung rastet so
lange ein, bis der Knopf (14) in seine Ausgangsstellung
zurückkehrt.
In den Streifen wird in jedem Arbeitszyklus die Schritt-
gruppe "Zwischenraum" gelocht. Am Anfang eines jeden Zyk-
lus des Lochers geht der Hebel (25) auf den kleinen Ha-
dius des Nocken (28) über. Der Hebel (51) greift mit
seiner Nase am unteren Hebelarm in das Gleitstück (2)
ein und bleibt in dieser Stellung bis zum Ende eines je-
den Zyklus.
Wenn am Ende der letzten Umdrehung der Locherwelle der
Druck auf den Knopf (14) aufhört, wird der Hebel (51)
durch den Nocken (28) beim Gleitstück (2) ausgerastet.
Dabei verschiebt sich das Gleitstück (2), da es unter
Federspannung steht, nach links und die Kontaktfedern (1)
öffnen sich. Der getriebene Teil der Start-Stopp-Kupp-
lung (31) kommt durch den Hebel (38) in Sperrstellung.
Die Hebel (25) und (51) und der Nocken (28) wurden deshalb
mit in das System einbezogen, weil es notwendig ist, den
Kontakt (1) und den getriebenen Teil der Start-Stopp-
Kupplung gleichzeitig auszuschalten, da ein vorzeitiges
Öffnen des Kontaktes (1) dazu führen kann, daß auf dem
Lochstreifen statt der Schrittgruppe "Zwischenraum"
ein Transportloch gestanzt wird.
Bei Dauerauslösung des Lochers zu dem oben genannten Zweck
wird der Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber des Lochers
durch die Hebel (4) und (23), die auf den Bügel (24) des
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber wirken, abgeschal-
tet.
Einschalten des Lochers für einen Zyklus
Das Einschalten des Lochers für einen Zyklus erfolgt zum
Zwecke des Streifenvorschubs um einen Schritt, wobei nur
Transportlöcher gestanzt werden.
Der Locher wird in diesem Falle durch den Hebel (18) ge-
steuert. der auf der linken Seite der Grundplatte ange-
bracht ist. Die Hebel (18) und (7) sind mit der Welle
(8) starr verbunden. Auf dem Hebel (7) ist der zweiarmige
Hebel (10) drehbar gelagert. Er greift in den Hebel (17)
ein. Die Hebel (17) und (5) sind durch eine gemeinsame
Welle fest verbunden.
Wenn der Hebel (18) entgegen dem Uhrzeigersinn zum An-
schlag gebracht wird, schiebt der obere Arm des Hebels (5)
die ihn berührenden unteren Hebelarme der Hebel (4) und
(38) nach rechts.
Der Hebel (4) löst den Zeichenzähler mit Zwischenraum-
geber aus. Der Hebel (38) rastet die Start-Stopp-Kupp-
lung (31) des Lochers ein. Zu Beginn des Zyklus geht die
Hebelrolle, die auf dem Nocken (27) läuft, auf dessen
größeren Radius über. Der untere Hebelarm drückt auf den
Hebel (9). Dieser drückt seinerseits auf den Arm des
Hebels (10). Durch die Spannung der Feder (12) dreht sich
der Hebel (17). Mit ihm dreht sich der Hebel (5). Die Hebel
(4), (38) gehen bis zum Anschlag nach links.
Sie kehren in ihre Ausgangsstellung zurück, in der der
Hebel (38) in die Sperrnase des getriebenen Teils der
Start-Stopp-Kupplung (31) eingreift, und diese am Ende
des Zyklus ausrastet. Wird der Hebel (18) in Ausgangs-
stellung gebracht, rasten die Hebel (10) und (17) wieder
ein. Das System ist zum weiteren Anlaufen des Lochers für
einen Zyklus bereit.
Die Start-Stopp-Kupplung des Lochers
Der Aufbau der Start-Stopp-Kupplung des Lochers ist in
Abb. 23 und 24 dargestellt.
Auf der Welle (1) ist der Nocken (2) verstiftet, auf
dessen Nabe die getriebene Scheibe (6) mit der Rolle (7)
angebracht ist. Die Rolle (7) wird auf dem Nocken (2)
durch 2 Bolzen gehalten, die auf der getriebenen Scheibe
(6) angebracht sind. Die Mitnehmerschale (5) wird von dem
Teil der Hauptwelle der Maschine bewegt, der nicht zum
Start-Stopp-Teil gehört.
In ausgerasteter Stellung der Kupplung führt die getrie-
bene Scheibe (6), die an der Nase (8) gehalten wird, die
Rolle (7) in die Mitte des Nockes (2). Zwischen der Rolle
(7) und der Schale (5) bildet sich ein Zwischenraum, der
es der Schale {5) ermöglicht, sich frei zu bewegen und
der Welle (1) Ruhestellung einzunehmen.
Beim Lösen der Scheibe (6) dreht sich diese unter der
Federspannung (10) entgegen dem Uhrzeigersinn und ermög-
licht der Rolle (7) sich zwischen die Schale (5) und den
Nocken (2) zu keilen, worauf sich die Welle (1) mit der
Geschwindigkeit der Schale (5) zu drehen beginnt.
Zum Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung und zum Anhalten
der Welle (1) muss die Scheibe (6) an einer der beiden
Nasen festgehalten werden.
Durch das Anhalten der Scheibe (6) verschiebt sich die
Rolle (7), der Nocken (2) wird gelöst und die Welle (1)
bleibt stehen. Die Kugel (4) mit der Feder (3) dient da-
zu, ein überholen des treibenden Teils der Kupplung durch
die Bauteile des getriebenen Teils zu verhindern.
Der Chiffrator
Der Chiffrator dient zur Umwandlung des Klartextes in ver-
schlüsselten Text, wenn der Betriebsartenumschalter auf
"C" gestellt ist und des verschlüsselten Textes in Klar-
text, wenn der Betriebsartenumschalter auf "D" steht.
Die Umwandlung der Zeichen des Klartextes in Geheimtext er-
folgt, indem jedes Zeichen des Klartextes mit Zeichen
überschlüsselt wird, die als Kombinationen in einen
Schlüssellochstreifen gelocht sind.
Bei Einstellung des Betriebsartenumschalters auf "K" wer-
den die mechanischen und elektrischen Bauteile des
Chiffrators abgeschaltet.
Die Außenansicht des Chiffrators ist in Abb. 28 dar-
gestellt. Der Chiffrator besteht aus folgenden Teilen :
a) dem Antrieb (4)
b) den Kontaktleisten KL (1)
c) dem Transmitter (6)
d) dem Betriebsartenumschalter (3)
e) dem Gruppenzähler (5)
Die Teile des Chiffrators sind auf einer Gußplatte be-
festigt.
Der Antrieb
Der Antrieb Abb. 29 dient zum übertragen der Umdrehung
von der Hauptwelle der Maschine auf die Hauptwolle des
Transmitters am Chiffrator. Die Drehung der Hauptwelle
des Chiffrators in beiden Richtungen mit der Hand mit
Hilfe einer besonderen abnehmbaren Kurbel (1) wird eben-
falls durch den Antrieb übertragen. Der Antrieb stellt
einen selbständigen Teil dar, der auf einer Gußplatte
montiert ist und an der Grundplatte des Chiffrators
durch 4 Schrauben befestigt wird. Die Hohlwelle (16) des
Getriebes besitzt 2 Lager. Das Zahnrad (23) dreht sich
frei auf der Hohlwelle (16) und befindet sich im stän-
digen Eingriff mit dem Zahnrad (22) der Hauptwelle der
Maschine.
Das Zahnrad (49) hat die Möglichkeit, sich axial auf der
Hohlwelle (16) zu bewegen und mit seiner Buchse in die
Buchse (21) des Zahnrades (23) einzugreifen. Die Haupt-
welle des Chiffrators wird durch das Zahnrad (19) in Um-
drehung versetzt. Wird der Betriebsartenumschalter auf
"C" oder "n" gestellt, so geht der untere Arm des Hebels
(6) auf den kleinen Radius des Nockens (7) über. Der rech-
te Arm des Hebels (6) neigt sich nach rechts, wobei sich
die Stange (9), die unter Spannung der Feder (11) steht,
sich in der gleichen Richtung verschiebt.
Das Zahnrad (19) verschiebt sich unter Wirkung der Feder,
die auf der Hohlwelle (16) zwischen der Buchse (17) und
dem Zahnkranz des Rades (19) angebracht ist, nach rechts
bis zum Eingriff mit der Buchse (21) des Zahnrades (23).
In diesem Falle wird die Umdrehung der Hauptwelle der
Maschine auf die Hauptwelle des Chiffrators übertragen.
Wenn der Betriebsartenumschalter auf "K" gestellt wird,
wird der untere Arm des Hebels (6) durch den Nocken (7)
nach rechts Geführt. Der obere Arm rastet mit der Stange
(9) die Buchsen (19) und (21) aus. In diesem Falle
überträgt sich die Umdrehung der Hauptwelle der Maschine
nicht auf die Hauptwelle des Chiffrators.
Zur Maschine gehört die Kurbel (1), mit deren Hilfe die
Hauptwelle des Chiffrators in beiden Richtungen von Hand
aus gedreht werden kann. Dazu wird die Stange der Kurbel
soweit in die Öffnung der Hohlwelle (16) geschoben, bis
das Stangenende am Stift (20) anschlägt, der mit der
Buchse des Zahnrades (19) fest verbunden ist.
In der Hohlwelle (16) befindet sich ein Zapfenloch, durch
welches der Stift (20) ragt.
Wenn die Stange der Kurbel (1) auf den Stift (20) drückt,
wird die Buchse (19) aus der Buchse (21) des Zahnrades (23)
ausgerastet. Dabei gelangt der Bolzen (25) des Mitnehmers
(24) in die Nut der Kurbel.
Wird bei dieser Stellung der Bauteile die Kurbel (1) ge-
dreht, so dreht sich mit der Welle (16) die starr mit die-
ser verbundene Buchse (17). Die Buchse (17) besitzt 2
Finger, die in die Öffnungen des Zahnrades (19) eingreifen.
Dieses überträgt die Drehung auf die Hauptwelle des Chiff-
rators.
Die Benutzung der Kurbel ist nur beim Dechiffrieren mö-
lich und ist beim Chiffrieren ausgeschlossen. Im letzten
Falle, wenn der Betriebsartenumschalter auf "C" steht,
führt der Nocken (15) den unteren Arm des Hebels (13)
zurück. Der obere Arm des Hebels (13) kommt gegenüber dem
Zahnkranz der Buchse (19) zu liegen. Dadurch wird verhin-
dert, daß die Buchse (19) aus der Buchse (21) ausgerastet
wird.
Nach Gebrauch der Kurbel müssen die Buchsen (19) und (21)
eingerastet werden.
In den Antrieb sind Bauteile eingebaut, die kontrollieren
ob die Buchsen (19) und (21) bei "K", "D" und "C" des Be-
triebsartenumschalters richtig gekuppelt sind. Sie verhin-
dern, daß das Druckwerk der Maschine im Falle einer Stö-
rung der normalen Tätigkeit des Antriebes arbeitet.
Steht der Betriebsartenumschalter auf "K", so öffnet der
untere Arm des Hebels (5) mit seinem Stift (4) das obere
Federpaar des Kupplungskontaktes (2) und der untere Hebel-
arm (8) schließt mit seinem Finger (3) das untere Kontakt-
paar.
Steht der Betriebsartenumschalter auf "C" oder "D", so
sind die unteren Hebelarme (5) und (8) nach unten gestellt,
wodurch das obere Kontaktpaar geschlossen und das untere
geöffnet ist.
Sind infolge Benutzung der Kurbel oder aus anderen
Gründen die Buchsen (19) und (21) nicht eingeklinkt,
so sind alle Federn der Kupplungskontaktes (2) geöff-
net und die Hauptteile des Druckwerkes stromlos.
Die Kontaktleisten KL
Die Kontaktleisten KL schalten in jedem Arbeitszyklus
die Stromkreise des Druckwerkes der Maschine entsprechend
den Kombinationen des Schlüssellochstreifens um. Die kon-
struktive Ausführung der Kontaktleisten "KL" ist in Abb. 36
dargestellt.
Die Kontaktleisten sind auf einer Metallplatte (2) ange-
bracht, die an der rechten Wand der Grundplatte des Chiff-
rators befestigt ist, sowie auf dem Deckel (5). Die Platte
(2) und der Deckel (5) sind im unteren Teil durch das
Scharnier (4) verbunden und im oberen Teil durch das
Schloß (1) befestigt.
Auf der Platte (2) sind 2 Leisten (8) und 2 Leisten (6)
angebracht, die aus Kunststoff mit eingepreßten Kontakten
bestehen. Die Leisten (8) sind mit der Platte (2) starr
verbunden, und die Leisten (6), die auf den Prismen (10)
mit Kugeln (7) liegen, können sich in bestimmten Grenzen
entlang der Prismen bewegen.
Im Deckel (5) befinden sich auf den Kugelprismen (10)
drei Leisten (9), die ebenfalls verschiebbar sind.
In den Leisten (9) befinden sich die Kontakte (11) mit
Federn, die den erforderlichen Kontaktdruck hervorrufen.
Jede Leiste besitzt eine Gabel (3), durch die sie mit dem
Bauteil des Transmitters verbunden ist, das das Verschie-
ben der Leiste bewirkt.
In jedem Arbeitszyklus verändern die Leisten KL ihre
Stellung. Sie nehmen entweder die obere oder die untere
Stellung ein.
Der Transmitter
Der Transmitter beinhaltet 2 Systeme :
a) das System der Bauteile, die in jedem Zyklus ar-
beiten
b) das System der Bauteile, die nur arbeiten, wenn
der Betriebsartenumschalter von einer Stellung
in die andere gestellt wird.
Das System der Bauteile, die in jedem Zyklus des Trans-
mitters arbeiten, hat folgende Funktionen :
a) es verstellt jede der 5 Schienen der Kontakt-
leisten KL je nach der Kombination des Schlüssel-
lochstreifens in seine obere oder untere Stellung.
b) es sperrt die Tastenhebel und verhindert, daß der
Transmitter des Dekombinators nach Ende des
Schlüssellochstreifens anspricht.
c) es macht unmöglich, daß nur mit einer Kombina-
tion überschlüsselt wird, wenn der Schlüssel-
lochstreifen aus verschiedenen Gründen nicht
transportiert wird.
Das System der Bauteile, die beim Umschalten des Betriebs-
artenumschalters arbeiten, hat folgende Funktionen:
a) es macht unmöglich, das dem Nachrichtensachbe-
arbeiter bei der Benutzung des Schlüsselloch-
streifens Fehler unterlaufen.
b) es läßt beim Umschalten des Betriebsartenumschal-
ters von "K" auf "D" die Hauptwelle der Maschine
für einen Arbeitszyklus anlaufen. Dabei werden
gleichzeitig der Gruppenzähler und die Weiter-
schaltung des Wagens gesperrt.
Die konstruktive Ausführung des Transmitters
Die Bauteile des Transmitters sind im wesentlichen zwi-
schen zwei vertikalen Platten angebracht Abb. 31 und 30.
Auf der oberen Platte (4) Abb. 31 befindet sich eine
Streifenführung, in die der Schlüsselstreifen eingelegt
wird. An der Außenseite der hinteren Platte Abb. 31
liegt die Hauptwelle (1) des Transmitters, die die Nocken-
welle (3) über die Zwischenwelle (2) bewegt.
Auf dem Winkel (8) befindet sich der Gruppenzähler (7}.
Die Zahnräder (6), (9), (10) übertragen die Bewegung von
der Hauptwelle (1) auf die Streifentransportwelle. An der
vorderen Platte (12) Abb. 30 ist die Rastklinke (8) der
Streifentransportwelle mit dem Rastrad (7) angebracht, so-
wie das Zwischenrad (3) zum übertragen der Bewegung von
der Zwischenwelle (1) des Betriebsartenumschalters mit
dem Zahnrad (2) auf die Nockenwelle (4) der Kontroll-
und Sicherungseinrichtung und Stütze (10) mit dem Lager
der Nockenwelle (9).
Das Verstellungssystem der Kontaktleisten "KL" entsprechend
den Schlüsselkombinationen
Der Schlüssellochstreifen kann nur in die Streifenführung
des Transmitters eingelegt werden, wenn der Betriebsarten-
umschalter auf "K" steht und der Deckel der Streifenfüh-
rung geöffnet ist. Beim Einstellen des Betriebsartenumschal-
ters auf "K" bringen die Zahnstange (20) Abb. 32 und das
Zahnrad (21) die Welle (12) in die Stellung, die in Abb. 32
dargestellt ist. Dabei befindet sich der Hebel (10) auf
dem maximalen Radius des Nockens (11) und der Bügel (2),
auf dem die Gabeln (1) liegen, schiebt die Leisten (45)
und (46) in ihre obere Stellung.
Nachdem der Betriebsartenumschalter auf "D" oder "C" ge-
stellt wird, liegt der Hebel (10) auf dem kleinen Radius
des Nockens (11). Der Bügel (2) befindet sich in der un-
teren Stellung, wobei er der Bewegung der Leisten (45)
und (46) nicht hinderlich ist.
Am Anfang eines Arbeitszyklus des Transmitters fällt die
Rolle des Hebels (42) in die Vertiefung des Nockens (47)
ein, die Abfühlhebel (9) können sich unter der Spannung
der Feder (34) heben. Liegt einem der Abfühlhebel auf dem
Streifen ein Loch gegenüber, so hebt er sich nach oben.
Die übrigen verschieben sich nur so weit, bis sie den
Streifen berühren. Die nach oben vorgestoßenen Abfühlhebel
schwenken die Hebel (8), deren untere Arme aus den Ein-
stellstücken (6) ausklinken.
Danach läßt der Hebel (43), der vom Nocken (44) gesteu-
ert wird, die ausgeklinkten Einstellstücke (6) unter dem
Druck der Feder (7) nach oben gehen. Die Stellung der
Einstellstücke wird durch den Hebel (50) verriegelt, der
vom Nocken (49) gesteuert wird.
Der Nocken (41) steuert über den Zwischenhebel (36) den
Bügel (35) mit den darauf befindlichen 5 dreiarmigen He-
beln (5), die den Einstellstücken (6) gegenüberliegen.
An den rechten Armen der Hebel (5) sind Rollen angebracht,
die in die Gabeln (1 ) eingreifen. Die Gabeln sind auf den
Leisten (45) und (46) befestigt. Die Einstellstücke (6)
haben 2 Nasen. Je nach der Stellung des Einstellstückes
stößt der untere bzw. obere Hebelarm der Hebel (5) an die
untere bzw. obere Nase.
Nachdem die Einstellstücke (6) ihre Stellung entsprechend
der Bewegung der Abfühlhebel (9) eingenommen haben,
schwenkt die Achse (4) mit den Hebeln (5) nach links.
Jeder Hebel (5) dreht sich, wenn er auf die obere oder
untere Nase des Einstellstückes stößt, auf der Achse (4)
und schiebt mit der Rolle (3) die Gabel (1) mit der Lei-
ste nach oben oder unten.
Wenn in einem Arbeitszyklus des Transmitters einem Abfühl-
hebel (9) ein Loch auf dem Streifen gegenübersteht, wird
die dazugehörige Leiste nach oben geführt, wenn sie sich
im vorangegangenen Zyklus unten befand.
Haben die Leisten die Stellung eingenommen, die durch die
Abfühlhebel (9) bestimmt wird, so werden die letzteren
durch den Hebel (42) in ihre Ausgangsstellung zurück-
gebracht. Der Schlüssellochstreifen wird durch die Strei-
fentransporttrommel (33), die auf der Welle (31) sitzt,
um einen Schritt vorwärts transportiert. Der Bügel (35)
mit den dreiarmigen Hebeln (5) nimmt danach seine Aus-
gansstellung ein. Der Hebel (50), der vom Nocken (49)
gesteuert wird, entriegelt die Einstellstücke (6). Die
Einstellstücke, die sich in der oberen Stellung befanden
werden durch den Nocken (44) und den Bügel (43) in ihre
Ausgangsstellung zurückgebracht. Im folgenden Arbeits-
zyklus des Transmitters wiederholt sich die oben beschrie-
bene Arbeitsweise der Bauteile.
Sperrung der Tastenhebel und Anhalten des Transmitters am
Dekombinator bei Ende des Schlüssellochstreifens
Bei Ende des Schlüssellochstreifens muß der Transmitter
am Chiffrator die Möglichkeit ausschließen, Zeichen mit
der Hand zu tasten und die Arbeit des Transmitters am
Dekombinator fortzusetzen, wenn die Arbeit automatisch
erfolgt. Dieser Forderung wird in folgender Weise Rechnung
getragen: Abb. 33
Zu Beginn des Zyklus ermöglicht der Hebel (3), der vom
Nocken (20) besteuert wird, den Abfühlhebeln (2) sich
unter Spannung der Feder (1) zum Abtasten der Kombinatio-
nen auf dem Streifen zu heben. Sind auf dem Streifen
Löcher der Schlüsselkombinationen vorhanden, so heben sich
die Abfühlhebel soweit nach oben, wie es der Hebel (3) ge-
stattet. Bei der Aufwärtsbewegung heben die Abfühlhebel
(2) den linken Arm des Hebels (39) an. Der rechte Hebel-
arm senkt sich und verhindert die Bewegung der Schiene
(28). In dem Augenblick, wo die Abfühlhebel (2) ihre obere
Stellung erreicht haben, wird die Schiene (28) vom Hebel
(24) der durch den Nocken (34) gesteuert wird, freigegeben.
Die freigegebene Schiene (28) kann sich nach rechts be-
wegen und legt sich mit ihrem Ansatz auf das rechte Ende
des Hebels (39), nachdem sie ihn an den Anschlag (27)
gedrückt hat.
Am Ende des Arbeitszyklus des Transmitters bringt der
Nocken (34) mit Hilfe des Hebels (24) die Schiene (28) in
ihre Ausgangsstellung zurück. Der linke Arm des Hebels
(39) legt sich auf die Nasen der Abfühlhebel (2).
Liegt den Stiften der Abfühlhebel (2) ein Stück Strei-
fens ohne Löcher gegenüber, so heben sich alle Fühler
nur so weit, bis sie den Streifen berühren, der rechte
Arm des Hebels (39) wird zwar etwas angehoben, stört
aber die Bewegung der Schiene (28) nicht.
Die Schiene (28) schiebt sich nach rechts und klinkt
den Hebel (31) aus dem Hebel (32) aus.
Der rechte Arm des Hebels (32) senkt sich unter der
Spannung der Feder (33) und verschiebt die Stange (30),
die über Bauteile, die sich in der Grundplatte befinden,
die Tastenhebel sperrt und den Transmitter des Dekombi-
nators anhält. Um in den Transmitter einen neuen Schlüs-
sellochstreifen einlegen zu können, muß der Betriebsarten-
umschalter auf "K" gestellt werden.
Dabei werden durch den Nocken (11) und die Hebel (10)
und (2) Abb. 32 alle Kontaktleisten "KL" in Hochstellung
gebracht. Beim Aufwärtsbewegen des Hebels (2) Abb. 32
verschiebt sein rechter Arm am Anschlag (25) Abb. 33
die Schiene (22), die den rechten Arm des Hebels (32) anhebt
und ihn in den Hebel (31) einklinkt. Durch die Stange (30)
wird jetzt die Sperre der Tastenhebel und des Transmitters
am Dekombinator aufgehoben.
Verhinderung der Überschlüsselung nur mit einer Kombina-
tion des Schlüssellochstreifens bei Störung des normalen
Streifentransportes
Nach Abtasten der Kombinationen durch die Abfühlhebel
(2) Abb. 33 wird der Schlüssellochstreifen um einen Schritt
transportiert.
Vor dem Streifentransport geht die Rolle des Hebels (38)
auf den kleineren Radius des Nockens (16) über. Das Gummi-
kissen (17), das auf dem Hebel (10) angebracht ist,
drückt den Streifen unter der Spannung der Feder (40) an
die Rolle (18). Der Hebel (35) drückt bei der Bewegung
seiner Rolle auf dem maximalen Radius des Nockens (21)
den Hebel (11) nach unten. Der Hebel (11) wird durch den
Sperrhebel (14) blockiert. Der Hebel (9), der durch den
Finger (12) des Hebels (11) bewegt wird, legt sich mit
seinem unteren vertikalen Arm gegen den Hebel (3), der
die Bewegung der Abfühlhebel ermöglicht.
Beim Transport des Streifens bewegt sich gleichzeitig
das Gummikissen (17) von rechts nach links , wobei der
Finger (15) den Sperrhebel (14) entfernt. Der Hebel (11)
mit dem Finger (12) geht am Ende des Zyklus, wenn die
Rolle des Hebels (35) auf den kleinen Radius des Nocken
(21) übergeht, wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Der untere vertikale Arm des Hebels (9) verschiebt sich
nach rechts, ohne die Bewegung des Hebels (3) im folgenden
Zyklus des Transmitters zu behindern.
Hat der Hebel (11) seine obere Stellung erreicht, senkt
der Nocken (16) und der Hebel (38) das Gummikissen (17).
Es nimmt, nachdem es sich entgegen dem Uhrzeigersinn
gedreht hat, wieder seine Ausgangsstellung ein. Wenn sich
der Streifen während der Umdrehung der Streifentransport-
trommel (6) aus irgendwelchen Gründen nicht vorwärtsbewegt,
bleiben die Hebel (11) und (9) durch den Hebel (14) ge-
sperrt. Im folgenden Arbeitszyklus läßt der untere verti-
kale Hebelarm (9) den Hebel (3) nicht nach oben gehen.
Alle Abfühlhebel (2) bleiben in der unteren Stellung.
Dadurch werden die Tastenhebel gesperrt und der Transmitter
des Dekombinators angehalten. Steht der Betriebsartenum-
schalter auf "K" oder "D" arbeitet die geschilderte Ein-
richtung nicht, da die Hebel (10) und (14) durch die
Nocken (4) und (7) außer Betrieb gesetzt werden.
Verhinderung von Fehlern des Nachrichtensachbearbeiters
beim Benutzen des Schlüssellochstreifens.
Die Systeme, die Fehlern des Nachrichtensachbearbeiters
beim Benutzen des Schlüssellochstreifens vorbeugen, sind
unter dem Sammelbegriff Kontroll- und Sicherungsvorrich-
tungen (KSV) zusammengefaßt.
Die KSV verhindern :
a) Arbeit mit Klartext bei eingelegtem Schlüssel-
lochstreifen
b) doppelte (teilweise oder ganze) Benutzung eines
Schlüssellochstreifens beim Verschlüsseln
c) Verschlüsseln mit den Schlüssellochstreifen der
zum Entschlüsseln bestimmt ist.
KSV, die Möglichkeit der Arbeit an der Maschine mit
Klartext bei eingelegtem Schlüssellochstreifen verhindern
Wenn der Betriebsartenumschalter auf "K" steht, befindet
sich der rechte Arm des Hebels (35) Abb. 34 auf dem großen
Radius des Nockens (33) und das Ansatzstück (30) liegt mit
einem kleinen Spielraum unter dem Einschnitt des rechten
Armes des Hebels (2). Der Knopf (21), der am linken
Hebelarm (2) drehbar gelagert ist, tritt bei geöffnet
Deckel des Transmitters in der Streifenführung hervor.
Wird in die Streifenführung des Transmitters der Schlüssel-
lochstreifen eingelegt und der Deckel geschlossen, so senkt
sich der Knopf (21) unter dem Druck des Deckels und des
Streifens. Der linke Arm des Hebels (2) wird nach unten
gedrückt. Mit diesem geht sein rechter Arm nach unten.
Dieser drückt auf das Ansatzstück (30). Dieses drückt
auf den Finger (25) und schiebt das Gleitstück (26) nach
unten.
Der mit dem Gleitstück (26) verbundene Bolzen (27)
schwenkt die in der Tastatur befindlichen Hebel (28) und
(29) mit der Achse (62) Abb. 2 und rastet mit dem Hebel
(52) den Hebel (39) aus dem Hebel (47) aus. Dadurch wird
verhindert, daß die Hauptwelle der Maschine anläuft.
Beim Einstellen des Betriebsartenumschalters auf "D" oder
"C" liegt der Hebel (35) Abb. 34 auf dem kleinen Radius
des Nockens (33) und schiebt mit der Nase des Ansatz-
stückes (30) den Knopf (21) unter die Transmitterplatte.
KSV, die doppeltes Benutzen eines Schlüssellochstreifens
ausschalten
Wird der Betriebsartenumschalter auf "K" oder "D" gestellt,
so verändern die Bauteile der KSV ihre Stellung nicht,
ausgenommen sind die Abfühlhebel (4) und (8) Abb. 34,
die sich heben und sich dem Streifen, der in den Trans-
mitter eingelegt ist, nähern ihn jedoch nicht berühren
und seine Vorwärtsbewegung beim Entschlüsseln nicht be-
hindern.
Wird der Betriebsartenumschalter auf "C" gestellt, so
fällt der Hebel (3) mit seiner Nase in die Vertiefung des
Nockens ein, und die Abfühlhebel (4) und (8) heben sich
unter der Spannung der Feder (6). Der Abfühlhebel (4)
hebt sich höher als der Abfühlhebel (8), da im Streifen
dem Abfühlstift des Abfühlhebel. (4) gegenüber ein Loch
sein muß, durch das der Abfühlstift hindurchgeht.
Der Abfühlhebel (8) kommt nur bis an die Oberfläche des
Streifens heran. Dabei liegen die Aussparungen in den Ab-
fühlhebeln (4) und (8) auf gleicher Höhe mit den Zähnen
der Schiene (11). Beim weiteren Drehen der Nockenwelle
(15), die mit dem Betriebsartenumschalter verbunden ist,
fällt der Bolzen (13) auf dem Hebel (14) in die Vertie-
fung der Kurvenscheibe (12) ein. Der Hebel (14) schwenkt
unter der Spannung der Feder (10) im Uhrzeigersinn. Dabei
gehen die Zähne der Schiene (11) durch die Aussparungen
in den Abfühlhebeln (4) und (8).
Mit der Schiene (11) verschiebt sich durch den Nocken
(12) auch das Auflagestück (9), das mit seiner Nase unter
die Nase des Stempels (5) kommt. Beim Weiterdrehen der
Nockenwelle (15) hebt der Nocken (17) den Hebel (18)
und stanzt durch das Ansatzstück mit Stempel (5) ein Loch
in den Streifen. Die Nocken (16) und (20) aber bringen
die Abfühlhebel (4) und (8) und den Stempel (5) in ihre
untere Stellung, die den Streifenvorschub in der Streifen-
führung ermöglicht. Der rechte Hebelarm (14) schwenkt beim
Einfallen des Bolzens (13) in die Vertiefung des Nockens
(12) den Hebel (23). Das Gleitstück (26) und die Stange
(27) bewegen sich, indem sie seinem rechten Arm folgen.
Die Hebel (28) und (29) und die mit ihnen verbundenen Bau-
teile, die sich in der Tastatur befinden, gewährleisten das
normale Anlauten der Hauptwelle der Maschine.
Bei der doppelten Benutzung eines Schlüssellochstreifens
erscheinen beim Umschalten von "D" auf "C" über beiden
Abfühlstiften der Abfühlhebel (4) und (8) im Streifen
Löcher, und beide Abfühlhebel heben sich auf gleiche Höhe.
Die Aussparung des Abfühlhebels (4) steht dem Zahn der
Schiene (11) gegenüber. Die Aussparung des Abfühlhebels
(8) steht höher, wobei sie verhindert, daß sich die Schiene
(11) in Richtung des Nockens (12) bewegt.
Der Hebel (14) bleibt in Ausgangsstellung, und sein rech-
ter Arm stößt nicht an den linken Arm des Hebels (23).
Der rechte Arm des Hebels (23) drückt auf den Bolzen
(27). Die Hebel (28), (29) und die mit diesen verbundenen
Bauteile, die sich in der Tastatur befinden, werden so
eingestellt, daß ein Anlaufen der Hauptwelle der Maschine
unmöglich ist.
Kontroll- und Sicherungsvorrichtung (KSV), die die Mög-
lichkeit des Chiffrierens mit einem Schlüssellochstrei-
fen, der für die Dechiffrierung bestimmt ist, ausschließt.
Wenn beim Chiffrieren in den Transmitter des Chiffrators
ein Schlüssellochstreifen eingelegt wurde, der für die
Dechiffrierung bestimmt ist (er hat kein Kontrolloch),
so haben die Abfühlhebel (4) und (8) Abb. 34 beim Dre-
hen der Nockenwelle (15) nur die Möglichkeit, sich bis
zum Anstoßen an den Streifen zu heben, Dabei befindet sich
die Aussparung des Abfühlhebels (4) weiter unten als die
des Abfühlhebels (8). In dieser Stellung der Abfühlhebel
wird eine Bewegung der Schiene (11) und die Drehung des
Hebels (14) durch den Abfühlhebel (4) verhindert. Das
Gleitstück (26) mit dem Bolzen (27) und die Hebel (28)
und (29) werden in eine solche Lage gebracht, die ein
Anlaufen der Hauptwelle der Maschine verhindert.
Auslösen der Hauptwelle den Maschine beim Umschalten des
Betriebsartenumschalters von "K" auf "D"
Beim Chiffrieren oder Dechiffrieren ist es notwendig,
daß die erste Kombination des Schlüssellochstreifens mit
dem ersten Klartextzeichen überlagert wird. Da im Laufe
des Arbeitszyklus das Druckwerk eher in Tätigkeit tritt
als die Einstellung der Kontaktleisten erfolgt, ist es
notwendig, zu Beginn des Chiffrierens oder Dechiffrierens
die Kontaktleisten in die Stellung zu bringen, die der er-
sten Kombination im Schlüssellochstreifen entspricht.
Zur Erfüllung dieser Forderung wird die Hauptwelle der
Maschine und des Transmitters am Chiffrator für einen
Arbeitszyklus beim Umschalten des Betriebsartenumschalters
von "K" auf "D" ausgelöst, nachdem der Schlüsselloch-
streifen in den Transmitter eingelegt wurde. Dabei wird
das Weiterschalten des Wagens und das Ansprechen des
Gruppenzählers unterbunden. Während dieses Arbeitsganges
fühlen die Abfühlhebel des Transmitters die Schlüssel-
kombination ab, und die Kontaktleisten nehmen eine Stellung
entsprechend dieser Kombination ein. Danach kann mit dem
Chiffrieren oder Dechiffrieren bei der entsprechenden
Stellung des Betriebsartenumschalters begonnen werden.
Beim Umschalten des Betriebsartenumschalters von "K" auf
"D" geschieht folgendes :
a) Der Nocken (46) rastet durch den Hebel (45) Abb.
25 das Zahnrad des Chiffratorantriebes ein.
b) Der Nocken (1) Abb. 2 der Welle, die durch das
Zahnrad (67) mit der Welle des Betriebsartenum-
schalters verbunden ist, verschiebt die Schiene
(27) nach links. Die mit der Schiene (27) zu-
sammenwirkenden Hebel (34), (46), (47) geben
die Hebel (45) und (43) frei, und die Hauptwelle
der Maschine und des Transmitters am Chiffrator
werden für einen Arbeitszyklus ausgelöst.
c) Der Hebel (39) Abb. 25 klinkt während seines Lau-
fes auf dem Nocken die Zugstange (36) aus dem
Hebel (22) aus. Während sich die Zugstange (36)
nach oben bewegt, drückt sie mit ihrer rechten
abgeschrägten Kante den Hebel (20) nach rechts
und legt sich mit ihrer unteren Kante auf den
oberen Lappen des Hebels (20).
Nach Auslösen der Hauptwelle und des Transmitters am
Chiffrator, wenn der Nocken für die Weiterschaltung des
Wagens anläuft und der mit ihm gekoppelte Hebel (16) die
Hebel (22), (20) nach rechts dreht, so wird der Wagen
nicht fortbewegt, da die Zugstange (36) nicht mehr in
den Hebel (22) eingreift.
Bei seiner Bewegung drückt der Hebel (22) mit seinem ein-
genieteten Bolzen den Hebel (20) zurück und bringt ihn
mit der Stange (36) außer Eingriff. Bei der Rückwärtsbe-
wegung des Hebels (22) fällt er in die Aussparung der
Zugstange (36) ein und gewährleistet im weiteren eine
schrittweise Fortschaltung des Wagens während eines jeden
Arbeitszyklus. Die Sperrung des Gruppenzählers erfolgt
beim Umschalten des Betriebsartenumschalters von "K"
auf "D" folgendermaßen :
Der Finger (19) Abb. 32 des Zahnrades (21), das sich bei
Betätigung des Betriebsartenumschalters dreht, rastet
den rechten Arm des Hebels (24) aus der Nase des Hebels
(18) aus. Dabei wird der Hebel (29), der die Drehung der
Achse des Zählers bewirkt, durch die Nase des oberen Teiles
des Hebels (24) gesperrt. Beim Umschalten des Betriebsar-
tenumschalters von "K" auf "D" laufen die Hauptwelle und
der Chiffrator für einen Arbeitszyklus an. Während der
Umdrehung der Welle (26) des Transmitters rastet der
Nocken, der auf ihrem linken Ende befestigt ist, den Hebel
(29) aus der oberen Nase des Hebels (24) aus, indem er den
rechten Arm in den Hebel (18) einrastet. In den folgenden
Arbeitszyklen beim Chiffrieren oder Dechiffrieren ist
der Hebel (29) für die Arbeit frei.
Betriebsartenumschalter
Der Betriebsartenumschalter dient zur Umschaltung der
Stromkreise der Maschine auf die 3 entsprechenden Be-
triebsarten K, D, C. Die Ansicht des Umschalters ist in
Abb. 37 gezeigt. Die Teile des Umschalters sind auf einer
Grundplatte (1) angebracht, die auf der unteren Seite der
Grundplatte des Chiffrators montiert ist. Mit der Grund-
platte (1) sind die 2 Leisten (4) starr verbunden, die
aus Kunststoff mit eingepreßten Kontakten hergestellt
sind. Auf der Platte (6), die sich in Führungsschienen
bewegt, sind zwei Leisten mit gefederten Kontakten befestigt
und ein Metallständer (2) mit einer Achse, durch den
die Platte (6) in einer der drei festen Stellungen verharrt.
Die Teile des Umschalters werden durch die Verkleidung
(3) abgedeckt.
Die Einstellung des Betriebsartenumschalters auf die ge-
wünschte Stellung geschieht mit dem Drehknopf, der an der
rechten Seite der Grundplatte herausgeführt ist und auf
dem die Bezeichnungen K, D und C eingraviert sind. Bei
Drehung des Knopfes bewegt sich die Zahnstange (20) Abb.
32, deren Bewegung sich über die Zahnräder (21), (22)
auf die Welle (12) überträgt und von dort aus durch den
Exzenter (16) über den Hebel (13) auf die Platte des
Umschalters mit den Leisten (15).
Der Gruppenzähler
Der Zähler (5) Abb. 28, der sich im Transmitter des
Chiffrators befindet, dient zum Zählen der Anzahl der
Gruppen des Geheimtextes. Das Ablesen der Zähleranzeige
erfolgt von den vier Zifferntrommeln. Die letzte rechte
Zifferntrommel zeigt die Zahl der Arbeitszyklen von 0 -
4 an und die drei anderen mit den Ziffern von 0 - 9
zeigen die Anzahl der Fünfergruppen an. Bei Benutzung
des Umkehrhebels kann der Zähler vor- und rückwärts
zählen.
Der Zähler hat Klinkenantrieb.
Die Drehung der treibenden Achse des Zählers erfolgt durch
den Hebel (5) Abb. 35 und den Exzenter, der auf der An-
triebswelle (6) des Transmitters am Chiffrator sitzt.
Während einer Umdrehung der Antriebswelle des Transmitters
wird das Antriebsrad (2) des Zählers durch den Hebel
(5) über das Zahnrad (3) um ein Zehntel Umdrehung weiter-
bewegt.
Durch Drücken des Hebels (1) erfolgt die Rückstellung des
Zählers, das heißt alle Zifferntrommeln gehen in die Null-
stellung.
Gehäuse mit Konzepthalter
Das Gehäuse (2) Abb. 1 deckt die Baugruppen, die auf der
Grundplatte befestigt sind, ab. Über der Transmitterplatte
(24) ist im Gehäuse ein Ausschnitt, damit der Schlüssel-
lochstreifen bequem eingelegt werden kann. In der Vorder-
front ist ein Ausschnitt für die Schalttafel der Strom-
versorgung. Die Farbbandspulen des Selektionsdruckwerkes
befinden sich unter einem Deckel (35), der geöffnet werden
kann ein Auswechseln des Farbbandes ohne Abnehmen
des Gehäuses erfolgen. Im hinteren Teil des Gehäuses sind
die Deckel (12) und (16), die das Abnehmen des Gehäuses
bei aufgesetztem Wagen erleichtern. Der Deckel (16) gibt
auch die Möglichkeit, die Umschaltung des Elektromotors
für die Arbeit mit Gleich- oder Wechselstrom vorzunehmen.
Links oben auf dem Gehäuse sitzt der Konzepthalter.
Das Gehäuse wird auf der Grundplatte durch zwei unverlier-
bare Schrauben befestigt.
Stromversorgung
Die Stromversorgung Abb. 38 ermöglicht das Anschließen
der elektrischen Bauteile der Maschine an ein Wechsel-
stromnetz mit 100 bis 250 V Spannung bei einer Frequenz
von 50 Hz oder an ein Gleichstromnetz mit einer Nenn-
spannung von 110 V. Die Stromversorgung ist auf einem
rechtwinkligen Chassis (2) aufgebaut und an der Grund-
platte der Maschine befestigt. Sie enthält:
a) den Transformator (4)
b) 2 Umschalter (7), die durch den Schalthebel (5)
gesteuert werden und die elektrischen Stromkreise
der Maschine entsprechend der Art der Stromquelle
verbinden
c) den Begrenzungswiderstand (9)
d) die Steckerleiste (3), die zur Verbindung der
elektrischen Teile der Stromversorgung mit den
elektrischen Teilen, die sich auf der Grundplatte
befinden, dient
e) ein Voltmeter (1), mit einer Skala von 0 - 150 V
zum Messen der Spannung an der Sekundärwicklung
des Transformators (4)
f) einen Spannungswahlschalter (6), der entsprechend
der Nennspannung des Netzes, die auf der Skala (8)
eingraviert ist, eingestellt wird.
Filter
Der Filter Abb. 27 dient zur Schwächung der Funkstörungen,
die von den elektrischen Bauteilen der Maschine hervorge-
rufen werden.
Auf einer Metallplatte (6) sind 4 Drosseln (4) paarweise und
auf zwei winkeln (7) vier Kondensatoren (5) angeordnet.
Die Drosseln sind auf Alßiferringen gewickelt. Jeder Ring
hat eine Wicklung mit 160 Windungen aus Draht von Ø 0,69 mm
der Marke PEW-2. Im Filter wurden Durchführungskondensa-
toren vom Typ KBP mit einer Kapazität von 0,25 μF und Be-
triebsspannung von 250 V verwandt.
Zum Anschalten des Filters an das Netz und an die elek-
trischen Bauteile sind auf der Leiste (6) zwei Stecker-
leisten (1), (8) angebracht. Der Filter ist an der hinteren
Wand der Grundplatte unter den Elektromagneten des Selek-
tionsdruckwerkes befestigt.
Grundplatte
Die Grundplatte dient zur Befestigung aller Baugruppen
und Steuerteile der Maschinen. Das Funktionsschema der
Bauteile der Grundplatte ist auf Abb. 25 dargestellt. Die
mechanischen Bauteile der Grundplatte werden hauptsächlich
vom Knopf (1) des Betriebsartenumschalters und vom Knopf
(48) des Arbeitsumschalters gesteuert. Der Knopf (1)
(Betriebsartenumschalter)hat drei feste Lagen K, D
und C, die den drei Betriebsarten entsprechen. Jede dieser
drei Lagen wird durch die Rastklinke (3) mit Feder fixiert.
Die Drehung des Knopfes wird durch das Kegelradpaar auf
die Welle (4) übertragen. Das Zahnrad (12) verschiebt
die Zahnstange (15), die über Zwischenelemente die not-
wendige Stellung des Betriebsartenumschalters des Trans-
mitters erreicht. Der Nocken (46), der den im Chiffrator
gelegenen Hebel (45) steuert, schaltet in der Stellung D
oder C den Antrieb des Chiffrators ein und in der Stellung
K aus. Befindet sich der Nocken (40) in der Stellung C,
so stellt er den Hebel (41) so ein, daß eine Teilung des
zu druckenden Textes in Fünfergruppen erfolgt. Der Nocken
und der Hebel (30) schalten in der Stellung C das
Zählwerk mit Zwischenraumgeber ein. In der Stellung D
wird der Locher durch den Nocken (31) und den Hebel (32)
abgeschaltet. Durch das Zahnrad (11) wird die Drehbewe-
gung der Welle (4) auf die Welle (8) übertragen, die in
der Tastatur liegt. Der Arbeitsumschalter (48) hat drei
feste Stellungen B, LB, L. Der Nocken (24) blockiert in
der Stellung L das Druckwerk. Der Nocken (25) und der He-
bel (26) schalten in der Stellung B den Locher ab. Der Nocken
(23) schaltet in der Stellung D die Weiterschaltung des
Wagens während eines jeden Zyklus ab, indem er auf die
Zugstange (36) einwirkt und sie aus dem Hebel (22) aus-
klinkt. Die Zugstange (10) löst den Wagenrücklauf aus,
wenn die Taste Wagenrücklauf gedrückt wurde. Indem sie
auf den Bügel (43) und die Stange (36) einwirkt, wird
letzterer aus dem Hebel (22) ausgeklinkt und es wird das
Ansprechen der Elemente für die Wagenweiterschaltung ausge-
schlossen.
III. Elektrische Schaltung der Maschine
Die elektrische Prinzipschaltung der Maschine ist auf
der Zeichnung 40 dargestellt.
Die Verdrahtung der elektrischen Bauteile der Maschine
ist für jede Baugruppe einzeln ausgeführt. Die elek-
trische Verbindung zwischen den Baugruppen wird durch
Steckerverbindungen hergestellt.
Eine Verdrahtung folgender Baugruppen wurde vorge-
nommen :
a) Stromversorgung
b) Grundplatte
c) Antrieb
d) Tastatur
e) Selektionsdruckwerk
f) Chiffrator
g) Filter
Elektrische Bauteile der Stromversorgung
a. Der Transformator TR (1), dessen Primärwicklung 10
Anschlüsse hat und an ein Wechselstromnetz mit einer
Frequenz von 50 Hz und einer Nennspannung von 100,
110, 127, 115, 160, 190, 220, 230 und 250 V angeschlos-
sen werden kann. Die Anschlüsse des Transformators
sind an die Lamellen des Spannungswahlschalters an-
geschlossen, dessen Schleifkontakt auf die der Netz-
spannung des Netzes entsprechende Lamelle eingestellt
wird.
b. Das Voltmeter (1 V) für die Kontrolle der Größe der
Wechselspannung an der Sekundärwicklung des Transfor-
mators Tr (1).
c. Die zweipoligen Schalter Sch3 und Sch2 für die Umschal-
tung der Stromkreise in Abhängigkeit von der Art des
Stromes der Stromquelle.
d. Die Steckerleiste ST 8 für die elektrische Verbindung
zwischen den Bauteilen der Stromversorgung mit den Bau-
elementen der Grundplatte.
e. Widerstand W6 (350 Ohm, 20 W), der den Strom im
Kreise der Elektromagneten begrenzt, wenn die Maschine
an ein Wechselstromnetz angeschlossen wird.
Die elektrischen Bauteile der Grundplatte
a. Federleiste Hü5 für die elektrische Verbindung durch
die Messerleiste St6 mit dem Motor Mo 1. der sich im
Antrieb der Maschine befindet.
b. Federleiste Hü7, die in die Messerleiste Stö der
Stromversorgung gesteckt wird.
c Die Federleiste HÜ7 und die Federleiste Hü4, die an der
hinteren Wand der Grundplatte angebracht sind, dienen
zur Verbindung mit den Bauteilen des Filters.
d. Die Sicherungen Si1 und Si2 befinden sich an der rech-
ten Seite der Grundplatte.
e. Regelbarer Drahtwiderstand W3 (510 Ohm, 50 W), der
in Serie mit der Erregerwicklung des Elektromotors
Mo 1 liegt und zum Regeln der Drehzahl bei Arbeit
vom Gleichstromnetz dient.
f. Drahtwiderstand W4 (820 Ohm, 50 W) und Kondensator C3
(0,015 F, 500 V), die bei Speisung vom Wechselstrom-
netz in den Stromkreis des Reglers des Elektromotors
Mo 1 eingeschaltet sind.
g. Widerstand W2 (1000 Ohm, 1 W) und Kondensator C2
(0,25 F, 400 V) bilden die Funkenlöschung für den
Impulskontakt, der sich im Antrieb der Maschine be-
findet.
h. Widerstand W1 (1000 Ohm, 1 W) und Kondensator C1
(0,25 F, 400 V) bilden die Funkenlöschung für den
Kontakt K1 des Transportknopfes am Locher.
i. Vier Germaniumdioden Ge1 , Ge2, Ge3, Ge4, die als
Graetzgleichrichter geschaltet sind und die Elektro-
magnete des Selektionsdruckwerkes bei Anschluß
der Maschine ans Wechselstromnetz speisen.
j. Elektrolytkondensator C4 (5O F, 300 V) zur Glättung
der gleichgerichteten Spannung.
k. Übergangskontaktleiste ÜKL 5, die mit der Übergangs-
kontaktleiste ÜKL 6, die sich ihrerseits am Antrieb
befindet und an den Impulskontakt angeschlossen ist,
verbunden ist.
l. Netzschalter Sch1 zum Einschalten des Netzes
m. Übergangskontaktleiste ÜKL 1, die die elektrische
Verbindung zwischen den Elementen des Chiffrators
und des Selektionsdruckwerkes herstellt.
n. Elektromagnet EM 28, der im Zeichenzählgerät mit
Zwischenraumgeber eingebaut ist.
o. Sperrkontakt SK, der die Maschine sperrt, wenn der
Betriebsartenumschalter nicht richtig eingestellt
ist.
p. Widerstand W5 (470 Ohm, 10 W) im Stromkreis der
Wicklung des Elektromagneten "Zwischenraum".
Elektrische Bauteile des Antriebes
a. Elektromotor Mo 1, Typ SL-369 U/A1. Die Speisung des
Elektromotors erfolgt vom Gleichspannungsnetz mit der
Spannung 110 V oder vom Wechselstromnetz 127 V unter
Anwendung eines Reglers. Die Umschaltung der Wick-
lung des Elektromotors für die Arbeit mit Gleich-
oder Wechselstrom erfolgt durch den entsprechenden
Stecker St 10 und Hü 9. Wird der Elektromotor vom
Wechselstromnetz gespeist, so arbeitet er als Reihen-
schlußmotor, wobei eine Erregerwicklung M1 - M2 be-
nutzt wird. Wird der Elektromotor vom Gleichstrom-
netz gespeist, so arbeitet er als Nebenschlußmotor
mit hintereinander geschalteten Erregerwicklungen.
b. Messerleiste St 6 und Federleiste Hü 5 dienen zur
Verbindung der Wicklung des Elektromotors mit den
Bauelementen, die sich in der Grundplatte befinden.
c. Der Kontakt RK gehört zum Drehzahlregler des Elek-
tromotors Mo 1.
d. Der Impulskontakt IK, der im Stromkreis der Elektro-
magnete liegt, wird durch einen Nocken der Hauptwelle
der Maschine für eine bestimmte Zeit des Arbeitszyk-
lus geschlossen. Der Kontakt IK ist an die Über-
gangskontaktleiste ÜKL 6, angeschlossen, die mit der
Übergangskontaktleiste ÜKL 5 der Grundplatte verbunden
ist.
Elektrische Bauteile der Tastatur
a. 28 Kontaktgruppen KG3 - KG30. Die jeweils inneren und
die jeweils äußeren Kontaktfedern jeder Gruppe sind
miteinander verbunden.
b. Die Übergangskontaktleiste ÜKL 4 mit 32 Federkontakten.
Die inneren Kontaktfedern der Kontaktgruppen in der
Tastatur sind mit dem ersten bis 28. Kontakt der
Übergangskontaktleiste ÜKL 4 verbunden. Die äußeren
Kontakte der Kontaktgruppen mit dem gemeinsamen Pol
am Kontakt 32 der Leiste ÜKL 4.
Elektrische Bauteile des Selektionsdruckwerk
a. 27 Elektromagnete EM1 bis EM27
b. Übergangskontaktleiste ÜKL 2 mit flächenartigen Kon-
takten.
Ein Ende Wicklung ist auf die gemeinsame Schiene
28 geführt, die durch die Kontakte 38, 39, 40 der
Kontaktleiste ÜKL 2 verbunden ist.
Elektrische Bauteile des Chiffrators
a. Der Betriebsartenumschalter, der aus den Kontakt-
leisten KL 3, KL 4, KL 5 und KL 6 besteht. Die Kon-
taktleisten KL 3 und KL 6 sind auf der Grundplatte
befestigt, die Leisten KL 4 und KL 5 können verscho-
ben werden, und sie nehmen eine der drei festen
Stellungen ein, die den drei Betriebsarten K, D und
C entsprechen. Jede der Leisten hat drei Reihen
Kontakte I, II, III. Die jeweils gleichen Reihen der
Leisten KL 3, KL 4 und der Leisten KL 5, KL 6 geben
miteinander Kontakt. Die Leisten KL 3 und KL 6 haben
feste Kontaktstifte und die Leisten KL 4 und KL 5 ge-
federte Kontaktstifte.
b. Die Kontaktleisten KL, die zwei mit der Grundplatte
starr verbundene Kontaktleisten KL7 und KL8 be-
sitzt, zwischen denen 5 Kontaktleisten liegen. (Auf
der Zeichnung nicht angeführt). Jede der 5 Kontakt-
leisten besitzt vier Reihen von je 26 Kontakten.
Die Leisten KL 7 und KL 8 haben zwei Reihen von je
13 Kontakten. Die 5 Kontaktleisten KL verschieben
sich bei jedem Arbeitsgang des Transmitters des Chiff-
rators und schließen die Stromkreise des Druckwerkes
der Maschine, indem sie den Klartext verschlüsseln
und den Geheimtext entschlüsseln.
c. Die Übergangskontaktleiste ÜKL 3 stellt die elektrische
Verbindung mit den Bauelementen der Tastatur durch
die Übergangskontaktleiste ÜKL 4 und mit den Bauele-
menten des Selektionsdruckwerkes durch die Übergangs-
kontaktleiste ÜKL 1 der Grundplatte her.
Elektrische Bauteile des Filters
a. 4 Drosseln Dr 1, Dr 2, Dr 3 und Dr 4, die hinterein-
ander zu je zwei in jede Leitung der Stromquelle ein-
geschaltet sind.
b. 4 Kondensatoren C 5, C 6, C 7 und C 8. Jeder Kondensa-
tor hat einen stromführenden Draht, der mit einer
Platte des Kondensators verbunden und in die Speise-
leitung eingeschaltet ist. Die andere Kondensatorplatte
wird mit dem Gehäuse der Maschine verbunden. Der Fil-
ter wird mit Hilfe von Messerleisten St 2, St 3, und
Federleisten Hü 3, Hü 4 in die Speiseleitung einge-
schaltet.
Stromlaufplan
Der Stromlauf von dem Netzstecker NSt der Schnur zu den
Kontakten 2 und 5 der Leiste Hü 7 ist für die Arbeit mit
Gleich- sowie Wechselstrom gleich und wird deshalb in der
weiteren Abhandlung nicht mehr erwähnt.
a. NSt; Hü 1; St 2; C5; Dr 1; C6; Dr 2, St 3; Hü4;
Si 2; Sch 1 Kontakt 2, 4; Kontakt 2 Hü 7.
b. NSt; Hü 1; St 2; C7; Dr 3; C8; Dr 4;St 3;Hü 4;
Sch 1 Kontakt 1, 3; Kontakt 5 Hü 7.
Stromkreislauf des Elektromotors Mo 1 bei Anschluß an
das Wechselstromnetz
Kontakte 2 der Leisten Hü 7 und St 8; geschlossene Kon-
takte 4, 2 des Umschalters Sch 3, Primärwicklung des
Transformators Tr 1, geschlossene Kontakte 1, 3 des Um-
schalters Sch 3; Kontakte 5 der Leisten St 8, Hü 7.
Stromkreis der Sekundärwicklung des Transformators Tr 1:
Sekundärwicklung des Transformators; geschlossene Kontakte
2,4 des Umschalters Sch 2; Kontakte 3 der Leisten St 8,
Hü 7, Kontakte 1 der Leisten Hü 5, St 6; Kontakt 2 der
Leiste Hü9; Erregerwicklung M1, M2; Kontakte 5, 6 der
Leiste Hü 9; Kontakt RK; Kontakt 3 der Leiste Hü 9;
Ankerwicklung A 1, A 2; Kontakt 8 der Leiste Hü 9; Lei-
stung 3; Kontakte 3 der Leisten St 6, Hü 5; Kontakte 6
der Leisten Bü 7, St 8; Kontakte 3, 1 des Umschalters
Sch 2; Sekundärwicklung Tr 1.
Stromkreis des Elektromotors Mo 1 bei Anschiuß an ein
Gleichstromnetz
Kontakte 2 der Leisten Hü 7, St 8; Kontakte 4, 6 des Um-
schalters Sch 3; Kontakte 6, 4 des Umschalters Sch 2;
Kontakte 3 der Leisten St 8, Hü 7; Kontakte 1 der Lei-
sten Hü 5, St 6; Kontakt 2 der Leiste Hü 9; Erreger-
wicklung M1 - M2; Kontakte 4, 5 der Leiste Hü 9; Erreger-
wicklung M1 - M2; Leitung 5; Kontakte 5 der Leisten St 6,
Hü 5; Regelwiderstand W 3; Kontakte 2 der Leisten Hü 5,
St 6; Leitung 2; geschlossene Kontakte 8, 9 der Leiste
Hü 9; Leitung 3; Kontakt 3 der Leisten St 6, Hü 5;
Kontakt 6 der Leisten Hü 7, St 8; Kontakte 3, 5 des Um-
schalters Sch 2; Kontakte 5, 3 des Umschalters Sch 3;
Kontakte 5 der Leisten St 8, Hü 7.
Die Ankerwicklung des Motors ist an den Kontakten 3 und
8 der Leiste Hü 9 angeschlossen, d.h. parallel zur Strom-
quelle.
Stromkreis im Druckteil der Maschine bei Anschluß an eine
Wechselstromguelle
Die Wechselspannung, die an der Sekundärseite des Trans-
formators Tr 1 ansteht, wird zum Gleichrichter von einer
Seite der Sekundärwicklung aus geführt :
Kontakte 2,4 des Umschalters Sch 2; Kontakt 3 der Leiste
St 8; Begrenzungswiderstand R 6; Kontakte 1 der Leisten St
8, Hü 7; gemeinsamer Punkt der Dioden Ge 1, Ge 2.
Von der anderen Seite der Sekundärwicklung des Transforma-
tors:
Kontakte 1,3 des Umschalters Sch 2; Kontakte 6 der Leisten
St 8, Hü 7; Kontakt 3 der Leiste Hü 5; Sicherung Si 1; gemein-
samer Punkt der Dioden Ge 3, Ge 4.
Die Wechselspannung der Sekundärwicklung des Transforma-
tors Tr 1 wird von einer einphasigen Brücke, die aus 4
Dioden besteht, die in Graetzschaltung geschaltet sind,
gleichgerichtet. Die gleichgerichtete Spannung positiver
Polarität (+ der Stromquelle) wird von dem gemeinsamen
Punkt der Dioden Ge 2 und Ge 3 und diejenige negativer
Polarität (- der Stromquelle) vom gemeinsamen Punkt der
Dioden Ge 4 und Ge 1 abgenommen und dem Kondensator 4 zu-
geführt, der sie glättet. D. h. bei einer Speisung von einer
Wechselstromquelle liegt am Kondensator C 4 nach Einschal-
ten der Maschine eine gleichgerichtete Spannung an, die für
die Speisung der Elektromagneten des Druckteiles der Ma-
schine verwandt wird.
Stromkreis bei der Stellung des Betriebsartenumschalters
auf K
Nach Betätigung des Tastenhebels z.B. A läuft die Haupt-
welle der Maschine für einen Arbeitszyklus an, bei dessen
Beginn der Kontakt IK geschlossen wird.
Der Verlauf des Stromimpulses ist folgender:
+ der Stromquelle; Kontakt SK; Kontakte 1,2 der Leisten
ÜKL 5 und ÜKL 6; geschlossener Kontakt IK; Kontakt 3,4
der Leisten ÜKL 6, ÜKL 5; Leitung 32; Kontakt 32 der Lei-
sten ÜKL 1 der Grundplatte; Kontakt 32 der Leiste ÜKL 3
des Chiffrators; Leitung 56; geschlossener Kontakt des
Kupplungskontaktes KK; Leitung 55; Kontakte 32 der Lei-
sten ÜKL 3, ÜKL 4; Leitung 32; geschlossener Kontakt A
Tastatur; Leitung; Kontakt 1 der Leisten ÜKL 4-, ÜKL 3;
Leitung 28. Der Kontakt der Leiste KL 5 zu dem die Lei-
tung 28 führt, berührt in der Stellung K des Betriebs-
artenumschalters den linken Kontakt in der ersten und
zweiten Reihe der Leiste KL 6. Vom linken Kontakt der
zweiten Reihe der Leiste KL 6 geht der Stromimpuls auf
den linken der zweiten Reihe der Leiste KL 5 und über die
Leitung 1 auf den Kontakt 1 der Leisten ÜKL 3, ÜKL 1, ÜKL
2; an die Wicklung des Elektromagneten A im Selektions-
druckwerk; Leitungen 29, 28; Kontakte 40, 39, 38 der Leisten
ÜKL 2, ÜKL 1; Leitung 30; - Stromquelle. Bei dem ange-
führten Stromlauf spricht der Elektromagnet an und ge-
währleistet den Abdruck des Buchstabens A.
Stromverlauf bei der Stellung des Betriebsartenumschal-
ters auf C
Nach Betätigen der Taste z.B. A, des Anlaufens der Haupt-
welle der Maschine und Schließen des Kontaktes IK geht
der Stromimpuls wie schon oben beschrieben bis an den Kon-
takt der ersten Reihe der Leiste KL 5, der mit der Lei-
tung 28 verbunden ist. In der Stellung C des Betriebsarten-
umschalters liegen die Kontakte der ersten Reihe der Lei-
ste KL 5 Über den dritten Kontakten (von links) der
ersten Reihe der Leiste KL 6.
Weiterer Stromverlauf: Leitung 82; Kontakt 5 der Leiste
KL 8 der Kontaktleisten KL; Stromkreis 5 Schienen, auf
Grund deren Stellung wir z.B. auf den Kontakt 18 der
Leiste KL 7 kommen; Leitung 73 auf den zweiten Kontakt
von links der dritten Reihe der Leiste KL 3 des Betriebs-
artenumschalters, der mit dem 6. Kontakt von links der
gleichen Reihe verbunden ist; auf den 2. Kontakt von
links der dritten Reihe der Leiste KL 4 und weiter mit
der Leitung 18 auf den Kontakt 18 der Leisten ÜKL 3, ÜKL 1,
ÜKL 2; Spule des Elektromagneten R; Leitung 29, 28; Kon-
takte 40, 39, 38 der Leisten ÜKL 2, ÜKL 1; Leitung 30; -
Stromquelle.
Deshalb wird in der Stellung C des Betriebsartenumschal-
ters bei Betätigen der Taste A ein R abgedruckt.
Stromverlauf bei der Stellung D des Betriebsartenumschalters
Im vorhergehenden Falle wurde bei Drücken der Taste A
das R abgedruckt, d.h. es erfolgte ein Verschlüsseln des
Zeichens A in das Zeichen R. Im gegebenen Falle muß beim
Dechiffrieren die Taste R gedrückt werden, und es wird
A abgedruckt. Wenn man den Stromverlauf von der nach Drücken
der Taste R geschlossenen Kontaktgruppe R der Tastatur be-
ginnt:
Geschlossener Kontakt R; Leitung 18; Kontakt 18 der Lei-
sten ÜKL 4, ÜKL 3, Leitung 45; erster Kontakt von links
der dritten Reihe der Leiste KL 4 des Betriebsartenumschal-
ters; zweiter Kontakt von links der dritten Reihe der Lei-
ste KL 3; Leitung 73; Kontakt 18. Weil beim Chiffrieren
des Zeichens A und beim Dechiffrieren des Zeichens R die
Kontaktleisten für das Schließen des Stromkreises die
gleiche Lage einnehmen sollen, so muß der Stromimpuls
von Kontakt 18 der Leiste KL 7 auf umgekehrtem Wege auf
Kontakt 5 der Leiste KL 8 kommen und weiter Leitung 82
auf den 3. Kontakt von links der ersten Reihe der Leiste
KL 6, die mit dem zweiten Kontakt von links der zweiten
Reihe der Leiste KL 6 verbunden ist. Letzterer berührt
den ersten Kontakt von links der zweiten Reihe der Leiste
KL 5.
Weiterer Stromlauf: Leitung 1; Kontakte 1 der Leisten ÜKL
3, ÜKL 1, ÜKL 2; Wicklung des Elektromagneten A; Leitungen
29, 28; Kontakte 40, 39, 38 der Leisten ÜKL 2, ÜKL 1;
Leitung 30; - Stromquelle. Im gegebenen Falle wird bei
Betätigen der Taste R das Zeichen A abgedruckt, d.h. es
wird dechiffriert.
Stromkreis für Wagenrücklaufmagneten
Der Elektromagnet EM 28 für den Wagenrücklauf befindet
sich im Zeichenzählwerk mit Zwischenraumgeber und dafür
bestimmt, die Auflagestücke zu steuern, die gewährleisten,
daß in den Lochstreifen die Kombinationen Wagenrücklauf
und Zeilenvorschub nach Drücken der Taste Wagenrücklauf
eingestanzt werden. Der Elektromagnet für Wagenrücklauf
kann nur eingeschaltet werden, wenn der Betriebsarten-
umschalter auf X steht. Nach dem Drücken der Taste Wagen-
rücklauf, Anlaufen der Hauptwelle und Schließen des Kon-
taktes IK geht der Stromimpuls angefangen von der Kontakt-
gruppe KW der Tastatur: geschlossene Kontaktgruppe KW;
Leitung 28; Kontakt 28 der Leisten ÜKL 4, ÜKL 3; Leitung
109; Kontakt 28 der Leisten ÜKL 3, ÜKL 1; Leitung 31;
Wicklung des Elektromagneten EM 28; - Stromquelle.
IV. Zeitdiagramm der Maschine CM -2
Das Zeltdiagramm Abb. 39 gibt die Reihenfolge der Ar-
beitsgänge der Maschine CM-2 in Abhängigkeit von der
Zeit und von Graden der Umdrehung der Hauptwelle der
Maschine an.
Die Zeit für einen Arbeitszyklus beträgt 109 ms, wenn die
Maschine mit einer Geschwindigkeit von 550 Zyklen/Minute
arbeitet. Die Zeitdiagramme der Druckteile der Maschine,
des Lochers und des Transmitters des Dekombinators sind
unter Berücksichtigung der Übersetzungen ausgeführt:
a) von der Hauptwelle der Maschine zur Hauptwelle des
Transmitters des Dekombinators
i = 40/43
b) von der Hauptwelle der Maschine zur Hauptwelle des
Lochers
i = 1
Im Zeitdiagramm sind folgende Bezeichnungen angenommen
a) Die erzwungene Bewegung eines Elementes ist durch eine
schräge Linie (von unten nach oben) gekennzeichnet.
b) Die Bewegung auf Grund von Federkraft ist durch eine
schräge Linie (von oben nach unten) gekennzeichnet.
c) Das Andauern eines Arbeitsganges wird durch eine Hori-
zontale dargestellt.
V. Wartungsanweisung für die Maschine CM-2
Bin Satz der Maschine CM-2 befindet sich in zwei Kästen.
An dem Boden den einen Kastens ist die Maschine CM-2
mit Gehäuse und Hülle befestigt. Am Deckel des Kastens
sind der Konzepthalter und die Drehkurbel befestigt.
Der zweite Kasten enthält einen Kasten mit Werkzeugen und
einen Kasten mit Ersatzteilen. Die Maschine CM-2 ist,
ausgehend von der Bedingung, daß sie innerhalb von 6 Mo-
naten in Betrieb genommen wird, abgeschmiert. Die Inbe-
triebnahme der Maschine geschieht folgendermaßen :
Der Kastenboden mit der Maschine wird auf den Arbeits-
platz gestellt. Die 4 Schrauben werden gelöst und die
Winkel, mit denen die Maschine am Kastenboden befestigt
ist, abgenommen. Bei Arbeit vom Gleichstromnetz ist es
erforderlich :
a) den Deckel (16) im rechten hinteren Teil des Gehäuses
(Abb. 1) zu öffnen und den Stecker mit dem Zeichen
"=" auf dem Antrieb nach oben zu stecken;
b) den Schalter (13) der Stromversorgung in die Stellung
"=" zu bringen;
c) den Netzstecker einzustecken;
d) den Netzschalter auf "Ein" zu stellen;
e) die Arbeit an der Maschine zu beginnen.
Bei Arbeit vom Wechselstromnetz ist erforderlich :
a) den Deckel (16) des hinteren Teiles des Gehäuses
zu öffnen und den Stecker mit dem Zeichen "~"
nach oben auf den Antrieb zu stecken;
b) den Schalter (1) der Stromversorgung in die Stellung
"~" zu bringen;
c) den Spannungswahlschalter (27) in die Stellung bringen,
die der Nennspannung des Netzes entspricht (oder der
nächstgelegenen);
d) den Netzstecker einstecken;
e) den Netzschalter (2)) der Maschine auf "Ein" zu bringen,
die Anzeige des Voltmeters zu überprüfen und mit der
Arbeit zu beginnen.
Die Primärwicklung des Transformators, der in der Strom-
versorgung ist, ist in einzelne Wicklungen aufgeteilt, wo-
durch eine stufenlose Regelung der sekundärseitigen
Spannung nicht gewährleistet wird. Praktisch kann man mit
der Arbeit beginnen, wenn die Spannung der Sekundärwick-
lung des Transformators, die vom Voltmeter angezeigt wird,
in den Grenzen 127 ± 10% Volt liegt, d.h. unter diesen Be-
dingungen wird die Geschwindigkeit der Arbeit nicht
wesentlich verändert, weil der Drehzahlregler vorhanden
ist. Bei einer solchen Spannung ist auch die einwandfreie
Arbeit der elektrischen Bauteile gewährleistet.
Drehzahlregelung der Hauptwelle der Maschine CM-2
Die Drehzahl der Hauptwelle der Maschine wird im Prüf-
feld einreguliert.
Nach einer gewissen Betriebszeit kann sich die Drehzahl
der Maschine, infolge des Einarbeitens der mechanischen
Bauelemente, etwas erhöhen. Eine Abweichung der Drehzahl
kann auch beim Auswechseln des Elektromotors eintreten,
da die Geschwindigkeitskennlinien in gewissen Grenzen
streuen.
In den aufgeführten Fällen ist eine Geschwindigkeitsre-
gelung der Hauptwelle des Elektromotors erforderlich,
die folgendermaßen durchgeführt wird : Bei Speisung
von einer Wechselstromquelle wird die Geschwindigkeits-
regelung durch Drehen in die eine oder andere Richtung
der Mutter (9) Abb. 86, die sich auf dem Regler befindet,
erreicht. Die Regelung kann man als abgeschlossen be-
trachten, wenn die Spannung an der Sekundärwicklung des
Transformators der Stromversorgung 127 ± 10% Volt be-
trägt und die Umdrehung der Hauptwelle in den Grenzen von
500 ± 10% Umdrehungen/Minute liegt. Wird vom Gleich-
stromnetz gearbeitet, so wird die Geschwindigkeit durch
Verändern des Widerstandes (32) Abb. 49, der in Reihe
mit der Erregerwicklung des Motors liegt, eingeregelt.
Dazu ist es notwendig, das Gehäuse von der Maschine ab-
zunehmen, sie zu kippen, wenn man vorher auf die Stange des
Selektionsdruckwerkes die Buchse, die sich im Werkzeug-
kasten befindet, aufgesetzt hat und die Bodenplatte abzu-
nehmen. Die Änderung des Widerstandes erfolgt durch Ver-
schieben der Schelle, nachdem die Schraube, die die
Stellung sichert, ein wenig herausgedreht wird. Bei Ver-
größerung des Widerstandes erhöht sich die Umdrehungsge-
schwindigkeit der Welle des Elektromotors.
Bei Gleichspannung von 110 V soll die Umdrehungszahl der
Hauptwelle bei 500 Zyklen/Minute liegen. Die Geschwindig-
keitsmessung der Hauptwelle führt man am günstigsten unmittel-
bar an der Hauptwelle bei Durchlauf der Maschine oder an der
Zwischenwelle (24) aus Abb. 13. Wenn ein Tachometer nicht
vorhanden ist, so kann man die Umdrehungszahl der Haupt-
welle messen, indem man den Sekundenzeiger der Uhr und
die Anzeige des Gruppenzählers im Chiffrator bei auto-
matischer Arbeit der Maschine benutzt. In diesem Falle
muß man der Anzahl der angezeigten Zeichen die Anzahl
der Wagenrückläufe mal 4 hinzufügen, da der Wagenrück-
lauf 4 Arbeitszyklen umfaßt. Um die Drehzahl der Haupt-
welle der Maschine zu bestimmen, ist es notwendig, die
in Zyklen/Minute bei automatischer Arbeit erhaltenen
Geschwindigkeit mit dem Koeffizienten 1,07, der die
Übersetzung von der Hauptwelle der Maschine zur Haupt-
welle des Transmitters des Dekombinators berücksichtigt,
malzunehmen.
Es ist zu bemerken, daß bei Betrieb vom Wechselstromnetz
eine Spannungsschwankung von ± 10% eine unbedeutende,
in der Größenordnung von 2%, Drehzahländerung der Haupt-
welle der Maschine hervorruft.
Bei Betrieb von einer Gleichstromquelle ist die Dreh-
zahländerung der Spannungsänderung der Stromquelle fast
proportional.
Pflege der Kontakte
Impulskontakt
Der Impulskontakt öffnet und schließt unter Spannung
und zieht deshalb Funken. Die Kontaktpimpel des Impuls-
kontaktes sind aus Wolfram und für normale Arbeit muß
ein Kontaktdruck von 150 - 200 g vorhanden sein. Desgleichen
muß die Kontaktfläche sauber sein. Die in die Schaltung
eingebaute Funkenlöschstrecke verhindert beim Öffnen nicht
vollständig das Auftreten eines Funkens zwischen den Kon-
takten, deshalb oxydiert mit der Zeit die Kontaktober-
fläche und leitet schlecht. Unter solchen Bedingungen
kann der Impulskontakt die Ursache für das Fehlen des
Zeichenabdruckes sein, weil der Stromkreis der Elektro-
magneten unterbrochen ist. Damit eine einwandfreie Arbeit
des Impulskontaktes gewährleistet ist, ist es notwendig:
a) darauf zu achten, daß der Abstand zwischen den Kontak-
ten in der Stoppstellung der Hauptwelle 0,2 - 0,3 mm
nicht überschreitet, da die Vergrößerung des Abstan-
des zur Verringerung des Kontaktdruckes führt;
b) nicht zuzulassen, daß Öl auf die Kontaktstellen
kommt;
c) daß die Kontaktoberflächen möglichst parallel zuein-
ander liegen;
d) die Kontakte nach 100 - 120 Betriebsstunden mit
feinem Schleifpapier und sauberen Putzlappen zu rei-
nigen.
Kontakte der Tastatur
Die Kontakte der Tastatur sind aus Silber. Sie schalten
nicht unter Spannung um, und deshalb ziehen sie keinen
Funken. Die Schicht von Silberoxyd, die sich im Laufe der
Zeit auf den Kontakten bildet, verhindert nicht den nor-
malen Stromfluß, der nur unterbrochen werden kann, wenn
die Kontaktoberflächen durch Öl, Staub usw. verschmutzt
sind. Sind saubere Kontaktflächen und der nötige Kon-
taktdruck (40 - 80 g) vorhanden, so ist für lange Zeit eine
einwandfreie Arbeit der Kontakte der Tastatur gewähr-
leistet.
Bei Betrieb der Maschine ist es notwendig:
a) nicht zuzulassen, daß sich Öl und Schmutz auf die
Kontaktflächen setzen;
b) damit die Maschine einwandfrei arbeitet, nach 500 -
600 Betriebsstunden die Kontaktoberflächen zu rei-
nigen, indem man einen Stoffstreifen (Leinen, Nessel)
in Spiritus taucht und zwischen den Kontaktflächen
bei geschlossenen Kontakten durchzieht;
c) nicht Kontaktfeilen und Sandpapier für die Reinigung
der Silberkontakte zu verwenden, da es zum schnellen
Verschleiß der Kontakte, damit zur Verringerung des
Kontaktdruckes und letzten Endes zum Ausfall der Kon-
taktgruppe führt.
Übergangskontaktleisten
Die Kontakte der Übergangskontaktleisten schaffen die
elektrische Verbindung zwischen den einzelnen Bau-
gruppen. Die Übergangskontaktleisten bestehen aus festen
Kontakten, die in Kunststoff eingepreßt sind und gefeder-
ten Kontakten. Die Kontaktoberflächen sind zur Verhütung
einer Oxydation mit Silber überzogen. Da die Kontakte
immer fest aneinander gedrückt sind, so ist ein Da-
zwischenkommen von Schmutz nicht möglich. Öl kann eben-
falls zu keiner Stromkreisunterbrechung führen. Die Kon-
takte der Übergangskontaktleisten gewährleisten lange
Zeit eine einwandfreie Arbeit. Bei teilweisen oder voll-
ständigem Auseinanderbau der Maschine ist es notwendig,
vor dem Zusammenbau die Kontakte mit einem in Spiritus
getauchten, sauberen Lappen zu putzen. Die Verwendung
von Sandpapier zum Reinigen der Kontakte ist untersagt, da
dann der Silberüberzug abgerieben wird.
Die Kontakte der Kontaktleisten und des Betriebsarten-
umschalters
Die Konstruktion dieser Kontakte ist genauso wie die
der Übergangsstecker.
Die Kontaktoberflächen dieser Kontakte werden bei der
Arbeit auf Grund der gegenseitigen Reibung gereinigt.
Die Arbeit der Kontaktpaare erfolgt, nachdem die reiben-
den Oberflächen geschmiert wurden. Es ist notwendig, nach 30 -
40 Betriebsstunden den Ölfilm auf den Kontaktleisten zu
erneuern. Der alte Ölfilm wird durch mit Spiritus ge-
tränkten Mull oder Leinen entfernt. Im Betriebsarten-
umschalter ist es notwendig, den Ölfilm einmal innerhalb
von 6 Monaten zu erneuern. Der Ölfilm ist in einer dünnen
Schicht (Größenordnung 0,1 - 0,2 mm) gleichmäßig auf der
ganzen Kontaktoberfläche der Stecker und Leisten mit den
flachen Kontakten aufzutragen.
Als Schmiermittel können säurefreie technische Vase-
line oder andere Fette benutzt werden, die einen nor-
malen Betrieb im gegebenen Temperaturbereich von +2°C
-+ 50°C gewährleisten.
Bemerkung: Es ist verboten, die Maschine bei geöffneten
Kontaktleisten KL einzuschalten.
Pflege des Elektromotors SL-369 U/A1
Die Pflege des Elektromotors schließt praktisch die
Kontrolle der Arbeitsfläche des Kollektors und der
Kohlebürsten ein. Die Kontrolle des Zustandes des
Kollektors ist regelmäßig nach 80 - 100 Betriebsstunden
durchzuführen. Eine verschmutzte Kollektoroberfläche
ist mit in Spiritus angefeuchtetem Mull oder Leinen zu
säubern. Bei starkem Abbrennen des Kollektors ist es
zulässig, den Kollektor mit feinem Sandpapier abzureiben
und danach mit einem Mullappen, der mit Spiritus ge-
tränkt ist, zu säubern. In dem Maße, wie sich die Bür-
sten abschleifen, ist es notwendig, die Kappe mit dem
Schlitz, die sich auf dem Bürstenhalter befindet, an-
zuziehen. Bei normalem Betrieb des Elektromotors
werden die Bürsten nach ungefähr 500 Betriebsstunden
ausgewechselt. Das Arbeiten mit Barsten einer Länge
von weniger als 6 mm ist untersagt. In einwandfreiem
Zustande des Elektromotors beobachtet man schwache
Funken an der ablaufenden Kante der Bürste. Im Falle des
Auftretens starker Funken ist es notwendig, den Elektro-
motor auszuwechseln und die Störungsursache fest zustellen.
Nach Auswechseln der Bürsten ist es wünschenswert, die
Bürsten auf dem Kollektor einlaufen zu lassen, indem man
den Motor 8 Stunden leer laufen läßt.
Pflege der Elektromagnete
Die Elektromagnete des Selektionsdruckwerkes und der
Elektromagnet des Zeichenzählwerkes mit Zwischenraum-
geber erfordert nur das Schmieren der Stangen an der
Stelle ihres Durchganges durch die Buchsen des Joches.
Infolgedessen, daß der Zugang zu den Schmierstellen der
Elektromagnete auf Grund ihrer engen Anordnung sehr
schwierig ist, ist die Schmierung während des vollstän-
digen Auseinanderbauens der Maschine vorzunehmen.
Als Schmiermittel wird ein Fett, das in einer dünnen
Schicht aufgetragen wird, empfohlen.
Wartung der mechanischen Baugruppen der Maschine
Um eine lange, fehlerfreie Arbeit der Maschine zu ga-
rantieren, müssen die mechanischen Bauteile regelmäßig
gesäubert und die sich reibenden Flächen geölt werden.
Es ist notwendig, die Maschine vor Staub zu schützen,
da sich dadurch der Verschleiß der sich reibenden Teile
erhöht. Alle Teile der Maschine, die keinen korrosions-
festen Überzug besitzen und brüniert oder chemisch ge-
schwärzt wurden, müssen sich unter einer dünnen Schicht
von Fett befinden. Es ist notwendig, auf die Sauberkeit
der Führungsgabeln für das Farbband und der Buchstaben-
führung zu achten, da ein Verschmutzen durch Papierstaub
zur Gleichmäßigkeit des Abdruckes führt. Das Säubern
der Typen erfolgt durch Bürsten, die mit Benzin ange-
feuchtet sind und dadurch wird die Maschine vor Ver-
schmutzung bewahrt.
Die Maschine muß regelmäßig gesäubert und abgeschmiert
werden. Schmiermittel sind technische Vaseline und Fern-
schreibermaschinenöl.
Die Art der Schmierung und die Häufigkeit sind auf den
Zeichnungen angegeben.
a) Ölen nach 40 - 50 Betriebsstunden -
b) Ölen nach 120 - 150 Betriebsstunden -
Regeln für das Abschmieren
1. Alle Zahnräder und Getriebe des Motors der Maschine
werden nach 120 - 140 Betriebsstunden eingefettet.
Das verbrauchte Fett wird mit einem Pinsel oder
einer Bürste, die mit dem Lösungsmittel für das ver-
wendete Fett getränkt sind, entfernt. Das neue Fett
wird mit Pinsel oder Bürste dünn aufgetragen.
2. Für das Abschmieren der Kugellager der Maschine ist
ein Fett zu verwenden. Die Kugellager müssen nach
Betriebsmonaten eingefettet werden. Das Auswaschen
der Kugellager erfolgt im Lösungsmittel. Nach dem
Auswaschen ist es notwendig, sich vom leichten Gang
des Kugellagers zu überzeugen. Das neue Fett wird
mit einem Metall- oder Holzspan in den Käfig ge-
drückt, bis dieser völlig gefüllt ist.
Anmerkung: Das Fetten wird in den beiliegenden Zeich-
nungen nicht angegeben,
3. Es ist nicht ratsam, sehr. stark zu ölen. Im allge-
meinen bezieht sich das auf Teile der Maschine, die
in jedem Zyklus arbeiten und während der Arbeit
einer hohen Beschleunigung ausgesetzt sind, z.B.
Rollen, die auf den Nocken laufen, Achsen, die die
Bauteile vereinigen usw. Ein Überschuß an Öl wird
bei den ersten Arbeitszyklen der Maschine aus der
Schmierstelle herausgeschleudert und führt nur zur
Verschmutzung der Maschine mit Öl.
Das ölen dieser Stellen ist mit der im Werkzeug ent-
haltenen Nadel mit abgeplatteten Ende vorzunehmen, in-
dem man an die Schmierstelle eine geringe Menge Öl bringt
und den Überschuß durch trocknen Mull oder trockenen
Lappen entfernt. Ein Beispiel der Anwendung der Nadel
ist in Abb. 45 gezeigt. Rinnen zum Ölen, die einige Bau-
teile besitzen, sind mit roter Farbe gekennzeichnet. Im
weiteren wer den die wichtigsten Schmierstellen der Bau-
gruppen angeführt.
Schmierung des Selektionsdruckwerkes
Beim Abschmieren der Bauteile des Selektionsdruckwerkes
ist es notwendig, den Wagen abzunehmen. Die wichtigsten
Schmierstellen sind auf Abb. 42 und 64 angeführt.
Schmierung des Antriebes
Die Schmierstellen der Bauteile des Antriebes sind auf
Abb. 41, 43, 58 und 59 angeführt.
Schmierung des Transmitters und des Dekombinators
Die Schmierstellen sind auf Abb. 44, 46, 47, 73, 74, 75
dargestellt. Zum Abschmieren der Schienen des Dekombina-
tors muß man die Maschine kippen. Zum Schmieren der
inneren Teile des Transmitters (Hebel, Rollen, Start-
Stopp-Kupplungen u.a.) ist es notwendig, den Deckel
vom Transmitter und den der linken Seite der Grundplatte
abzunehmen.
Schmierung des Automatikantriebes
Im Automatikantrieb sind alle 40 - 50 Betriebsstunden
die Rollen der Hebel, die auf den Nocken laufen, zu
schmieren.
Schmierung der Teile der Grundplatte und der Tastatur
Die Schmierstellen sind auf Abb. 49 dargestellt.
Schmierung des Lochers
Die Schmierstellen sind auf Abb. 43 dargestellt.
Schmierung des Chiffrators
Die Schmierstellen sind auf Abb. 31, 81, 84 dargestellt.
Schmierung des Wagens
Die Schmierstellen sind auf Abb. 16, 18 dargestellt.
VI. Auseinanderbauen, Zusammenbauen und Justieren
der Maschine
A. Auseinanderbauen
In diesem Teil wird der Auseinanderbau der Maschine
in Baugruppen behandelt mit dem Ziel, den Zugang zu
den mechanischen Bauteilen zu erleichtern, wenn es
notwendig ist, ein Teil zu ersetzen oder eine Störung
zu beseitigen. Das völlige Auseinandernehmen der Bau-
gruppen erfordert das Hinzuziehen eines qualifizierten
Mechanikers und wird bei Abwesenheit eines solchen
nicht empfohlen.
Alle Baugruppen können in einer bestimmten Reihen-
folge von der Maschine entfernt werden.
Es wird empfohlen, den vollständigen Auseinanderbau
der Maschine in der angeführten Reihenfolge vorzu-
nehmen :
a) Gehäuse
b) Wagen
c) Stromversorgung
d) Chiffrator
e) Tastatur
f) Transmitter mit Dekombinator
g) Locher
h) Automatikantrieb
i) Antrieb
j) Selektionsdruckwerk
k) Filter
Falls es notwendig ist, können die Tastatur, der Trans-
mitter mit dem Dekombinator, der Locher, die Stromversor-
gung, der Filter von der Maschine abgenommen werden, ohne
daß andere Baugruppen außer dem Gehäuse, das in jedem
Falle abgenommen wird, entfernt werden müssen.
Der Wagen kann ohne Abnehmen des Gehäuses entfernt
werden.
Gehäuse
Den Wagen nach links schieben. Den vorderen, hinteren
und rechten Deckel des Gehäuses öffnen. Den Wagen in das
so gebildete Fenster des Gehäuses stellen. Die zwei
Kordelschrauben, die rechts und links liegen und durch
die das Gehäuse an der Grundplatte befestigt wird, lösen
und in den man das Gehäuse hochhebt, es von der Grundplatte
entfernen.
Wagen
Den Riegel, der in die linke Seite der Grundplatte des
Wagens eingreift, zurückziehen und indem man den Wagen
an den Drehknöpfen der Walze anfaßt, hochheben bis die
Führungsbolzen des Wagens aus der Führung des Selektions-
druckwerkes her auskommen. Beim Abnehmen des Wagens ohne
vorheriges Entfernen des Gehäuses ist der vordere und
hintere Deckel des Gehäuses zu öffnen und indem man den
Riegel zurückschiebt, der in die linke Seite der Grund-
platte des Wagens eingreift, den Wagen wie oben be-
schrieben abnehmen.
Stromversorgung
Die 4 unverlierbaren Schrauben herausdrehen, ohne zu
Verkanten, damit die Messer der Messerleiste nicht
beschädigt werden, die Stromversorgung entlang den zwei
Führungsbolzen von der Grundplatte abziehen.
Chiffrator
Für das Abnehmen des Chiffrators Abb. 48 ist es notwen-
dig:
a) den Betriebsartenumschalter auf K zu stellen;
b) die Schraube (3) (8M 2,6 x 6) ein bis zwei Gewinde-
gänge herauszudrehen;
c) die Leiste (2) zu entfernen;
d) die Zugstange (1) mit dem Finger des Hebels (4)
auseianderzuhaken;
e) die unverlierbaren Schrauben M5 herauszudrehen;
f) vorsichtig, indem man den vorderen Teil des Chiffra-
tors bis an die Streifenführung des Dekombinators
hebt, die Baugruppe zu sich zurückzuführen, sie außer
Eingriff mit dem Antrieb zu bringen, den Hebel für
die Rückführung aus der Öffnung der Grundplatte
herauszuziehen und indem man fortsetzt den vorderen
Teil zu heben, die Grundplatte mit der Übergangs-
kontaktleiste unter der Auslöseachse des Lochers
herauszuziehen;
g) den Chiffrator auf schon bereit gelegte Holzleisten
(20 x 30 x 150) legen. Sind diese nicht vorhanden,
lege man den Chiffrator mit der vorderen Platte nach
unten auf den Tisch.
Tastatur
Für das Abnehmen der Tastatur ist es notwendig:
a) den Papierabfallkasten zu entleeren (wie in allen
Fällen, wenn die Maschine gekippt werden muß);
b) auf die Führungsbuchse der Stange des Druckbügels
die Stützhülse zu setzen (siehe Werkzeugkasten Platz
10);
c) die Maschine an der Verkleidung anfassen und kippen;
d) die 7 Schrauben 5M 3 x 6, die die große Bodenplatte
halten, zu lösen und die Bodenplatte abzunehmen;
e) die 5 Schrauben 5 M 3 x 6, die die kleine Bodenplatte
von unten an der Verkleidung befestigen, zu lösen
und sie abzunehmen;
f) die Kassette aus den Führungsschienen herauszu-
ziehen;
g) mit dem Schlüssel S=11 die Kontermuttern M6 an den
Anschlagschrauben (14) zu lösen und diese herauszu-
schrauben Abb. 49;
h) die 4 Schrauben 8M 4 x 10 herauszuschrauben und die
Verkleidung abzunehmen;
i) die Schraube an der Zugstange (80) Abb. 2 herauszu-
drehen, den Riegel abzunehmen und den Finger, der die
Zugstange mit dem Hebel (81) verbindet, herauszuziehen;
j) die zwei Schrauben (9) (8M 2,6 x 4), die die Zugstange
(10) Abb. 49 zusammenhalten, herauszudrehen;
k) die Schraube (16) 8M 2,6 x 5 herauszudrehen;
l) die Schraube (12) herauszudrehen;
m) die 2 Schrauben 8M 3 x 8 herauszudrehen und die Füh-
rung abzunehmen;
n) die Feder (19) auszuhängen;
o) die Schraube (25) herauszudrehen und die Zugstange
(24) abzunehmen;
p) den Hebel (102) und (105) Abb. 2 auszuhaken;
q) die 5 Schrauben 8M 4 x 12 herauszudrehen und vorsich-
tig, ohne die Stifte zu beschädigen, die Tastatur
von der Maschine abzunehmen.
Entfernen des Transmitters mit Dekombinator
Für das Abnehmen der Baugruppe ist notwendig :
a) die zwei Schrauben zu lösen, die die Platte des
Dekombinators befestigen und die Platte abzunehmen;
b) die Feder (4) Abb. 49 auszuhängen;
c) die Achse 3 herauszudrehen und die Stange (6) zu ent-
fernen;
d) die 5 Schrauben 8M 4 x 12 herauszudrehen. Vorsichtig
von den Stiften die Baugruppe abheben und von der
Grundplatte abnehmen.
Locher
Zum Abnehmen des Lochers ist notwendig :
a) Lösen der elektrischen Verbindung des Elektromagneten
des Lochers;
b) Lösen der zwei Schrauben 8M 2,6 x 8 und die Leiste
über den Zugstangen, die die Auflagestücke des Lochers
mit den Schienen des Kombinators verbinden, abnehmen;
c) Herausdrehen der 4 Schrauben 8M 4 x 12, mit denen der Lochers
an der Grundplatte befestigt ist. Vorsichtig,
ohne die Stifte zu beschädigen, die Baugruppe anheben
und aus der Streifenführung herausziehen.
Automatikantrieb
Zum Abnehmen des Automatikantriebes ist notwendig:
a) Herausdrehen der zwei Schrauben und Abnehmen der
Halterung des Kontaktes (1) Abb. 22;
b) die Maschine in Arbeitsstellung bringen;
c) Herausdrehen der 4 Schrauben 8M 4 x 12, mit denen
der Automatikantrieb an der Grundplatte befestigt ist;
d) vorsichtig, ohne die Stifte zu beschädigen, die
Baugruppe anheben, die Zahnräder ausrasten, das
Selektionsdruckwerk eingreifen und aus der Öffnung
der Grundplatte herausführen.
Antrieb
Zum Abnehmen des Antriebes ist notwendig:
a) Lösen der zwei Schrauben 8M 3 x 10 der rechten
Halterung und der zwei Schrauben 8M 3 x 10 der
linken Halterung der Auslöseachse des Lochers;
b) Aushängen der Feder vom Einschalthebel des Lochers;
c) Abnehmen der Halterung mit der Auslöseachse des
Lochers von den Stiften;
d) Aushängen der Zugstange (15), die die Sperrvorrich-
tungen am Antrieb mit dem Selektionsdruckwerk ver-
bindet (Abb.58);
e) Herausdrehen der zwei Schrauben und Abnehmen der
Halterung mit der Zugstange (15);
f) Herausdrehen der drei Schrauben 8M 5 x 12, mit denen
der Antrieb an der Grundplatte befestigt ist. Vor-
sichtig, ohne die Stifte zu beschädigen, die Bau-
gruppe anheben und aus der Grundplatte herausziehen.
Selektionsdruckwerk
Zum Abnehmen des Selektionsdruckwerkes ist notwendig:
a) die Maschine zu kippen;
b) die zwei Schrauben zu lösen und die Streifenführung
zu entfernen;
c) Herausdrehen der Schraube (4), mit der die Zugstange
(7) am Hebel (2) des Selektionsdruckwerkes Abb. 52
befestigt ist;
d) Aushängen der Feder (3);
e) Herausdrehen der 5 Schrauben 8M 5 x 12, mit denen das
Selektionsdruckwerk an der Grundplatte befestigt ist.
Vorsichtig, ohne die Stifte zu beschädigen, die Bau-
gruppe abnehmen.
Filter
a) Herausdrehen der 6 Schrauben 2M 3 x 6, mit denen die
hintere Platte an der Grundplatte befestigt ist und
Abnehmen derselben;
b) Herausdrehen der drei Schrauben 8M 4 x 10, mit denen
der Filter an der Grundplatte befestigt ist und, indem
die Steckerverbindung gelöst wird, den Filter abnehmen.
B. Zusammenbau
Einbau des Selektionsdruckwerkes
Der Zusammenbau beginnt mit der Montage des Selektions-
druckwerkes. Das Druckwerk wird mit seinen Führungs-
stiften in die Führung der Grundplatte eingesetzt und
muß glatt auf der Grundplatte aufsitzen. Danach wird
es mit den 5 Schrauben 8M 5 x 12 befestigt. Die Zugstange
(7) mit dem Hebel (2) verbinden und die Schraube (4)
einschrauben Abb. 52. Die Feder (3) am Hebel (2) ein-
hängen.
Aufsetzen des Antriebes
Beim Aufsetzen des Antriebes ist darauf zu achten, daß die
Führungsstifte am Gehäuse des Antriebes mit der Führung
in der Grundplatte zusammenfallen. Die Rolle des Druck
hebels im Selektionsdruckwerk muß sich an den Druckex-
zenter der Hauptwelle legen, der Finger des Auslösehebels
aber muß in den Zwischenhebel in der Grundplatte ein-
greifen. Der Finger des unteren Hebels der vertikalen
Achse der Sperrvorrichtung am Antrieb muß in die Gabel
des zweiarmigen Hebels (26) Abb. 49 eingreifen. In dieser
Lage wird der Antrieb mit den drei Schrauben 8M 5 x 12
befestigt.
Einhängen der Zugstange (15), die die Sperrvorrichtung
am Antrieb mit dem Selektionsdruckwerk Abb. 58 verbindet.
Einbau des Automatikantriebes
Beim Aufsetzen des Automatikantriebes ist es notwendig,
die Zahnräder des Automatikantriebes und des Selektions-
druckwerkes mit ihren Marken aufeinander einzustellen.
Auf jedem dieser Zahnräder sind Markierungen vorhanden.
Vor dem Befestigen dieses Antriebes muß in die Kardan-
gabel des Automatikantriebes und in die Zwischenwelle des
Antriebes die Kardanwelle gesteckt werden. Nur, nachdem
man sich von der richtigen Stellung der Zahnradübersetzung
überzeugt hat, kann der Automatikantrieb mit den 4
Schrauben 8M 4 x 12 befestigt werden. Danach wird die
Halterung mit der Kontaktgruppe befestigte Dabei ist das
Gelenk der Auslösevorrichtung des Automatikantriebes
mit dem Gleitstück, das vom Streifentransportknopf
(Dauer) arbeitet, zu kontrollieren. Dazu genügt es, den
Streifentransportknopf zu drücken, um sich davon zu
überzeugen, daß die Start-Stopp-Kupplung des Lochers
eingedrückt wird (wenn die Stromzuführung schon montiert
ist).
Nach Einbau des Automatikantriebes muß die Auslöseachse
für die Locherkupplung eingebaut werden. Die Achse mit
den Halterungen wird mit den Stiften in die Führung der
Grundplatte eingesetzt. Die Halterungen werden wie
folgt befestigt: die linke mit zwei Schrauben 8M 3 x 8,
die rechte mit zwei Schrauben 8M 3 x 10.
Einbau des Lochers
Beim Einbau des Lochers ist es notwendig, das Ende der
Streifenführung, das aus der Grundplatte herausragt, in
die Streifenführung des Lochers zu schieben und bei
Übereinstimmung der Führungsstifte des Lochers mit den
Führungen der Grundplatte den Locher bis zum festen An-
liegen an die Grundplatte herunterdrücken. Die richtige
Stellung der Hebel des Lochers in Bezug auf die Nocken
des linken Ständers des Selektionsdruckwerkes überprüfen
und den Locher mit den vier Schrauben 8M 4 x 12 befestigen.
Danach die Zugstangen der Ansatzstücke des Lochers mit
den Hebeln der Wählschienen des Lochers verbinden und
die Leiste an ihren Platz, an dem sie eine sichere Ver-
bindung der Zugstangen mit den Hebeln gewährleistet,
anordnen. Der Abstand zwischen den Zugstangen und der
Leiste soll 0,1 - 0,2 mm betragen. Die Leiste wird mit
den zwei Schrauben 8M 2,6 x 8 befestigt. Die Enden der
Wicklung des Elektromagneten sind an die Klemmen der
Klemmleiste anzuschließen.
Einbau des Transmitters mit dem Dekombinator
Beim Einbauen des Transmitters muß die Maschine in ge-
kippter Stellung bleiben. In die Kardangabel des Auto-
matikantriebes muß die Kardanwelle (8) Abb. 49 eingeführt
werden. Danach vorsichtig den Transmitter mit dem De-
kombinator von oben in die Öffnung der Grundplatte
führen, wobei das zweite Ende der Kardanwelle (8) in die
Kardangabel des Transmitters eingreifen muß. Den Trans-
mitter bis zum festen Anliegen an die Grundplatte her-
unterdrücken. Die Stifte des Transmitters und des Dekom-
binstors müssen in ihre Führungen gehen; danach kann die
Baugruppe mit den Schrauben 8M 4 x 12 befestigt werden.
Die Stange (6) wird angebracht und die Schraube (3) ein-
geschraubt. Die Feder (4) ist einzuhängen Abb. 49.
Einbau der Tastatur
Beim Einbau der Tastatur verbleibt die Maschine in ge-
kippter Stellung. Der Einbau der Baugruppe geschieht
folgendermaßen:
a) der Betriebsartenumschalter wird auf K gestellt;
b) die Achse des Betriebsartenumschalters in der
Tastatur in eine solche Stellung bringen, daß die
Markierungen der Zahnräder (20) und (21) zusammen-
fallen Abb. 49;
c) den Hebel (81) Abb. 2 in die Aussparung des Fußes des
Hebels (80) führen.
d) die Tastatur einschieben und mit den Schrauben be-
festigen;
e) den Finger einsetzen und mit einer Schraube den
Riegel am Fuß der Zugstange befestigen;
f) die Zugstangen (15) und (17) miteinander verbin-
den, indem sie mit der Schraube (16) 8M 2,6 x 5
Abb. 49 befestigt werden
g) die Zugstange (10) mit dem Zwischenhebel des Trans-
mitters am Dekombinator verbinden und mit den zwei
Schrauben 8M 2,6 x 4 befestigen;
h) die Zugstange (13) mit dem Sperrhebel des Trans-
mitters durch die Schraube (12) verbinden;
i) die Führung einbauen und mit den zwei Schrauben
8M 3 x 8 befestigen;
j) die Zugstange (24) einsetzen, mit der Schraube (25)
und der Kontermutter 7M 2,6 befestigen;
k) die Feder (19) einhängen;
l) die Verkleidung aufsetzen und mit den vier Schrauben
8M 4 x 10 befestigen;
m) Einschrauben der zwei Schrauben (14) bis sie die
Grundplatte der Tastatur berühren. Sicherung durch
Kontermuttern.
n) die Maschine in Arbeitsstellung bringen;
Einbau des Chiffrators
Beim Einbau des Chiffrators muß der Betriebsartenum-
schalter auf K stehen; die Zwischenwelle des Transmitters
am Chiffrator und die Nockenwelle der KSV müssen so
stehen, daß die Markierungen an den Zahnrädern zusammen-
fallen Abb 30.
Nachdem dies überprüft wurde, kann der Chiffrator ein-
gebaut werden. Beim Einbau ist notwendig :
a) das Übereinanderstehen der Markierung an der Zahn-
radübertragung der Rückführvorrichtung des Chiffra-
tors und der Hauptwelle der Maschine Abb. 54;
b) der richtige Eingriff des Zwischenrades in der Grund-
platte des Chiffrators in die Zahnstange des Betriebs-
artenumschalters in der Grundplatte der Maschine. Bei
richtigem Eingriff der Zähne und befestigtem Chiffrator
werden sich die Stellungen des Betriebsartenumschalters
und die Markierung an den Zahnrädern entsprechen.
c) Zusammentreffen der gefederten Kontakte der Über-
gangskontaktleiste der Grundplatte mit den Kontakten
der Übergangskontaktleiste am Chiffrator. Dieses Zu-
sammentreffen wird gewährleistet, wenn der Chiffra-
tor bei der Montage auf die Grundplatte bis an die
Anschläge geführt wird, die mit Schrauben befestigt
und mit der Grundplatte der Maschine verstiftet sind.
Es wird empfohlen, die Anschläge nicht abzunehmen.
d) das Einhaken der Zugstange (1) in den Finger des He-
bels (4) Abb. 48;
e) die Stellung des Hebels (13) auf dem großen Radius
des Nockens (14) Abb. 51.
Nachdem der richtiges Einbau Überprüft wurde, ist die
Baugruppe mit den 5 unverlierbaren Schrauben M5 zu
befestigen.
Einbau der Stromversorgung
Die Stromversorgung auf die 4 Führungsbolzen der Grund-
platte setzen und sie mit den 4 Schrauben befestigen.
Einsetzen des Wagens
Den Wagen in beide Hände nehmen, die Führungsbolzen
des Wagens in die Führungsbuchsen des Ständers des
Selektionsdruckwerkes einführen und langsam herunter-
lassen. Das Eingreifen der Bolzen (5) in die Öffnungen
der Räder (4) Abb. 16 des rechten Ständers des Selek-
tionsdruckwerkes ist zu gewährleisten. Gleichzeitig
muß der obere Arm des Hebels (2) Abb. 52 in die Aus-
gangssparung der Leiste (10) Abb. 18 des Wagens ein-
fallen.
C. Einregulierung der Maschine
1. Einregulierung des Auslösesystems der Hauptwelle
Die Einregulierung erfolgt in 3 Etappen.
Zuerst ist der Auslösebügel (25) Abb. 55 richtig ein-
zustellen. Dazu ist erforderlich :
a) die Maschine zu kippen und die Verkleidung abzu-
nehmen
b) den Betriebsartenumschalter auf K zu stellen
c) durch Drucken auf einen beliebigen Typenhebel
oder unmittelbarer Einwirkung auf Hebel (18) Abb.55
die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle (1) ein-
zurasten.
d) durch Drehen an der Kappe des Fliehkraftreglers
am Elektromotor die Hauptwelle in die in Abb. 53
gezeigte Stellung zu bringen. Dabei muß die Rolle
(3) des Hebels (8) auf dem Nockenberg (2) liegen.
e) Die beiden Kontermuttern auf der Zugstange (23) Abb.
49 sind zu lockern und durch Drehen des Zugstangen-
gewindes ist der Spielraum zwischen dem Gleitstück
(26) Abb. 55 und dem Führungskamm (27) auf 0,2 bis 0,3
mm zu bringen.
Dabei ist vor allem auf das Gleitstück des rechten Teils
der Tastatur zu achten.
Liegt der Bügel (25) der Tastaturplatte nicht mehr parallel
gegenüber, so haben die Gleitstücke des linken Teils der
Tastatur einen zu großen Spielraum gegenüber dem Kamm
(27) oder gar keinen. In diesem Falle ist durch Lockern
der Kontermuttern (4) und (10) die Zugstange (9) soweit
zu drehen, bis der Spielraum zwischen dem Kamm (27) und
dem Gleitstück (26) auf der gesamten Kammlänge gleich
ist. Nach Einstellen des Auslösebügels wird der Auslöse-
hebel (16) und der Hebel (20) wie folgt eingestellt :
a) die beiden Schrauben (1)) (SM) x 5) mit dem Exzenter
(14) mit einem Uhrmacherschraubenzieher lockern und
den Hebel (20) ein wenig über die Nase des Hebels
(18) bringen, der sein freies Einfallen in den Hebel
(20) (0,1 - 0,2 mm) gewährleistet und den Hebel (20)
mit den Schrauben (1)) sichern.
b) die Schraube (8M 2 x 6) lockern und durch Drehen des
Exzenters der auf den Hebel (16) wirkt, die Größe
des Eingriffes des Hebels (20) zum Hebel (15) ein-
stellen. Praktisch wird dieser Wert auf 0,5 mm ge-
stellt (Abb.55). Nach Beendigung der Einregulierung
ist die Schraube SM 2 x 6 anzuziehen.
Das letzte Glied in diesem System ist der Auslösehebel
und der Auslöserahmen.
Zur richtigen Einstellung des Auslöserahmens ist erforder-
lich:
a) die Kontermutter (2) 7M 2,6 Abb. 56 zu lösen und durch
die Schraube (1) SM 2,6 x S den Zwischenraum zwischen
dem Auslöserahmen und der Tastaturplatte auf 1,2 mm
stellen.
b) die Kontermutter (2) anziehen.
In dieser Stellung des Auslöserahmens muß zwischen dem
Auslösehebel (5) und dem Hebel (9) ein kleiner Spiel-
raum vorhanden sein, der das Einfallen des Auslösehe-
bels (5) in den Hebel (9) gewährleistet (ein Spielraum
von 0,1 bis 0,2 mm genügt). Zum Einstellen des erforder-
lichen Spielraumes muß die Kontermutter (7) gelockert
und mit dem Exzenter (8) durch Links- und Rechtsbewegung
des Hebels (5) der erforderliche Spielraum eingestellt
werden. Die Kontermutter (7) ist anzuziehen.
Sollte die Einstellung durch den Exzenter nicht möglich
sein, ist es erforderlich :
a) den Exzenter in Mittelstellung zu bringen
b) die Schraube der Lasche zu lockern und den Auslöse-
hebel (5) durch Drehen des Hebels auf dem Zapfen des
Auslöserahmens (4) an den Hebel (9) heranzufahren.
Die Schraube der Lasche (6) ist anzuziehen.
c) die Kontermutter (7) zu lösen und die Einstellung,
wie oben beschrieben, durch den Exzenter zu Ende
zu führen.
Die Richtigkeit der Einstellung wird wie folgt über-
prüft :
Durch Drehen des Rotors des Elektromotors an der Kappe
des Reglers wird die Hauptwelle in Stoppstellung ge-
bracht. Durch Drücken auf eine beliebige Taste erfolgt
die Auslösung, und durch erneutes Drehen am Regler wird
die Hauptwelle in Stoppstellung gebracht.
Das Einrasten der Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle
beim Drücken auf eine Taste der Tastatur und das Aus-
rasten der Kupplung am Ende eines Zyklus zeugen von
der richtig vorgenommenen Justierung.
2. Einstellen der Wagenauslösung
Vor dem Einstellen ist es notwendig:
a) die Maschine in Arbeitsstellung zu bringen;
b) den Arbeitsumschalter auf "B" zu stellen;
c) den Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen;
d) den Wagen auf Zeilenanfang in rechte Ausgangsstellung
zu bringen.
Nach Drücken auf eine beliebige Taste der Tastatur die
Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle einrasten und eine
volle Umdrehung vollführen. Bei richtiger Einstellung
muß die Weiterschaltung des Wagens um einen Schritt er-
folgen.
Geht die Weiterschaltung im Verlauf der Umdrehung der
Hauptwelle nicht vonstatten, so muß die Hauptwelle durch
Einrasten der Start-Stopp-Kupplung noch einmal ausgelöst
und die Arbeit des Hebels (1) Abb. 57 verfolgt werden.
Befindet sich der Hebel (16) Abb. 13 auf dem Nockenberg
(17), muß der Hebel (1) Abb. 57 über den Hebel (2) am
Wagen die Weiterschaltung vornehmen. Bei ungenügendem
Hub des Hebels (1) sind die Kontermuttern (3) und (5) der
Schaltstange (4) zu lösen und durch Drehen der letzteren
den Hebel (1) in eine Stellung zu bringen, die ein An-
sprechen der Hebel an der Fortschaltvorrichtung des Wa-
gens gewährleisten. Danach ist die Schaltstange (4)
durch die Kontermuttern (3) und (5) zu sichern. Nach er-
folgter Einstellung ist die Wagenweiterschaltung einige
Male zu überprüfen, indem der Rotor des Elektromotors
am Fliehkraftregler von Hand aus gedreht wird. Die Ma-
schine wird dann an das Netz angeschlossen und die
Hauptwelle.zeichenweise ausgelöst. Die Wagenweiterschal-
tung wird bei eingeschaltetem Antrieb überprüft.
3. Einstellung der Steuerung der Kupplung für Wagenrücklauf
Da diese mechanische Baugruppe außer der Steuerung der
Kupplung für Wagenrücklauf die Sperrung der Tastatur
während des Wagenrücklaufs steuert, wird ihre Justie-
rung in 2 Stufen vorgenommen:
A. Einrasten und Ausrasten der Kupplung für Wagenrücklauf
Die Einstellung wird in folgender Reihenfolge vorgenommen:
a) den Wagen in rechte Ausgangsstellung bringen
b) den Strom einschalten
c) den Betriebsartenumschalter auf "K" stellen
d) den Arbeitsumschalter auf "B" stellen
e) ein Blatt in den Wagen einspannen
f) durch zeichenweises Anlaufen der Hauptwelle der Ma-
schine 57 Zeichen schreiben.
g) die Stellung der Rolle des Feststellhebels (13) am
Antrieb Abb. 58 und der Zugstange (20) am Selektions-
druckwerk überprüfen.
Nach Schreiben des 57. Zeichens muß sich die Rolle des
Hebels (13) in dem rechten Zahn des Übertragungshebels
(4) befinden und das gebogene Ende der Zugstange (20)
muß mit einem Spielraum von mindestens 0,1 bis 0,3 mm
von der rechten Seitenplatte (19) des Wagens entfernt
h) ist diese Stellung nicht gewährleistet, muß die Konter-
mutter (16) gelockert und die Zugstange vom Übertra-
gungshebel (4) getrennt werden. Durch Vergrößerung
oder Verringerung der Länge der Zugstange (20) ist
die erforderliche Stellung zu erreichen. Der Hebel
ist mit der Zugstange zu verbinden und die Mutter
(16) zu kontern. Die Einstellung wird bei ausgeschal-
teter Maschine vorgenommen.
i) durch Drehen am Regler ist die Start-Stopp-Kupplung
der Hauptwelle zweimal einzurasten (2 volle Zyklen)
bis zum Wagenrücklauf nach dem 59. Zeichen.
Nach Beendigung des Wagenrücklaufes im 59. Zyklus
schiebt sich die Zugstange (15) und der mit dieser
verbundene Übertragungshebel (4) nach links, der un-
tere Arm legt sich nach vollzogener Drehung entgegen
dem Uhrzeigersinn mit seinem linken Zahn gegen die
Rolle des Hebels (13) und wird durch ihn festgehalten.
Gleichzeitig muß der Sperrhebel (10) durch die untere
Schraube (5) soweit nach links geführt werden, daß
eine freie Drehung des Zwischenhebels (9) und die
Linksbewegung der Zugstange (17) unter der Spannung
der Feder (22) gewährleistet ist. Dadurch rastet die
Kupplung (21) ein, und der Wagenrücklauf beginnt.
Rastet die Kupplung nicht ein, muß die untere Schraube
(15) bis zum Einrasten der Kupplung eingeschraubt und
mit einer Kontermutter gesichert werden.
Daraufhin ist der Wagen um einige Zeichen nach rechts,
und der Anschlag (3) mit dem Hebel (2) in der gleichen
Richtung zu führen und nach Ausrasten der Kupplung
(21) erneut bei eingeschaltetem Antrieb und Zeichen
weisem Auslösen der Hauptwelle das Einrasten der
Kupplung für den Wagenrücklauf, sowie der Wagenrück-
lauf selbst zu kontrollieren. Am Ende des Wagenrück-
laufs führt der Wagen mit seiner rechten Seitenplatte
(19) Abb. 59 den Hebel (2) über den Anschlag (3)
nach rechts. Dabei kehrt der Übertragungshebel (4)
mit der Zugstange (20) durch die obere Schraube (5)
in seine Ausgangsstellung, die dem Zeilenanfang ent-
spricht, zurück.
Durch die Schraube (8) wird der Zwischenhebel im
Uhrzeigersinn gedreht und über die Zugstange (17)
und den Ausschaltehebel (18) wird die Kupplung (21)
ausgerastet. Der Sperrhebel (10) fällt unter Spannung
der Feder (11) in die Nase des Hebels (9) ein und
hält die Kupplung (21) ausgerastet mit einem Spiel
von 0,2 bis 0,3 mm von den Zähnen des Schraubenra-
des entfernt.
Nach Ausrasten der Kupplung (21) gelangt der Wagen
in Ausgangsstellung, nachdem er sich bis zum Zeilen-
Anfang nach links geschoben hat, und der Hebel (2)
legt sich auf den Exzenter (1).
B. Sperrung der Tastatur für die Zeit des Wagenrücklaufs
Um die Sperrung der Tastatur für die Zeit des Wagenrücklaufs
zu gewährleisten, ist es erforderlich, daß sich,
wenn sich die Kugel des Feststellers in der Vertiefung
des Hebels (29) befindet und zwischen dem Hebel (29)
und der Sperrschiene Abb. 55 ein Spielraum von 0,1 bis
0,2 mm besteht, die Rolle des Feststellhebels (13) Abb.
58 im äußersten Zahn des Übertragungshebels (4) befindet.
Ist dieses nicht gewährleistet, muß folgendes vorgenommen
werden:
a) die Mutter der Feststellschraube des Hebels (4) Abb.
59 auf der Achse lösen
b) durch Halten des Hebels (4) in mittlerer gesicherter
Stellung und Verschieben der Zugstange (30) Abb. 55
den Hebel (29) mit dem erforderlichen Spielraum an
die Sperrschiene bringen
c) den Hebel (4) Abb. 59 auf der Achse durch Anziehen
der Mutter befestigen.
Den Antrieb einschalten und die richtige Einstellung
bei der Arbeit überprüfen.
Bei richtiger Einstellung muß während des Wagenrücklaufs
die Tastatur gesperrt und ein Schreiben von Zeichen
unmöglich sein.
4. Einstellung der Zugstange des Tastenhebels "Wagenrücklauf"
Vor der Einstellung ist erforderlich :
a) den Wagen in die Stellung "Zeilenanfang" zu bringen;
b) die Maschine zu kippen;
c) die Kontermuttern (4) zu lösen Abb. 60;
d) durch Drehen der Stange (5) zwischen Zugstange (3)
und Mitnehmer (9) einen Spielraum von 0,2 bis 0,3 mm
einzustellen; e) die Kontermuttern (4) anzuziehen.
Bei richtiger Einstellung bewirkt ein Druck auf den
Hebel "Wagenrücklauf" das Einrasten der Kupplung für
Wagenrücklauf am Antrieb und das Anlaufen der An-
triebshauptwelle.
Gleichzeitig erfolgt eine Sperrung der Weiterschaltung
des Wagens.
5. Einstellung des Abwurfbügels
Wie stark das Zeichen einer Type angeschlagen wird,
hängt von der Stellung des Abwurfbügels ab. Der Abwurf-
bügel (13) Abb. 61 ist durch 4 Schrauben (9) gesichert
und kann durch Lösung der Schrauben auf den Bolzen (10)
verschoben werden. Das Verschieben des Bügels (13) nach
rechts erhöht die Deutlichkeit des Anschlages, ein Ver-
schieben nach links dagegen vermindert sie.
6. Einstellung des Elektromagneten des Selektionsdruckwerkes
Zur richtigen Einjustierung des Elektromagneten ist er-
forderlich :
a) Die Schraube (3) Abb. 61 um ein bis 2 Gänge heraus-
zudrehen.
b) Den Elektromagneten so einzustellen, daß der Freigabe-
hebel (4) 1,7 bis 2 mm über dem Stoßhebel (14) steht
und die Schraube (3) in dieser Stellung anziehen.
c) Überprüfen ob eine solche Einstellung ein freies Ver-
schieben der Schienen (16) des Kombinators gewähr-
leistet. Dazu ist bei abgeschaltetem Strom durch Druck
auf eine beliebige Taste der Tastatur die Start-Stopp-
Kupplung der Hauptwelle einzurasten und durch Drehen
am Regler des Antriebes bis zum Einrasten der Start-
Stopp-Kupplung des Lochers den Austritt der Schienen
des Kombinators verfolgen. Bei richtiger Einstellung
des Elektromagneten müssen alle Schienen des Kombina-
tors austreten und auf den Locher 5 Minuszeichen geben.
Tritt eine der Schienen nicht aus, muß diese durch Ver-
änderung der Stellung des Elektromagneten gelöst wer-
den.
7. Einstellung .der Auslösevorrichtung der Start-Stopp-
Kupplung des Lochers
Bei.ausgerasteter Start-Stopp-Kupplung des Lochers liegt
die Hebelrolle (2) Abb. 62 auf dem kleinen Radius des
Nocken (1) .
Der Hebel (6) Abb. 23 erfaßt den Zahn (7) der Start-
Stopp-Kupplung und greift 1,5 bis 2 mm ein. Beim Heben
der Hebelrolle (2) auf den Nockenberg (1) Abb. 62 muß
der Hebel (6) Abb. 63 vom Zahn (7) der Start-Stopp-Kupp-
lung einen Abstand von 0,1 bis 0,2 mm haben. Die Ver-
änderung des Zwischenraumes geht wie folgt vonstatten:
a) die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle wird einge-
rastet und der Nockenberg (1) Abb. 62 unter die
Auslöseachse (2) geschoben;
b) die Schraube (5) Abb. 63 wird um 0,5 bis 1 Umdrehung
zurückgedreht;
c) der Hebel (3) auf der Achse (4) wird in so eine
Stellung gebracht, die über den Hebel (11) den ge-
nannten Zwischenraum zwischen dem Hebel (6) und dem
Zahn (7) der Start-Stopp-Kupplung gewährleistet;
d) die Schraube (5) wird fest angezogen und die Ein-
stellung überprüft.
Der Hebel (8) wird beim Stellen des Arbeitsumschalters
auf "L" oder "LB" einjustiert. Dazu muß die Schraube (10)
gelöst, durch den Exzenter (9) der Zwischenraum zwischen
dem Hebel (a) und den Zahn der Start-Stopp-Kupplung
innerhalb von 0,1 bis 0,2 mm eingestellt und die Schraube
(10) angezogen werden.
8. Einjustieren der Schienenstellung des Kombinators
des Selektionsdruckwerkes Abb. 64
In der Stoppstellung müssen die Schienen des Kombinators
eine Stellung einnehmen, bei der ein freies Einfallen
des horizontalen Armes einer der 27 Freigabehebel in die
Aussparungen der Schienen gewährleistet ist, ohne daß
er sich festklemmt. Gleichzeitig muß aber der Spiel-
raum zwischen einem beliebigen Schienenvorsprung und
dem Freigabehebel Abb. 64 (oben rechts) minimal sein.
Die Größe dieses Spielraumes wird praktisch innerhalb
von 0,1 bis 0,2 mm eingestellt.
Um die Schienen des Kombinators in die erforderliche
Ausgangsstellung zu bringen, ist es notwendig :
a) die Schraube (6) zu lösen
b) die Kontermutter (4) zu lösen
c) durch Druck auf den Anker eines beliebigen Elektro-
magneten des Selektionsdruckwerkes den horizontalen
Arm (12) des Freigabehebels vor die Zahnflanken der
Schienen (1) bringen und die Schraube (5) heraus-
drehen, bis zwischen den Schienen (1) und dem Hebel
(3) ein Spielraum vorhanden ist.
Das Erscheinen des Spielraumes zeugt davon, daß die
Schienen der betreffenden Schrittgruppe den Freigabe-
hebel erreicht haben. Danach wird durch langsames Ein-
schrauben der Schraube (5) der Spielraum zwischen dem
Hebel (3) und den Schienen (1) ausgewählt, und von
dieser Stellung aus wird die Schraube (5) noch um 0,5
Umdrehungen eingeschraubt.
Ehe man die Schraube (6) anzieht und die Schraube (5)
durch die Kontermutter (4) sichert, muß das Einfallen
eines jeden der 27 Freigabehebel in die Aussparungen
der Schienen des Kombinators sorgfältig Überprüft wer-
den.
Falls sich einer der Hebel verklemmt , muß die Ein-
stellung nach dem Freigabehebel wiederholt werden,
der rechts einen zu geringen Spielraum hat.
9. Einstellung des Lochers
A. Einstellung der Scheiben des Zeichenzählers
mit Zwischenraumgeber
Die Einstellung des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber
muß damit begonnen werden, daß man den Betriebsartenum-
schalter auf "K" stellt. Danach wird nach Lösen der
Schraube (9) Abb. 65, durch Drehen der Exzenterbuchse
(8) die Scheibe in die Stellung gebracht, in der der
Hebel (14) aus dem Schaltrad (13) ausrastet und die
Scheibe (3) Abb. 66 mit dem Hebel (4) Zahn auf Zahn
steht. Diese Stellung der Buchse wird durch die
Schraube (9) gesichert.
B. Überprüfung der richtigen Einstellung
a) den Betriebsartenumscbalter auf "C" stellen
b) durch den Transportknopf den Locher einschalten und
die Feststellschraube aus der Stoppstellung um eine
halbe Umdrehung weiter bewegen.
c) den Betriebsartenumschalter auf "K" stellen
d) den Arbeitsumschalter auf "L" stellen
e) durch Drücken auf eine der Tasten der Tastatur in den
Lochstreifen soviel Zeichen schreiben wie zum Ausschal-
ten des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber erforder-
lich sind.
Nach einer vollen Umdrehung muß die Feststellerscheibe
(4), die in Abb. 65 dargestellte Lage und die Scheibe
(3) die in Abb.66 dargestellte Lage einnehmen.
C. Justierung der Stellung der Ansatzstücke des Zeichen-
zählers mit Zwischenraumgeber beim Lochen der ersten
49 Zeichen jeder Geheimtextzeile
Beim Einjustieren der Stellung der Auflagestücke des
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber und des Bügels ist
es notwendig :
a) den Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen
b) die Maschine einzuschalten
c) den Arbeitsumschalter auf "L" zu stellen
d) durch den Transportknopf und Arbeit auf der Tastatur
den Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber auszuschal-
ten
e) in den Transmitter des Chiffrators den Schlüssel-
lochstreifen einzulegen
f) den Betriebsartenumschalter auf "C" zu stellen
g) die Maschine auszuschalten
h) die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle einzurasten
und durch Drehen an der Kappe des Fliehkraftreglers
die mechanischen Baugruppen, des Lochers und des
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber in die in Abb.
67 gezeigte Stellung zu bringen, die dem Moment vor
Beginn des Streifentransports entspricht.
i) die Kontermutter (7) lösen, durch die Schraube (8)
zwischen Auflagestücke und Stanzbügel ein Spiel
von 0,3 bis 0,5 mm einstellen und die Kontermutter
anziehen. In diesem Augenblick müssen die Auflage-
stücke die Stellung 1 Abb. 20 einnehmen.
j) die Maschine einschalten.
k) die Hauptwelle 3 mal anlaufen lassen und dann den
Strom abschalten
l) die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle einrasten
und durch Drehen an der Kappe des Reglers die me-
chanischen Baugruppen des Lochers und des Zeichen-
zählers mit Zwischenraumgeber in die in Abb. 68
gezeigte Stellung bringen, die dem Moment vor Be-
ginn des Streifentransports entspricht.
(Stellung II Abb. 20).
m) durch die Einstellschraube (3) nach vorangegangenem
Lösen der Kontermutter (14) den Bügel (15) in eine
Stellung bringen, in der die Klinke (2) das Schalt-
rad (1) mit der Achse (16) um 2 Schritte drehen muß.
Durch die Exzenterschraube (1) werden die Auflagestücke
der Hebel (5) und (6) auf gleicher Höhe (über der mittleren
Stempelreihe) eingestellt und die Schraube (1) durch die
Kontermutter (8) gesichert.
D. Justieren der Stellung der Auflagestücke des Zeichen-
zählers mit Zwischenraumgeber beim automatischen
Lochen der Schrittgruppen "Wagenrücklauf und Zeilen-
vorschub"
Zu dieser Einjustierung ist erforderlich :
a) den Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen
b) die Maschine einzuschalten
c) ein Blatt in den Wagen einzuspannen
d) den Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber in Aus-
gangsstellung und den Wagen auf Zeilenanfang zu
stellen
e) den Schlüsselstreifen in den Transmitter am Chiffra-
tor einzulegen
f) den Betriebsartenumschalter auf "C" zu stellen
g) den Arbeitsumschalter auf "LB" zu stellen
h) auf das Blatt 49 Zeichen zu schreiben und die Ma-
schine auszuschalten
i) die Start-Stopp-Stellung der Hauptwelle einzurasten
und durch Drehen an der Kappe des Reglers die Bau-
teile des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber in
die Abb. 69 gezeigte Stellung zu bringen, die dem
Moment vor Beginn des Streifentransports entspricht.
Die Auflagestücke des Zeichenzählers mit Zwischenraum-
geber müssen die Stellung IV Abb. 20 einnehmen.
Falls die Stellung der Auflagestücke nicht der ver-
langten entspricht, müssen die Kontermutter (4) ge-
löst, die Auflagestücke durch die Schraube (5) über
die jeweiligen Stempel gebracht und die Kontermutter
Abb. 69 angezogen werden. Die Justierung wird bei
eingeschalteter Maschine durch Schreiben auf der Tasta-
tur und Lochen des Probetextes überprüft.
E. Justierung der Stellung der Auflagestücke des
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber sowie des
Bügels beim Lochen der Schrittgruppen "Wagen-
rücklauf und Zeilenvorschub" vom Elektromagneten
Beim Anziehen des Elektromagneten führt der Anker
(13) Abb. 70 die Auflagestücke auf die erste und zwei-
te Stempelreihe und steuert durch den Hebelarm (27)
den Bügel (3).
In diesem Falle wird der Bügel (3) durch die Schraube
(30) in eine Stellung gebracht, die eine Drehung des
Schaltrades um 2 Schritte gewährleistet. Die Schrau-
be (30) wird durch eine Kontermutter gesichert.
F. Justierung der Start-Stopp-Kupplung und der Klinkenantrieb
Der Hebel (1), der die Bewegung von der Nockenwelle
des Selektionsdruckwerkes auf die Scheibennase des
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber überträgt, liegt
auf dem Hebel (22) Abb. 65, der wie folgt einjustiert
wird:
a) die Start-Stopp-Kupplung des Lochers wird einge-
rastet, und die Nockenwelle des Selektionsdruck-
werkes wird in eine Stellung gebracht, bei der sich
die Hebelrolle (23) auf dem maximalen Nockenradius
befindet und die Scheibe (4) durch die Rastklinke (7)
festgehalten wird.
Um eine stabile Stellung der Achse zu erhalten, muß
die Schraube (19) gelöst und der Hebel (1) durch den
Exzenter (20) in die erforderliche Lage gebracht
werden. Dazu sind die Schrauben (2) 8M 2,6 x 6 zu
lösen. Der Anschlag (3) muß so weit vorgeschoben
werden, daß der Hebel (1) durch das Rastrad (4) nicht
überholt wird. Die Schrauben sind anzuziehen.
b) die Einstellung ist bei Lauf zu Überprüfen. In diesem
Zyklus muß die Scheibennase einen Schritt machen,
der 1/50 Umdrehung entspricht und bis zum nächsten
Schritt eine stabile Stellung einnehmen.
Die Einstellung des Hebels (25) der die Streifenvor-
schubklinke steuert, geschieht wie folgt:
a) die Nockenwelle des Selektionsdruckwerkes ist in
eine Stellung zu bringen, in der die Rolle des He-
bels (25) auf dem maximalen Nockenradius liegt.
b) die Schraube (24) ist zu lösen, und die Streifen-
vorschubklinke durch den Exzenter (21) bis zum An-
schlag (6) zu führen.
c) die Schraube (24) ist anzuziehen.
G. Einjustierung des Lochabstandes (Abb. 72)
Die Veränderung des Lochabstandes zwischen den Kombi-
nationen auf dem Lochstreifen wird durch Drehung der
Streifentransporttrommel (1) in Bezug auf die Buchse
erreicht. Dazu müssen die Schrauben (3) gelöst und die
Streifentransporttrommel muß mit Hilfe eines Schrau-
benziehers, durch Drehen des Exzenters (4) in die
erforderliche Richtung bewegt werden. Die Schrauben
sind anzuziehen.
Die Überprüfung des Abstandes erfolgt durch eine spe-
zielle Lochstreifenlehre, die sich mit unter den Werk-
zeugen befindet.
10. Einjustierung der Vorrichtung zur Auslösung des
Lochers und zum Abschalten des Zeichenzählers und
Zwischenraumgebers vom Transportknopf(Abb. 71)
Zur Einjustierung dieser Vorrichtung ist erforderlich :
a) den Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen;
b) die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle bei ausge-
schalteter Maschine einzurasten und die Welle bis
zum Einrasten der Start-Stopp-Kupplung des Lochers
zu drehen;
c) durch Drücken auf den Transportknopf das Gleitstück
(11) mit dem Finger nach links zu führen, bis es
vom Hebel (12) erfaßt wird;
d) die Kontermutter (2) zu lösen und die Schraube (1)
anzuziehen, bis sie den Hebel (3) berührt;
e) die Schraube (1) mit der Kontermutter (2) zu sichern.
Die Einjustierung ist wie folgt zu überprüfen :
Die Maschine in Stoppstellung bringen, einschalten, den
Schlüssellochstreifen in den Chiffrator einlegen, den
Betriebsartenumschalter auf "C" stellen und durch wie-
derholtes Drücken auf den Transportknopf durch Ein-
und Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung des Lochers den
Lochstreifen vorlaufen lassen.
Bei richtiger Einjustierung muß die Start-Stopp-Kupp-
lung immer nach Abschalten des Zeichenzählers mit
Zwischenraumgeber einrasten, und die Scheiben des
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber müssen unbeweg-
lich bleiben. In den Streifen darf nur die Schritt-
gruppe "Zwischenraum" gelocht werden.
11. Einjustierung der Stellung der Abfühlhebel im
Transmitter des Dekombinators (Abb. 73)
Zur richtigen Einregulierung der Abfühlhebel ist es
erforderlich :
a die Maschine in Stoppstellung zu bringen
b) den unteren Schutzdeckel des Transmitters abzu-
schrauben;
c) die Abfühlhebel (7) durch die Schrauben (5) über
den Hebel (6) so weit vorzuschieben, daß sie
0,1 bis 0,2 mm unter der Streifenführung liegen;
d) die Schrauben (5) anzuziehen und den Schutzdeckel
wieder anzuschrauben.
12. Einstellung der Schienen des Dekombinators (Abb.74)
Zur richtigen Einstellung der Schienen des Dekombina-
tors ist es notwendig :
a) die Maschine in Stoppstellung zu bringen;
b) die Transmitterplatte des Dekombinators abzunehmen;
c) die linke Schutzplatte des Transmitters abzunehmen;
d) die Streifenführung vom Dekombinator abzunehmen;
e) die Kontermutter (2) zu lösen;
f) die Schienen (6) des Dekombinators durch die Schraube
(3) über die Leiste (1) in einen Abstand von 0,2 bis 0,3 mm
von den Ansatzstücken (5) des Transmitters zu bringen.
Dabei muß der Spielraum zwischen den Aussparungen
der Schienen und den Hebeln des Dekombinators 0,5 bis
0,7 mm betragen;
g) die Kontermutter (2) anzuziehen, Schutzplatte, Deckel
und Streifenführung wieder anzubringen.
13. Einjustierung des Hebels, der den Transmitter des
Dekombinators anhält, wenn im Streifen die 32.
Kombination auftritt. (Abb. 75)
Zur richtigen Einjustierung des Hebels (5) ist es er-
forderlich :
a) die Maschine in Stoppstellung zu bringen;
b) die vordere Schutzplatte des Transmitters, sowie
den Rahmen der Tastatur abzunehmen;
c) die Kontermutter (S) zu lösen und durch die Schraube
(10) den vertikalen Arm des Hebels (5) in einen Ab-
stand von 0,2 bis 0,3 mm von den Schienen (4) des
Dekombinators zu bringen;
d) die Schraube (10) mit der Kontermutter (8) zu sichern;
e) die Kontermutter der Exzenterschraube (12) (vom
Rahmen her) zu lösen und durch Drehen in eine Stellung
zu bringen, die ein genügend weites Einfallen der
Klinke (11) in die Aussparungen der Stangen (13) ge-
währleistet. Die Schraube (12) mit der Kontermutter
sichern.
Die Überprüfung wie folgt vornehmen :
a) in die Streifenführung des Transmitters einen Streifen,
der nur Transportlöcher hat, einführen;
b) bei abgeschaltetem Motor auf den Knopf "EIN" des Trans-
mitters drucken;
c) durch Drehen am Regler die Bewegung des Hebels (5)
verfolgen.
In dem Moment, wo sich der Hebel (9) unter der Feder-
spannung (7) hebt, muß der Hebel (5) mit seinem verti-
kalen Arm in die Aussparung der Schienen des Dekombi-
nators, wie in Abb. 76 gezeigt, einfallen, mit dem Ex-
zenter (12) die Klinke (11) anheben und die Start-Stopp-
Kupplung des Transmitters ausrasten.
Nachdem überprüft wurde, ob der Hebel (5) bei Motoran-
trieb anspricht, ist die vordere Schutzplatte des
Transmitters wieder an ihrem Platz anzubringen.
14. Einjustierung der Hebel des Dekombinators (Abb.75)
Die Einjustierung der Hebel des Dekombinators erfolgt
in Stoppstellung der Maschine bei abgeschalteter Maschine.
Dabei ist notwendig :
a) die obere Platte des Transmitters abzunehmen;
b) die Streifenführung (17) abzunehmen;
c) die Schraube (2) zu lösen;
d) den Bügel (3) in eine Stellung zu bringen, die zwischen
den Hebeln (15) und den Schienen (4) einen Spielraum
von 0,5 ± 0,1 gewährleistet;
e) die Lasche (1) auf dem Zapfen des Bügels (3) durch
die Schraube (2) zu befestigen. Die Platte des Trans-
mitters und die Streifenführung wieder anbringen, die
mechanischen Baugruppen in ihrer Arbeit überprüfen.
15. Einjustierung der Bauteile zum Sperren des Trans-
mitters beim Wagenrücklauf (Abb. 77)
Vor der Einjustierung ist die Maschine in Stoppstellung
zu bringen, der Wagen auf "Zeilenanfang" zurückzuschieben,
in dem Wagen ein Blatt einzuspannen, 58 Zeichen zu schrei-
ben, die Maschine auszuschalten, die Maschine zu kippen
und die Bodenplatte abzunehmen. Die Einjustierung hat
wie folgt zu geschehen :
a) die beiden Schrauben der Zugstange (1) sind zu lösen,
und unter Verschieben des Hebels (11) ist die Nase des
Hebels (16) unter den horizontalen Arm (17) des He-
bels (2) zu bringen;
b) die Zugstange und der Hebel (11) sind durch Schrauben
zu sichern;
c) durch Drücken auf eine der Tasten ist die Start-Stopp-
Kupplung des Antriebes einzurasten;
d) der Knopf "AUS" am Transmitter ist zu drücken;
e) durch Drehen am Regler des Antriebes ist die Rolle
des Hebels (2) auf den Nockenberg (3) zu bringen.
Zu dieser Zeit muß sich die Stange (15) zwischen
den Hebeln (14) und (16) befinden.
f) die Schraube (12) ist zu lösen und durch den Exzen-
ter (13) ist der Hebel (8) vom Arm (7) des dreiarmigen
Hebels durch einen geringen Spielraum zu trennen,
der jedoch ein Verschieben des Armes (5) des drei-
armigen Hebels bis zum Anschlag an die Exzenter-
buchse (6) ermöglichen muß.
In dieser Lage muß bei weiterer Umdrehung der Antriebs-
welle die Start-Stopp-Kupplung des Transmitters aus-
rasten. Der Wagen läuft inzwischen zurück.
Am Ende des Rücklaufs wird der dreiarmige Hebel durch
die Zugstange (1 ) und den Hebel (11) in Ausgangs-
stellung mit einem Spiel von 0,1 bis 0,2 mm vom Hebel
(8) zurückgebracht. Alle Bauteile müssen die in Abb.
78 gezeigte Stellung einnehmen.
16. Einjustierung eines Schrittes beim Streifentrans-
port im Transmitter des Dekombinators
Um die Justierung eines Schrittes beim Streifentransport
zu verändern, macht sich notwendig :
a) die Schraube (2) abzuschrauben und den Drehknopf (1)
Abb. 79 abzunehmen;
b) die 4 Schrauben 2M 2 x 4 abzuschrauben und die
Schutzplatte (3) abzunehmen;
c) die Mutter (5) zu lösen (Abb. 80);
d) durch Veränderung der Lage der Exzenterbuchse (4)
über den Rasthebel (3) den Stern (1) nach Bedarf
(im Uhrzeigersinn oder umgekehrt, je nach dem Loch-
abstand auf dem Streifen) zu verschieben;
e) unter Festhalten der Achse mit dem Schraubenzieher
die Mutter (5) anzuziehen.
17. Einjustierung der Einrichtung die ein Anlaufen der
Hauptwelle bei Erscheinen der 32. Kombination im
Schlüssellochstreifen verhindert (Abb. 81)
Für die Einregulierung dieser Einrichtung ist es er-
forderlich:
a) den Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen;
b) in den Transmitter des Chiffrators einen Schlüssel-
lochstreifen einzulegen, der die 32. Kombination
enthält;
c) den Betriebsartenumschalter auf "D" zu stellen;
d) mit Hilfe der Kurbel die Chiffratorwelle (14) in
Umdrehung zu versetzen.
Der Anschlag muß soweit vorgeschoben sein, daß die
Leiste (11) sich unter der Spannung der Feder (12a)
nur wenig bewegt, wenn in dem Schlüssellochstreifen
Zeichen- oder Steuerkombinationen vorhanden sind,
d. h. dann, wenn sich wenigstens ein Abfühlhebel des
Transmitters heben kann und der Hebel (4) zwischen
den Anschlag (3) und die Nase der Leiste (11 ) zu
liegen kommt.
Fehlen die Kombinationen im Schlüssellochstreifen,
so bleibt der Hebel (4) oben, die Leiste (11) schwenkt
nach ihrer Rechtsbewegung auf der Achse den Hebel
(10), und der rechte Arm des Hebels (7) mit der Zug-
stange (6) dreht sich im Uhrzeigersinn, wonach es
notwendig ist :
e) die Maschine zu kippen;
f) die Bodenplatte abzunehmen;
g) die Schraube (2) zu lösen (Abb. 55);
h) durch den Exzenter (1) den Hebel in eine Stellung
zu bringen, in der die Zähne der 2. Sperrschiene
sich unter die Tastenhebel schieben. Die Schraube
(2) wird angezogen.
i) die Schraube (6)(8M 2,6 x 4) zu lösen;
j) durch den Exzenter (7) die Zugstange (12) in eine
Stellung zu bringen, in der der Hebel (14) (Abb.76)
die Klinke (11) anhebt und den Transmitter des De-
kombinators abschaltet. Bei einer solchen Lage der
beschriebenen Bauteile ist ein Anlaufen der Maschine
nicht möglich;
k) die Justierung ist durch Anziehen der Schraube (6)
(Abb. 55) zu sichern;
1) die Maschine ist in Arbeitsstellung zu bringen.
Der Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen, in den
Transmitter des Chiffrators der Schlüssellochstreifen
und in den Transmitter des Dekombinators der andere
Lochstreifen einzulegen und das Sperrsystem bei der
Arbeit zu überprüfen.
18. Einregulierung der Abfühlhebel der Kontroll-
und Sicherungsvorrichtungen (KSV Abb. 82)
Zur richtigen Einjustierung der Abfühlhebel der KSV
ist es notwendig:
a) den Betriebsartenumschalter auf "D" zu stellen;
b) die Schraube (2) zu lösen;
c) durch den Exzenter (3) die Abfühlhebel bis unter
die Transmitterplatte in eine Lage zu bringen, die
eine freie Bewegung des Schlüssellochstreifens ge-
währleistet. Es genügt praktisch, zwischen den Ab-
fühlhebeln und der Platte einen Spielraum von
0,1 bis 0,2 mm zu haben. (Abb. 82b);
d) die Justierung ist durch Anziehen der Schraube (2)
zu sichern.
Wird der Betriebsartenumschalter auf "K" gestellt,
so müssen die Abfühlhebel 0.5 mm über der unteren
Einstellfläche der Platte (8) Abb. 82a liegen.
Beim Übergang von "D" auf "K", wenn sich der Hebel
(1) auf dem kleinen Radius des Nocken (5) befindet, muß
die Freigabeschiene (7) mit einem Abstand von 0,5 bis
0,6 mm yon den Abfühlhebeln entfernt laufen (Abb.82c).
19. Einjustierung des Gummikissens des Transmitters
Zur Einregulierung des Gummikissens ist erforderlich :
a) den Schlüsselstreifen in den Transmitter des Chiff-
rators einzulegen;
b) den Betriebsartenumschalter auf "C" zu stellen;
c) die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle einzurasten;
d) durch Drehen der Reglerkappe des Antriebes die
Transmitterhauptwelle in die Stellung Ende des
Schlüssellochstreifenstransports zu bringen.
In dieser Stellung muß der Finger des Hebels .(7)
Abb. 83 des Gummikissens den Hebel (9) vom Hebel (3)
soweit entfernen, daß eine freie Aufwärtsbewegung
des Hebels(3) gewährleistet ist.
Wenn der; Hebel (3) nicht vom Hebel (9) freigegeben ist,
muß die Maschine in die Lage "Stopp" gebracht und die
Schraube (11) gelockert werden. Durch die Exzenterbuch-
se (12) wird der Spielraum zwischen dem Finger (7) des
Gummikissens (2) und dem Hebel (9) verringert.
Danach wird nach Festschrauben der Buchse (1 2) die Ma-
schine erneut auf "C" gestellt und die Justierung über-
prüft. Bei richtig vorgenommener Einjustierung dreht der
sich zwischen der Rolle (1) und dem Gummikissen (2)
bewegende Schlüssellochstreifen am Ende des Transports
das Gummikissen (2), führt mit dem Finger (7) den He-
bel (9) weg und ermöglicht dem Hebel (3) am Ende des Zyk-
lus seine obere Stellung einzunehmen, was wiederum das
Heben der Abfühlhebel im nächsten Zyklus und damit einen
normalen Arbeitsablauf der Maschine ermöglicht.
20. Einjustierung der Hebel zur Steuerung der Bewegung
der Kontaktleisten (Abb. 84)
Die Einjustierung geht wie folgt vor sich :
a) in den Transmitter des Chiffrators einen Schlüssel-
lochstreifen, in dem nur die Transportlöcher gestanzt
wurden, einlegen;
b) den Betriebsartenumschalter auf "D" stellen;
c) durch die Kurbel die Nockenwelle des Transmitters
am Chiffrator in eine Stellung bringen, in der die
Rolle des Hebels (4) auf dem Nockenberg (3) steht.
In dieser Lage darf der Spielraum zwischen den Aus-
sparungen der Einstellstücke (8) und dem unteren
Arm des Hebels (7) nicht mehr als 0,1 bis 0,2 mm be-
tragen und der gefederte Kontakt der Kontaktleiste
(5) muß in der Mitte des unbeweglichen Kontaktes
der anderen Kontaktleiste liegen. Das Aufeinander-
treffen der Kontakte wird durch den Abdruck der ge-
färbten beweglichen Kontakte geprüft. Übersteigt der
Abstand zwischen den Einstellstücken und den Hebeln
den genannten Wert, so müssen
d) die beiden Schrauben (12) 8M 4 x 7 gelöst werden.
e) durch den Exzenter (13) der erforderliche Spielraum
eingestellt und die Schrauben (12) angezogen werden.
21. Einjustierung der Abfühlhebel des Transmitters
Zur Einjustierung der Abfühlhebel des Transmitters am
Chiffrator macht sich folgendes erforderlich :
a) die Maschine in Stoppstellung zu bringen;
b) den Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen;
c) die Schraube (11)(Abb. 84) zu lösen;
d) durch den Exzenter (10) die Abfühlhebel mit einem
Abstand von 0,2 mm von der Streifenführung des
Schlüssellochstreifens einzustellen;
e) die Schraube (11) anzuziehen.
22. Die Ausgangsstellung der Kontaktleisten (Abb. 85)
In Ausgangsstellung müssen alle 5 beweglichen Kontakt-
leisten ihre obere Stellung einnehmen und die Mittel-
punkte der Kontakte der beweglichen Kontaktleisten
müssen mit den Mittelpunkten der Kontakte der unbeweg-
lichen Kontaktleisten zusammentreffen. Beim Prüfen
der Leistenstellung ist folgendes vorzunehmen :
a) den Betriebsartenumschalter auf "K" zu stellen;
b) das Zusammentreffen der Kontakte der beweglichen
Leisten mit den Kontakten der unbeweglichen Lei-
sten durch Abdruck der gefärbten beweglichen Kontakte
zu überprüfen.
Falls die Kontakte nicht zusammentreffen, ist es
notwendig,
c) die Schrauben (7) der Hebel (5)(vordere und hintere)
zu lösen;
d) mit den Exzentern (6) den Hebel (3). in eine Stellung
zu bringen, in der ein Zusammentreffen der Kontakte
der beweglichen Leisten mit den Kontakten der unbe-
weglichen Leisten gewährleistet ist;
e) die Schrauben (7) anzuziehen.
23. Einjustierung des Kupplungskontaktes (Abb. 51)
Wenn der Betriebsartenumschalter auf "K" gestellt wird,
muß das obere Kontaktpaar des Kupplungskontaktes geöff-
net und das untere Paar geschlossen sein.
Damit man den erforderlichen Zwischenraum zwischen den
Kontakten des oberen Kontaktpaares erhält, ist es not-
wendig:
a) die Schraube (16) zu lösen;
b) mit dem Exzenter (17) den Zwischenraum zwischen den
Federn (9) und (10) auf 0,5 bis 0,6 mm einzustellen;
c) die Einjustierung durch Anziehen der Schraube (16)
zu sichern.
Beim Umschalten des Betriebsartenumschalters auf "D" oder
"C" entfernt sich der Hebel (15) vom Kupplungskontakt nach
unten und ermöglicht dem oberen Kontaktpaar sich zu
schließen.
Das untere Paar muß in dieser Stellung geöffnet bleiben.
(Abb. 50) Falls beim Übergang auf "D" oder "C" keine
Verbindung der Buchsen (1) und (3) erfolgt, müssen
beide Paare geöffnet bleiben und der Stromkreis der
Druckmagnete der Maschine bleibt unterbrochen.
VII. Anweisung über die Beseitigung von Fehlern
der Maschine "CM -2"
Art der Fehler Ursache der Art der Fehlerbeseitigung
Fehler
1 2 3
Störungen in den Stromkreisen der Stromzuführung:
Beim Einschalten Fehlen der Vorhandensein der Netz-
der Maschine ar- Netzspannung spannung mit Voltmeter -
beitet der Elek- fehlt dieses, dann mit
tromotor nicht Lampe aus dem Werkzeug-
kasten -prüfen.
Durchgebrannte Sicherung mit dem Ohm-
Sicherung 2 A meter prüfen. Fehlerhafte
im Stromkreis Sicherung auswechseln,
des Elektromotors. die Zuleitungsschnur
Bruch in der Zu- überprüfen, indem eine
leitungsschnur Klemme des Ohmmeters an
der Maschine. den Stecker der Zulei-
tungsschnur und die zweite
Klemme der Reihe nach an
jede Klemme der Leiste in
der Grundplatte angeschlos-
sen wird, an der die Schnur-
enden befestigt sind. Bei
einem Bruch der einen oder
der anderen Leitung der
Schnur am Stecker oder am
Eingang in die Grundplatte
der Maschine ist die Schnur
der schadhaften Stelle abzu-
schneiden und die Leitungs-
enden an den Stecker oder
die Leiste in der Grundplatte
anzuschließen. Ist die Schnur
in der Mitte beschädigt, muß
sie ganz ersetzt werden.
Der Netzschal- Mit dem Ohmmeter ist der
ter der Ma- Stromlauf im Schalter zu
schine ist prüfen. Bei Unterbrechung
schadhaft. ist der Schalter ausein-
anderzunehmen und der Zustand
der Kontaktoberflächen zu
prüfen. Bei Abbrennen oder
Verschmutzung sind sie zu
säubern. Ein schadhafter
Schalter ist durch einen
neuen zu ersetzen.
Fehler im Elektromotor SL -369 -U/A I
Fehler des Kontak- Mögliche Ursache kann sein,
tes zwischen Kollek- daß die Bürsten abgenutzt
tor und Bürsten oder im Bürstenhalter ein-
geklemmt sind. Abgenutzte
Bürsten sind durch neue zu
ersetzen. Bei eingeklemm-
ten Bürsten sind die Bür-
stenhalter zu säubern
und die Bürsten anzupassen,
nachdem sie mit einer Feile
abgefeilt wurden.
starkes Abbrennen des Den Kollektor mit feinem Sand-
Kollektors papier säubern und mit in
Spiritus getränktem Mullappen
abreiben.
Der Kontakt des Flieh- Der Kontakt, der in strom-
kraftreglers ist ge- losen Zustand geschlossen
öffnet (bei Arbeit vom sein muß ist einzustellen.
Wechselstromnetz)
Bruch im Stromkreis Diese Fehler ist vom Durch-
der Erregerwicklung brennen der Sicherung 2 A
begleitet. Der Stromkreis
der Erregerwicklung ist mit
dem Ohmmeter an Hand der
Prinzipschaltung der Ma-
schine zu prüfen.
Der Elektro- Starkes Abbrennen des Den Kollektor mit feinem
motor arbei- Kollektors Sandpapier reinigen und mit
tet nicht in Spiritus getränktem Mull-
voller Leistung. lappen abreiben.
Die Bürsten sind nicht Die Bürsten sind durch Drehen
genügend an den Kollek- der Schlitzkappen in den der
tor angedrückt Bürstenhaltern im Uhrzeiger-
sinn anzudrücken.
Bruch einer der Selek- Die Bruchstelle durch An-
tionen der Ankerwick- schließen des Ohmmeters an
lung die benachbarten Kollek-
torplatten feststellen.
Ein Bruch erfolgt meistens
an den Lötstellen der Wick-
lungsenden an den Kollek-
torplatten. Bei Vorhanden-
sein einer Bruchstelle ist
das gelöste Ende vorsichtig
zu säubern und anzulöten.
Bei einem Bruch innerhalb
der Wicklung muß der Elek-
tromotor ausgewechselt werden.
Der Elektro- Es fehlt die Schmie- Der Elektromotor ist aus-
motor hat sich rung in den Lagern. einander zu nehmen, die
stark erhitzt. Die Lager sind ver- Kugellager sind zu waschen
schmutzt. und zu schmieren. Nachdem
Zusammensetzen ist zu über-
prüfen, ob der axiale
Spielraum der Welle fehlt
und ob diese sich von Hand
aus ohne Bürsten leicht
drehen läßt.
Stark an den Kollek- Der Bürstendruck ist zu re-
tor angedrückte gulieren. Da es wegen Feh-
Bürsten. len des erforderlichen Meß-
instrumentes während des Be-
triebes schwierig ist, den
notwendigen Bürstendruck
festzustellen, empfiehlt
es sich, den Bürstendruck
auf folgende Weise zu er-
mitteln: Der Druck der Bür-
ste des eingeschalteten
Elektromotors ist herabzu-
setzen, indem die Schlitz-
kappe mit einem Schrauben-
zieher abgeschraubt wird,
bis über dem ablaufenden
Rand der Bürste eine starke
Funkenbildung entsteht, wo-
nach die Kappe wieder um
1,5 bis 2 Umdrehungen ein-
zuschrauben ist.
Niedriger Wi- Absetzen von Kupfer- Den Elektromotor ausein-
derstand der und Kohlenstab auf andernehmen, die innere
Isolation an den Bürstehaltern Mantelfläche des Gehäuses
den stromfüh- und der Bürstenhalter mit
renden Teilen in Spiritus getauchtem
gegenüber dem Mullappen abreiben.
Gehäuse des
Elektromotors.
Störungen in der Maschine "CM-2"
Beim Einschal- Die Sicherung 1 A Die Sicherung herausnehmen
ten der Maschi- im Stromkreis der und mit Ohmmeter prüfen.
ne arbeitet Elektromagneten Sie, falls erforderlich,
zwar der Elek- im durchgebrannt. durch eine neue ersetzen.
tromotor, aber
es werden keine
Zeichen ge-
schrieben.
Der Kupplungs- Durch wiederholtes Umstellen des
kontakt KK (Abb.40) Betriebsartenumschalter von "K"
der vom Betriebsar- auf "D" oder "C" überzeugt man
tenumschalter sich von der richtigen Arbeit des
gesteuert wird und Kontaktes. In allen Fällen muß
sich in der Grund- eine Verbindung der mittleren
platte des Chiffra- mit der oberen oder unteren Fe-
tors befindet, gibt der hergestellt werden.
keine Verbindung.
Verschmutzung des Den Kontakt mit einem Stück Stoff,
Kontaktes KK das mit Spiritus getränkt ist,
säubern. Den Durchgang mit
Hilfe eines Ohmmeters in allen
Stellungen des Betriebsarten-
umschalters prüfen.
Die Zuleitungen zum Durchgang nach dem Schaltschema
Kontakt KK sind be- mit dem Ohmmeter prüfen.
schädigt.
Verschmutzung des Kontakte säubern, Lötstellen
Impulskontaktes IM. prüfen.
Während eines Einer der Kontakte Bodenplatte abnehmen und die
jeden Zyklus der Tastatur ist Stellung der Kontakte der
arbeiten dauernd geschlos- Tastatur prüfen.
gleichzeitig sen.
2 Typenhebel
Anker und Stange Am wahrscheinlichsten ist, daß
eines Elektromag- sich die Stange des Elektromag-
neten des Selek- neten in der Buchse festgelau-
tionsdruckwerkes fen hat. Es ist notwendig, den
kehrten nicht in Elektromagneten abzunehmen, das
die Ausgangsstellung Festlaufen zu beseitigen, neu
zurück. abschmieren, einbauen.
Während eines Schluß zwischen Kon- Den Schluß auf Grund des Schalt-
Zyklus (nicht takten der Übergangs- planes mit Hilfe des Ohmmeters
in jedem) spre- kontaktleisten oder oder der Neonlampe eingrenzen.
chen 2 Typen- zwischen Drähten. Die Lampe für Beleuchtung darf
hebel an. bei der Eingrenzung des Schlußes
nicht angewandt werden, da die
Isolation an benachbarten Kon-
takten durchbrennen kann.
Beispiel: Schluß bei der Stellung
des Betriebsartenumschalter auf
"K".
Nehmen wir an, daß bei Drücken
auf die Taste "D" 2 Typenhebel
ansprechen - D und E. Aus dem
Schaltbild der Maschine folgt,
daß der Schluß zwischen den
Kontakten 4 und 5 eines der
Übergangskontaktleisten ÜKL 4,
ÜKL 3, ÜKL 2, ÜKL 1 oder in der
Verdrahtung, die diese Über -
gangskontaktleisten verbindet,
liegt. Die Übergangskontakt-
leisten sind parallel geschal-
tet. Zur Fehlersuche ist es
notwendig, sie voneinander zu
trennen. Im gegebenen Falle
ist es zweckmäßig, den Chiff-
rator abzunehmen, den Betriebs-
artenumschalter auf K zu
stellen und sich zu vergewissern,
ob der Schluß weg ist , indem man
das Ohmmeter an die Kontakte 4
und 5 der Übergangskontaktlei-
sten ÜKL 3 anklemmt.
Indem das Ohmmeter an die inneren
Kontaktfedern der Kontakte D und
E angeklemmt werden, sich ver-
gewissern, ob Schluß in der
Tastatur ist. Ist dort kein
Schluß, so ist das Ohmmeter an
die Kontakte 4,5 der Leiste ÜKL 1
anzuschließen, die sich in der
Grundplatte befindet.
Zeigt das Ohmmeter zwischen den
Kontakten 4 und 5 der Übergangs-
kontaktleiste Widerstand an, so
muß man sich vergewissern, ob
sich die Federn der Kontakte 4
und 5, an die die Drähte gelötet
sind, berühren, desgleichen ist
die Isolation der Drähte zu prü-
fen. Sind keine sichtbaren Be-
schädigungen in der Übergangskon-
taktleiste ÜKL 1, so muß das Se-
lektionsdruckwerk abgenommen und
dessen Verdrahtung geprüft werden.
Beispiel: Auffinden des Kurz-
schlusses, wenn der Betriebsarten-
umschalter auf "C" oder "D" steht.
Es wird angenommen, daß die Ma-
schine in der Stellung "K" des
Betriebsartenumschalters normal
arbeitet und im gegebenen Fall
eine Störung im Chiffrator vor-
liegt. Es wird empfohlen, die
Eingrenzung in unten aufgeführter
Reihenfolge durchzuführen:
Den Deckel der Kontaktleisten KL
öffnen und sorgfältig die Leisten
KL 7 KL 8 und die 2 Leisten mit
den Flächenkontakten überprüfen,
ob die Isolation zwischen benach-
barten Kontakten verbrannt ist.
Bei Feststellen einer Brandstelle
muß die verkohlte Schicht zwischen
den Kontakten entfernt werden. Ein
Loch 0 1,2 mm bis 2,5 mm tief zwi-
schen den Kontakten bohren, in die
die Bohrung Shellack oder Bakelitlack
einführen und ein Ebonitröllchen
(Zeichnung 8.589.039) das in den
Ersatzteilen vorhanden ist, ein-
pressen. Nach dem Trocknen die
Stelle mit Sandpapier abreiben und
mit der Kontaktoberfläche gleich-
machen.
Ist keine Brandstelle vorhanden, so
muß die Verdrahtung des Chiffra-
tors geprüft werden, man nimmt ihn
von der Maschine ab. Die Verdrahtung
wird, indem man die Neonlampe be-
nutzt, wie folgt geprüft:
Den Deckel der Kontaktleisten KL
öffnen und den Betriebsartenumschal-
ter auf "C" stellen. Eine Klemme des
Ohmmeters wird an den Kontakt 1
(Leitung 28) der Übergangskontakt-
leiste ÜKL 3, der zweite Anschluß
an den Kontakt 5 (Leitung 82) der
Leiste KL 8 in Übereinstimmung mit
der Schaltung angeklemmt.
Bei allen anderen Kontakten der
Leisten KL 7 und KL 8 darf kein
Durchgang sein.
Wenn z.B. der zweite Anschluß des
Ohmmeters außer am Kontakt 5 der
Leiste 8 Durchgang am Kontakt 20
(Leitung 57) der Leiste 7 anzeigt,
so ist ein Beweis dafür, daß zwischen
Verbindungen der zweiten und dritten
Kontakte der ersten und 2. Reihe der
Leiste KL 6 des Betriebsarten-
umschalters ein Schluß liegt.
Nach Durchprüfen der Stromkreise,
die an den Kontakt 1 (Leitung 28) der
Leiste ÜKL 3 angeschlossen sind,
müssen alle Kontakte einschließlich
des 27. dieser Leiste geprüft werden.
Solch eine Prüfung erfaßt alle
Stromkreise des Chiffrators mit Aus-
nahme der Kreise der beweglichen
Kontaktleisten KL.
Für das Prüfen der Leisten KL, ob
ein Schluß zwischen den Kontakten
oder Drähten vorhanden ist, wird
die Neonlampe oder das Ohmmeter ver-
wandt. Dabei muß jeder Kontakt der
ersten oder 2. Reihe (Zählrichtung
gleichgültig) nur einmal mit einem
Kontakt der 3. oder 4.Reihe Verbin-
dung haben.
Bei Betäti- Unterbrechung des Beispiel für das Aufsuchen einer
gen einer Stromkreises des Unterbrechung des Stromkreises,
Taste läuft Elektromagneten wenn der Betriebsartenumschalter
die Haupt- des Selektions- auf "K" steht.
welle der druckwerkes.
Maschine an, Nemnen wir an, daß bei Drücken der
aber der Ab- Taste "A" das A nicht abgedruckt wird
druck fehlt. Es ist notwendig, den Netzstecker zu
ziehen, den Umschalter der Maschine in
Stellung "Ein" zu bringen, den
Spannungsumschalter auf = zu schal-
ten. Die Steckerleiste St 5 aus der
Federleiste HU 6 der Grundplatte
herausziehen. Die Taste A drücken.
Von Hand aus den Elektromotor
SL 369 U/A1 bis zum Schließen des
Impulskontaktes drehen. Mit dem Ohm-
meter bestimmen, welcher Stift des
Steckers mit dem Impulskontakt ver-
bunden ist. Der 2. Stift muß mit der
gemeinsamen Leitung 28 Verbindung
haben, der gleichzeitig gemeinsame
Schiene für die Wicklungen des
Elektromagneten des Selektionsdruck-
werkes ist. Wenn der Stromkreis des
Elektromagneten nicht unterbrochen
ist, so zeigt das Ohmmeter den Wider-
stand der Wicklung des Elektromag-
neten an, der 450 Ohm beträgt.Wenn
das Ohmmeter eine Unterbrechung des
Stromkreises anzeigt, ist es not-
wendig, das Ohmmeter an den Stift
der Netzschnur zu klemmen, der an
dem Impulskontakt angeschlossen ist
und Schritt für Schritt den Strom-
kreis des Elektromagneten A zu prü-
fen.
Bei Einschal- Es ist kein Kon- Die Maschine kippen und die Boden-
ten der Ma- takt zwischen der platte abnehmen. Die Schraube, die
schine brennt Schelle und der in der Schelle sitzt, um 3 - 4
die Sicherung Wicklung des Wi- Gänge her ausdrehen, die Schelle ver-
2 A durch derstandes 32 schieben, die Kontaktstelle zwischen
(Abb. 49) der in Widerstandswicklung und Schelle
Serie mit der Er- säubern. Die Schelle an ihren Platz
regerwicklung des rücken, festschrauben. Vor dem Ein-
Elektromotors schalten der Maschine die Sicherung
liegt, vorhanden 2 A auswechseln und den Durchgang
des Teiles des Widerstandes prüfen,
der im Stromkreis der Erregerwick-
lung liegt.
Der Isolations- Beschädigung der Die Stelle des Gehäuses ist ohne
widerstand ist Isolation und Auftrennung der elektrischen Ver-
gleich 0 oder Gehäuseschluß bindung zwischen den Baugruppen
in der Größen- nicht zu bestimmen. Es wird bei
ordnung bis zu der Fehlereingrenzung empfohlen,
Kiloohm und folgendermaßen vorzugehen:
Gehäuseschluß
Nachsehen, ob keine offensichtliche
Beschädigung der Isolation und da-
mit ein Gehäuseschluß vorliegen.
Die Federleiste RU 6 des Antriebes
aus der Steckerleiste St 5 der Grund-
platte herausnehmen und den Isola-
tionswiderstand der stromführenden
Teile des Motors in bezug auf das
Gehäuse prüfen. Der Elektromotor
kann Ursache für ein starkes Sinken
des Isolationswiderstandes sein,
wenn sich das Gemisch von Kohle-
und Kupferstaub auf die Isolations-
hülsen des Elektromotors absetzt.
Wenn der Elektromotor nicht die Ur-
sache für das Sinken des Isolations-
widerstandes ist, ist es notwendig,
den Chiffrator von der Maschine
abzunehmen und einzeln den Isola-
tionswiderstand am Chiffrator an
der Tastatur, an der Leiste ÜKL 1,
mit angeschlossener Leiste ÜKL 2
des Selektionsdruckwerkes zu
prüfen.
Der Netz- Gehäuseschluß Filter herausnehmen, den Gehäuse-
stecker wird im Filter schluß im Filter beseitigen. Mit
in die Dose dem Ohmmeter den Isolationswider-
gesteckt. Die stand prüfen.
Netzsicherung
brennt durch.
Bei Betätigen Die Auslösevor- Die Einstellung der Bauteile der
einer Taste richtung ist ge- Auslösevorrichtung der Hauptwelle
läuft die stört. überprüfen und unter Berücksich-
Hauptwelle tigung des entsprechenden Abschnittes
nicht an. Die der Beschreibung einjustieren.
Hauptwelle
läuft durch.
Bei Eingabe Die Einstellung Die Einstellung der Sperrvorrich-
von Hand wer- der Sperrvorrich- tung während des Wagenrücklaufs
den die Ta- tung der Tasta- prüfen und nach dem entsprechenden
stenhebel tur ist fehler- Abschnitt der Beschreibung einjustieren.
nach Wagen- haft.
rücklauf nicht
in der unte-
ren. Stellung
festgehalten.
Schwacher Ab- Die Spannung der Die Druckfeder muß eine Kraft auf-
druck der Druckfeder ist weisen, durch die die Rolle des
Zeichen auf zu gering. Der Ab- Druckhebels dem Profil des Nockens
dem Blatt wurfbügel ist nicht folgt, ohne sich von ihm zu ent-
richtig eingestellt fernen.
Praktisch entfernt sich die Rolle
des Druckhebels beim Übergang auf
den kleineren Radius des Nockens.
Das Ablaufen der Rolle auf den
Druckexzenter kann geprüft werden,
indem man die Exzenteroberfläche
mit einer dünnen Fettschicht (0,5
bis 1 mm) bestreicht und die Haupt-
welle für einen Arbeitszyklus an-
laufen läßt. Anband der Spur, die
die Rolle auf der Fettschicht
hinterläßt, kann man beurteilen,
wie sie auf dem Nocken abläuft.
Die Spannung der Druckfeder, bei
der die Rolle in einem maximalen
Winkel abläuft, ist als optimal
anzusehen. Ein weiteres Spannen
der Druckfeder, erhöht die Geschwin-
digkeit der Bewegung der Typen-
hebel nicht und schadet den Bau-
teilen der Maschine. Die Druck-
federspannung muß in Stoppstellung
der Hauptwelle der Maschine in der
Größenordnung von 6 kp liegen.
Die Einregulierung der Stärke der
auf das Blatt gedruckten Zeichen
muß bei richtig gewählter Feder-
spannung dadurch erfolgen, daß
die Stellung des Abwurfbügels ent-
sprechend dem Abschnitt "Einregu-
lierung des Abwurfbügels" verändert
wird.
Die Schritt- Die Elektromag- Es ist eine Überprüfung gemäß
gruppen wer- nete im Selek- Abschnitt "Einregulierung der
den falsch tionsdruckwerk Elektromagnete des Selektions-
in den Loch- sind falsch ein- druckwerkes" vorzunehmen.
streifen ge- reguliert.
stanzt
Die Einstellung des Überprüfen nach Abschnitt "Ein-
Hebels zum Steuern regulierung der Schienenstellung
der Schienen des des Kombinators am Selektions-
Kombinators ist druckwerk".
fehlerhaft.
Bei der Ar- Der Elektromagnet Störung in der elektrischen Schal-
beit mit Klar- im Zeichenzähler tung mit Hilfe des Ohmmeters und
text und beim mit Zwischenraum- der Prinzipschaltung der Maschine
Drücken auf geber spricht suchen.
die Taste "Wa- nicht an
genrücklauf"
fehlen auf dem
Lochstreifen
die Schritt-
gruppen "Wagen-
rücklauf" und
"Zeilenvorschub"
Im Locher Die Stellung des Nach Abschnitt "Einregulierung der
fehlt der Hebels zur Steuer- Start-Stopp-Kupplungen und der
Streifentrans- ung des Streifen- Klinkenantriebe" einregulieren.
port transporthebels
ist nicht einjustiert.
Falscher Ab- Die Streifentrans- Die Stellung der Streifentrans-
stand zwischen porttrommel ist porttrommel nach Abschnitt
den Kombina- nicht richtig ein- "Einregulierung des Lochabstandes"
tionen auf dem gestellt. verändern.
Streifen
Die Farbband- Die Farbbandgabel Die Farbbandgabel ist mit einer
gabel bleibt ist verschmutzt in Benzin getauchten Bürste zu
in der obe- säubern und anschließend zu
ren Stellung schmieren.
Bei Arbeit Einer oder mehrere Prüfen, ob Abfühlhebel verklemmt
mit Klartext Abfühlhebel des sind und den Fehler beseitigen.
(automatisch) Transmitters ar- Die Stellung der Abfühlhebel ist
entsprechen beiten nicht. nach Abschnitt "Einjustierung
die auf dem der Stellung der Abfühlhebel im
Blatt gedruck- Transmitter des Dekombinators"
ten Zeichen zu prüfen.
nicht den
Schritt-
gruppen auf
dem Streifen,
die durch
die Abfühl-
hebel des
Transmitters
abgetastet
werden.
Bei auto- Bruch der Feder am In die Streifenführung des Trans-
matischer Schlagbügel , der mitters einen Streifen einlegen,
Arbeit läuft auf den Hebel ein- auf den Knopf "Ein" drücken und
die Hauptwel- wirkt, der in die durch Drehen der Welle des Elek-
le nicht an. Aussparungen der tromotors mit der Hand feststellen,
Dekombinatorschie- ob der Hebel in, die Aussparungen
nen einfällt. der Schienen des Dekombinators
eingefallen ist. Vorher die Strei-
fenführung abnehmen. Läuft die
Hauptwelle der Maschine nicht an,
ist die vordere Schutzplatte des
Transmitters abzunehmen und zu
überprüfen, in welchem Zustand
sich die Feder des Stoßbügels be-
findet. Wenn der Hebel nicht in
die Aussparungen der Schienen des
Dekombinators einfällt ist zu
Prüfen, ob er verklemmt ist.
überprüfen, ob die Schienen des
Dekombinators in die Ausgangs-
stellung gehen, die im entsprechen-
den Abschnitt der Beschreibung
"Einstellung der Schienen des De-
kombinators" angeführt ist.
Der Trans- Fehlerhafte Ein- Die Einstellung auf Grund des
mitter des stellung der entsprechenden Abschnittes "Ein-
Dekombinators Sperrvorrichtung justierung der Bauteile zum Sperren
stoppt nicht des Transmitters beim Wagenrück-
während des Wa- lauf" überprüfen.
genrücklaufes
oder stoppt zu
früh. Nach Wa-
genrücklauf
läuft die Haupt-
welle nicht an.
Beim Chiffrie- Die Feder (12) Die Feder auswechseln und die Ein-
ren fehlt die Abb. 18 ist ge- stellung der Zugstange (7) über-
Teilung des rissen. prüfen (Abb. 52).
Geheimtextes
in Fünfer-
gruppen.
Beim Chiffrie- Im Transmitter Die Einstellung der Abfühlhebel
ren hält die des Chiffrators der KSV ist auf Grund des Ab-
Hauptwelle wird der Schlüs- schnittes "Einregulierung der
nach dem zwei- sellochstreifen Abfühlhebel der Kontroll-und
ten Arbeits- nicht transpor- Sicherungsvorrichtung" vorzunehmen.
zyklus an. tiert, weil er
vom Abfühlhebel
der KSV angehal-
ten wird.
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Seite Abb.
I. Allgemeine Hinweise 1 1
Baugruppen der Maschine CM -2 2 1
II. Beschreibung der Baugruppen der Maschine 5
Tastatur 5 3
Tastenhebel 6 4, 4b, 4c
Auslösevorrichtung Abb. 2 7 2
Auslösesperre 8 5
Sperrvorrichtungen 9 2
Vorrichtung, die die Arbeit der Tastatur während 9 2
des automatischen Wagenrücklaufes verhindert
(Abb.2)
Sperrvorrichtung, die das Anlaufen der Hauptwelle 9 2
der Maschine verhindert, wenn die Bedienungsperson
den Schlüssellochstreifen nicht richtig anwendet
(Abb.2)
Sperrvorrichtung, die ein Anlaufen der Hauptwelle 10 2
der Maschine ausschließt, wenn der Schlüsselloch-
streifen zu Ende ist (Abb.2)
Sperrschiene 10 2, 6, 6a
Die Wagenrücklauftaste 11 2
Die Zwischenraumtaste 11 2
Das Selektionsdruckwerk 11 7
Exzenterantrieb 12 8, 9
Druckwerk 13 10, 11, 12
Kombinator 14 7
Farbbandgabel 16 7
Farbbandtransport und Farbbandumkehrung 16 7
Zusatzvorrichtungen 17 7
Antrieb 18 13
Der Elektromotor SL -369/ U/A 1 18 86
Die Hauptwelle der Maschine 19 13
Die Start-Stopp-Kupplung 20 14
Die Welle für Wagenrücklauf 22 13, 15
Steuerung der Kupplung der Welle für Wagenrück- 24 13
lauf
Der Zähler für die Arbeitszyklen der Maschine 25 13
Der Impulskontakt IK 25 13
Die Zwischengetriebeelemente 25 13
Der Wagen 26 16, 17, 17a
17b, 18, 18a
19
Der Transmitter und Dekombinator 31 19
Der Transmitter 31 19
Die Hauptwelle 31 19
Die Auslösevorrichtung 32 19
Die Abfühlvorrichtung 33 19
Die Streifentransportvorrichtung 33 19
Die Sperrvorrichtungen 34 19
Der Dekombinator 36 19
Der Locher 37
Eingabe und Lochen der Fünferschrittgruppen 38 20
Der Zeichenzähler und Zwischenraumgeber 39 21
Die Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber
beim Verschlüsseln 39 20, 21
Die Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber,
wenn der Betriebsartenumschalter auf "K" steht 42 20
Automatikantrieb 43 22
Steuerung der Start-Stopp-Kupplung des Lochers 44
Einschalten des Lochers für Dauerauslösung des
Streifentransports 45 22
Einschalten des Lochers .für einen Zyklus 46
Die Start-Stopp-Kupplung des Lochers 47 23, 24
Der Chiffrator 48 28
Der Antrieb 48 29
Die Kontaktleisten KL 51 36
Der Transmitter 51
Die konstruktive Ausführung des Transmitters 52 30, 31
Das Verstellungssystem der Kontaktleisten "KL" 53 32
entsprechend den Schlüsselkombinationen
Sperrung der Tastenhebel und Anhalten des
Transmitters am Dekombinator bei Ende des
Schlüssellochstreifens 55 33, 34
Verhinderung der Überschlüsselung nur mit einer
Kombination des Schlüssellochstreifens bei Störung
des normalen Streifentransports 56 33
Verhinderung von Fehlern des Nachrichtensachbe-
arbeiters beim Benutzen des Schlüssellochstreifens 57
KSV, die die Möglichkeit der Arbeit an der
Maschine mit Klartext bei eingelegtem Schlüssel-
lochstreifen verhindern 58 2, 34
KSV, die doppeltes Benutzen eines Schlüssel-
lochstreifens ausschalten 58 34
Kontroll- und Sicherungsvorrichtung (KSV) , die
die Möglichkeit des Chiffrierens mit einem
Schlüssellochstreifen, der für die Dechiffrierung
bestimmt ist, ausschließt 60 34
Auslösen der Hauptwelle der Maschine beim
Umschalten des Betriebsartenumschalters von "K" 60 2, 25, 32
auf "D"
Betriebsartenumschalter 62 32, 37
Der Gruppenzähler 63 28, 35
Gehäuse mit Konzepthalter 63 1
Stromversorgung 64 38, 64
Filter 65 27
Grundplatte 65 25
III. Elektrische Schaltung der Maschine 66 40
Elektrische Bauteile der Stromversorgung 67
Die elektrischen Bauteile der Grundplatte 67
Elektrische Bauteile des Antriebes 69
Elektrische Bauteile der Tastatur 69
Elektrische Bauteile des Selektionsdruckwerkes 70
Elektrische Bauteile des Chiffrators 70
Elektrische Bauteile des Filters 71
Stromlaufplan 71
Stromkreislauf des Elektromotors Mo 1 bei Anchluß
an das Wechselstromnetz 71
Stromkreis des Elektromotors Mo 1 bei Anschluß an
ein Gleichstromnetz 72
Stromkreis im Druckteil der Maschine bei Anschluß
an eine Wechselstromquelle 72
Stromkreis bei der Stellung des Betriebsartenum-
schalters auf K 73
Stromverlauf bei der Stellung des Betriebsarten-
umschalters auf C 74
Stromverlauf bei der Stellung des Betriebsartenum-
schalters 75
Stromkreis für Wagenrücklaufmagneten 76
IV. Zeitdiagramm der Maschine CM-2 76 31
V. Wartungsanweisung für die Maschine CM-2 77 1
Drehzahlregelung der Hauptwelle der Maschine CM-2 78 13, 49, 86
Pflege der Kontakte
Impulskontakt 80
Kontakte der Tastatur 80
Übergangskontaktleisten 81
Die Kontakte der Kontaktleisten und des Betriebs-
artenumschalters 82
Pflege des Elektromotors SI-369 U/A 82
Pflege der Elektromagnete 83
Wartung der mechanischen Baugruppen der Maschine 83
Regeln für das Abschmieren 84 45
Schmierung des Selektionsdruckwerkes 85 42, 64
Schmierung des Antriebes 85 41, 43, 58,
59
Schmierung des Transmitters und des Dekombinators 85 44, 46, 47,
73, 74, 75
Schmierung des Automatikantriebes 85
Schmierung der Teile der Grundplatte und der
Tastatur 86 49
Schmierung des Lochers 86 43
Schmierung des Chiffrators 86 31, 81, 89
Schmierung des Wagens 86 16, 18
VI. Auseinanderbauen, Zusammenbauen und Justieren
der Maschine 86
A. Auseinanderbauen 86
Gehäuse 87
Wagen 87
Stromversorgung 87
Chiffrator 88
Tastatur 88 2, 49
Entfernen des Transmitters mit Dekombinator 89 49
Locher 90
Automatikantrieb 90 22
Antrieb 90 58
Selektionsdruckwerk 91 52
Filter 91
B. Zusammenbau 91
Einbau des Selektionsdruckwerkes 91 52
Aufsetzen des Antriebes 92 49, 58
Einbau des Automatikantriebes 92
Einbau des Lochers 93
Einbau des Transmitters mit dem Dekombinator 93 49
Einbau der Tastatur 94 2, 49
Einbau des Chiffrators 95 30, 48, 51,
54
Einbau der Stromversorgung 96
Einsetzen des Wagens 96 16, 18, 52
C. Einregulierung der Maschine 96
1. Einregulierung des Auslösesystems der Haupt- 96 53, 55, 56
welle
2. Einstellen der Wagenauslösung 99 13, 57
3. Einstellung der Steuerung der Kupplung 99
für Wagenrücklauf
A. Einrasten und Ausrasten der Kupplung für 100 58, 59
Wagenrücklauf
B. Sperrung der Tastatur für die Zeit des 102 55, 58
Wagenrücklaufs
4. Einstellung .der Zugstange des Tastenhebels 102 60
"Wagenrücklauf"
5. Einstellung des Abwurfbügels 103 61
6. Einstellung des Elektromagneten des Selektions- 103 61
druckwerkes
7. Einstellung der Auslösevorrichtung der 104 23, 62, 63
Start-Stopp-Kupplung des Lochers
8. Einjustieren der Schienenstellung des Kombinators 105 68
des Selektionsdruckwerkes Abb. 64
9. Einstellung des Lochers 106
A. Einstellung der Scheiben des Zeichenzählers 106 65, 66
mit Zwischenraumgeber
B. Überprüfung der richtigen Einstellung 106 65, 66
C. Justierung der Stellung der Ansatzstücke des 107 20, 68
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber beim Lochen
der ersten 49 Zeichen jeder Geheimtextzeile
D. Justieren der Stellung der Auflagestücke des 108 20, 69
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber beim
automatischen Lochen der Schrittgruppen
"Wagenrücklauf und Zeilenvorschub"
E. Justierung der Stellung der Auflagestücke des 109 70
Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber sowie des
Bügels beim Lochen der Schrittgruppen
"Wagenrücklauf und Zeilenvorschub" vom
Elektromagneten
F. Justierung der Start-Stopp-Kupplung und der 109 65
Klinkenantrieb
G. Einjustierung des Lochabstandes (Abb. 72) 110 72
10. Einjustierung der Vorrichtung zur Auslösung des 111 71
Lochers und zum Abschalten des Zeichenzählers
und Zwischenraumgebers vom Transportknopf
(Abb. 71)
11. Einjustierung der Stellung der Abfühlhebel im 111 73
Transmitter des Dekombinators (Abb. 73)
12. Einstellung der Schienen des Dekombinators 112 74
(Abb.74)
13. Einjustierung des Hebels, der den Transmitter 112 75, 76
des Dekombinators anhält, wenn im Streifen die
32. Kombination auftritt (Abb. 75)
14. Einjustierung der Hebel des Dekombinators 113 75
(Abb.75)
15. Einjustierung der Bauteile zum Sperren des 114 77, 78
Transmitters beim Wagenrücklauf (Abb. 77)
16. Einjustierung eines Schrittes beim Streifentrans- 115 79, 80
port im Transmitter des Dekombinators
17. Einjustierung der Einrichtung, die ein Anlaufen 115 55, 76, 81
der Hauptwelle bei Erscheinen der 32. Kombina-
tion im Schlüssellochstreifen verhindert (Abb.81)
18. Einregulierung der Abfühlhebel der Kontroll- 117 82, 82a, 82b,
und Sicherungsvorrichtungen (KSV Abb.82) 82c
19. Einjustierung des Gummikissens des Transmitters 117 83
20. Einjustierung der Hebel zur Steuerung der Bewe- 118 84
gung der Kontaktleisten (Abb. 84)
21. Einjustierung der Abfühlhebel des Transmitters 119 84
22. Die Ausgangsstellung der Kontaktleisten 119 85
(Abb. 85)
23. Einjustierung des Kupplungskontaktes (Abb. 51) 120 50, 51
VII. Anweisung über die Beseitigung von Fehlern 121
der Maschine CM-2
VVS 272/62 Ex. 3
H A N D B U C H
für
CHIFFREUR - MECHANIKER (MfS)
Schlüsselgerät CM-2
INHALTSVERZEICHNIS
I. Wartungsanweisung für das Schlüsselgerät CM-2 1
1. Allgemeines 1
1.1 Hinweise für die Bedienung des Schlüsselgerätes 1
1.2 Auswechseln der Lochstreifenvorratsrolle 1
1.3 Reinigen der Typen 2
1.4 Wechseln des Farbbandes 2
2. Zeitplan für die Wartung 3
2.1 Tägliche Ölstelle 3
2.2 Ölstellen an den Bauteilen 3
2.3 Reinigen der Kontaktleisten am Chiffrator 3
2.4 Reinigen des Kollektors 4
2.5 Reinigen des Impulskontaktes 4
2.6 Reinigen des Kontaktes des Fliehkraftreglers 5
2.7 Reinigen des Sicherheitskontaktes des Be- 5
triebsartenumschalters und des Umschaltkon-
taktes des Chiffrators
2.8 Reinigen und Abschmieren aller Zahnräder 5
2.9 Behandlung der Kohlebürsten 6
2.10 Reinigen der Kontakte der Tastatur 6
2.11 Reinigen des Kontaktes für Dauerauslösung 7
Zwischenraum
II. Schmier-und Waschmittelaufstellung 8
III. Vorschrift für die Funktionsüberprüfung 9
des Schlüsselgerätes CM-2
1. Allgemeines 9
2. Überprüfung des Streifentransportes des Lochers 9
3. Überprüfung, ob, in der Stellung "B" des 9
Arbeitsumschalters der Locher und bei "L"
das Druckwerk abgeschaltet wird.
4. Überprüfung der Arbeit. des Druckwerkes, 10
des Transmitters, des Dekombinators und
des Lochers
5. Überprüfung der Arbeit des Chiffrators 10
IV. Vorschrift Über die Anwendung des Materialan- 13
forderungs- und Ausgabescheins
1. Allgemeines 13
2. Handhabung des Materialanforderungs- 13
und Ausgabescheines
3. Ausfüllen des Materialausgabescheines 14
V. Vorschrift für das Ausfüllen von Reparatur- 16
scheinen
Der Aufbau des Reparaturscheines 17
Benummerung der Baugruppen 19
Benummerung der Teile 20
Benummerung der Fehler 23
VI. Fehlerquellen an der CM-2 und ihre Ursachen 25
1. Fehler, die im Zusammenhang mit dem Trans- 25
mitter und dem Dekombinator auftreten
2. Es liegt keine Spannung 25
3. Der Elektromotor arbeitet nicht 25
4. Defekte, die mit dem Nichtabdrucken von 26
Zeichen zusammenhängen
5. Zwei Typenhebel schlagen gleichzeitig an 27
6. Einzelfälle, in denen der Zeichenabdruck 27
fehlt
7. Defekte, die mit der Tastatur zusammenhängen 28
8. Es ist nicht möglich, eine Taste zu drücken 28
9. Die Kupplung an der Hauptwelle rastet 29
nicht ein
10. Fehler, die mit dem Antrieb verbunden sind 29
11. Nicht einwandfreies Arbeiten der Hauptwelle 29
12. Defekte im Druckwerk 29
13. Defekte, die mit dem Locher zusammenhängen 30
14. Defekte, die mit dem Wagen verbunden sind 31
15. Defekte, die mit dem Chiffrator verbunden sind 32
Seite 144
Wartungsanweisung für das Schlüsselgerät CM -2
1. Allgemeines
Die Wartung ist von großer Bedeutung für eine einwandfreie
Arbeit und eine lange Lebensdauer des Schlüsselgerätes.
1.1 Hinweise bei der Bedienung des Schlüsselgerätes
a) Während der Arbeit am Schlüsselgerät ist das Rauchen
oder Essen zu unterlassen.
b) Es ist nachzusehen, ob der Abfallkasten des Lochers
geleert werden muß. Dieser Abfallkasten ist öfters
zu entleeren, da sonst der Locher verstopfen kann.
e) Es ist nachzusehen, ob noch genügend Vorrat an Loch-
streifenpapier auf der Lochstreifenvorratsrolle in
der Kassette vorhanden ist. Ist die farbige Schluß-
markierung des Lochstreifenpapiers durch den Locher
durchgelaufen, ist die Rolle auszuwechseln.
d) Vierzehntägig ist nachzusehen, ob die Typen verschmutzt
sind oder ob sich das Farbband abgenutzt hat.
e) Im allgemeinen ist die Maschine staubfrei zu halten,
öfter mit Pinsel und Putzlappen zu säubern und bei
Nichtbenutzung mit der Schutzhaube abzudecken.
1.2 Auswechseln der Lochstreifenvorratsrolle
Beim Einlegen einer neuen Lochstreifenrolle ist folgendes
zu beachten :
a) Die Kassette ist seitlich herauszuziehen
b) Der Verschluß der Lochstreifenrolle ist zu öffnen,
und der Rest der alten Rolle ist herauszunehmen
c) Die Trommel ist herauszunehmen und der darunter be-
findliche Papierstaub ist mit einem Putzlappen zu
entfernen.
d) Dreht sich die Trommel in ihrer Führung etwas schwer,
ist sie leicht einzuölen.
e) Die Papierführung des Lochers ist mit der im Werkzeug-
kasten befindlichen Räumnadel und einem Pinsel von Pa-
pierstaub zu säubern.
f) Anschließend ist die neue Lochstreifenvorratsrolle, von
der man vor dem Einlegen einige Windungen abgewickelt und
abgerissen hat, in die Kassette einzulegen, der Verschluß
ist zu schließen, die Kassette ist in die beiden Führungs-
schienen einzuschieben und das Papier neu einzuführen.
1.3 Reinigen der Typen
a) Um diese Arbeiten zu erleichtern, ist die Stromversor-
guug und der Wagen abzunehmen.
b) Das Reinigen der Typen hat mit Reinigungsknetmasse, die
über die Typen gerollt wird, zu geschehen.
e) Gleichzeitig ist der Typenkorb mit einem Pinsel, der in
Spiritus bzw. Waschbenzin getaucht wird, zu reinigen.
Vorher ist ein Stück Preßspan oder Pappe unter die
Typenhebel zu schieben, damit der gelöste Schmutz nicht
in die Maschine gelangt.
d) Anschließend ist der Sitz der Typenhebel leicht einzu-
ölen.
1.4 Wechseln des Farbbandes
Es ist Schreibmaschinenfarbband von 13 mm Breite zu ver-
wenden. Das Farbband ist öfter als bei einer Schreibmaschine
zu wechseln bzw. umzudrehen, da der Anschlag härter und des-
halb die Abnutzung größer ist.
Das Auswechseln bzw. Umdrehen des Farbbandes geschieht
folgendermaßen :
a) Das Gehäuse ist abzunehmen.
b) Die beiden Rändelmuttern auf den Farbbandrollen sind zu lösen.
c) Das Farbband ist aus der Farbbandgabel auszuhängen.
d) Das Fähnchen, das an das Farbband drückt und die Um-
schaltung bewirkt, ist seitlich abzubiegen und die Farb-
bandrolle nach oben abzuheben.
e) Wird das Farbband nur umgedreht, sind die beiden Rollen
miteinander auszutauschen.
f) Das Einsetzen der Farbbandrolle ist in umgekehrter Reihen-
folge vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, daß die Farb-
bandrolle in einen der drei Führungsstifte der Farbband-
halterung eingreift.
2. Zeitplan für die Wartung
Die Zahlen in Klammern hinter den Betriebsstunden beziehe
sich auf den Zähleranfangsstand plus angegebene Zahl
in Klammern.
2.1 Tägliche Ölstelle: (Abb. 53, Auslösehebel für die Hauptwelle)
a) Sie ist täglich zu ölen.
b) Befindet sich an der Ölstelle noch Öl, ist nicht zu ölen.
2.2 Ölstellen an den Bauteilen (lt. Zeichnungsunterlagen)
a) Sie sind nach 40 - 50 Betriebsstunden (250) zu ölen.
Die Ölstellen sind z.T. rot gekennzeichnet.
Alle übrigen Ölstellen sind auf den einzelnen Zeich-
nungen, die sich bei jeder Maschine befinden, ersicht-
lich.
b) Befindet sich an der Ölstelle noch Öl, i st nicht zu ölen
2.3 Reinigen der Kontaktleisten am Chiffrator
a) Sie sind nach 15 - 20 Betriebsstunden (50) zu reinigen.
b) Der Betriebsartenumschalter ist auf "D" zu stellen.
c) Der Verschluß der Kontaktleisten ist zu öffnen.
d) Die Kontaktleisten sind nach rechts abzuklappen und
nach oben herauszuziehen.
e) Die Kontaktleisten 1 - 5 und die feststehenden Ein- und
Ausgangskontakte sind mit einem in Spiritus getauchten
Lappen zu säubern.
f) Danach sind die Kontaktleisten 2 und 4 und die Ein- und
Ausgangskontakte mit einer hauchdünnen Schicht tech-
nischer Vaseline, die mit dem Finger aufzutragen ist,
zu überziehen.
g) Zuletzt ist der abgenommene Teil mit den Kontaktleisten
1, 3 und 5 wieder einzusetzen, wobei der Betriebsarten-
umschalter ebenfalls auf "D" zu stellen ist.
Achtung ! Wenn der Verschluß der Kontaktleisten geöffnet
ist, darf das Schlüsselgerät auf keinen Fall eingeschaltet
werden, da schwere Beschädigungen eintreten können.
2.4 Reinigen des Kollektors
a) Er ist alle 80 - 100 Betriebsstunden (250) mit einem
in Spiritus getränkten Leinenlappen zu reinigen.
b) Um die Reinigung des Kollektors durchzuführen, ist
das Abdeckblech, das den Kollektor verdeckt, abzunehmen.
c) Die Kohlebürsten sind zu entfernen.
d) Ist der Kollektor stark verschmutzt bzw. verschmort,
so ist er mit.feiner Schmirgelleinewand zu reinigen.
2.5 Reinigung des Impulskontaktes
a) Er ist nach 100 bis 120 Betriebsstunden (500) zu
reinigen
b) Das Gehäuse ist abzunehmen.
c) Der Schutzdeckel über dem Kontakt ist abzunehmen.
d) Der Kontakt ist mit einem in Spiritus getauchten Lappen
zu reinigen. Bei starker Verschmutzung ist eine Kontakt-
feile zu benutzen.
e) Die Kontaktluft muß 0,2 - 0,3 mm betragen.
f) Die Kontaktoberflächen müssen parallel zueinander stehen.
g) Der Kontakt ist unbedingt ölfrei zu halten.
2.6 Reinigen des Kontaktes des Fliehkraftreglers
a) Er ist nach 100 - 120 Betriebsstunden (500) zu reinigen.
b) Das Gehäuse ist abzunehmen.
c) Der Stromartenstecker am Motor ist herauszuziehen.
d) Der Kontakt ist mit einem in Spiritus getauchten Lappen
zu reinigen. Bei starker Verschmutzung ist eine
Kontaktfeile zu benutzen.
e) Der Kontakt ist unbedingt ölfrei zu halten.
f) Anschließend ist die Drehzahl bei etwaigen Abweichungen
wieder einzuregulieren.
2.7 Reinigen des Sicherheitskontaktes des Betriebsartenum-
schalters und des Umschaltkontaktes des Chiffrators
a) Sie sind nach 100 - 120 Betriebsstunden (500) zu reinigen.
b) Das Gehäuse ist abzunehmen.
c) Die Lochstreifenkassette ist herauszunehmen.
d) Die Stützhülse ist aufzustecken und die Maschine hochzukippen.
e) Die Bodenplatte ist zu entfernen.
f) Die Kontakte sind mit einem in Spiritus getauchten Leinenlappen
zu reinigen.
g) Es ist verboten, Schmirgelleinewand oder eine Feile zu
benutzen.
2.8 Reinigen und Abschmieren aller Zahnräder
a) Sie sind nach 120 - 140 Betriebsstunden (550) zu reinigen
und abzuschmieren.
b) Das verbrauchte Fett ist mit einem Pinsel, der in Waschbenzin
getränkt ist, zu entfernen.
c) Das neue Fett ist auf die Zahnräder dünn aufzutragen.
d) Zum Einfetten ist technische Vaseline zu verwenden.
2.9 Behandlung der Kohlebürsten
2.9.1 Kontrolle der Kohlebürsten
a) Die Kohlebürsten sind alle 80 - 100 Betriebsstunden
(250) nachzusehen.
b) Die Kohlebürsten sind in dem Maße, wie sie sich abschleifen,
nachzustellen.
c) Sind die Kohlebürsten verschmort, sind sie mit einem
Stück Schmirgelleinewand, das über einen runden Gegenstand
gespannt wird, nachzuschleifen.
d) Die Kohlebürsten sind nach ungefähr 700 Betriebsstunden
auszuwechseln (2500), spätestens bei einer Restlänge von
6 mm.
2.9.2 Auswechseln der Kohlebürsten
a) Das Gehäuse ist abzunehmen.
b) Das Deckblech an der Hinterseite des Motors ist abzunehmen.
c) Der Verbindungsstecker Motor - Grundplatte ist zu lösen.
d) Die zwei Schrauben, die den Motor im Antriebsteil halten,
sind herauszuschrauben und der Motor ist waagerecht herauszunehmen.
e) Das Abdeckblech des Kollektors ist abzunehmen.
f) Die beiden Isoliermuttern der Kohlebürsten sind abzuschrauben.
g) Die darunter liegenden Muttern sind herauszuschrauben
und die Kohlebürsten herauszunehmen.
h) Das Einsetzen ist in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen.
i) Nach Einbau neuer oder nachgeschliffener Kohlebürsten
ist der Motor 4 - 6 Stunden leer laufen zu lassen.
2.10 Reinigen der Kontakte der Tastatur
a) Sie sind nach 120 Betriebsstunden (500) zu reinigen.
b) Das Gehäuse ist abzunehmen.
c) Die Stützhülse ist aufzustecken und die Maschine zu
kippen.
d) Die Bodenplatte ist abzunehmen.
e) Die Kassette ist herauszuziehen.
f) Die obere Führungsschiene der Kassette ist abzuschrauben.
g) Der Tastaturschutz ist abzunehmen.
h) Die Kontakte sind im geschlossenen Zustand zu reinigen.
i) Sie sind mit einem in Spiritus getauchten Leinenlappen
zu reinigen.
j) Es ist verboten, eine Feile oder Schmirgelleinewand zu
benutzen da die Kontakte aus Silber bestehen.
2.11 Reinigen des Kontaktes für Dauerauslösung Zwischenraum.
a) Er ist nach 120 Betriebsstunden (500) zu reinigen.
b) Die Reinigung geschieht, wie in Punkt 2.10 beschrieben.
Stand vom Dezember 1961
Schmier-und Waschmittelaufstellung
1. Spezial Vaselin technisch
Hersteller: Carl Netz KG, Jena
Vertrieb: VEB Minol
Verk.-Preis: 1,90 DM
Füllgewicht: ca. 1 kg
Warennummer: 22 88 35 00
2. Heißlagerfett
Hersteller: VEB Schmierfettfabrik Brandenburg/Havel
Vertrieb: VEB Minol
Verk.-Preis: 2,50 DM
Füllgewicht: ca. 1 kg
Varennummer: 22 86 35 00
3. Fernschreiber - Maschinenöl
Hersteller: VEB RFT-Gerätewerk Karl-Marx-Stadt
4. Brennspiritus (vergällt)
Hersteller: VEB Spiritus Berlin-Adlershof
5. Kohlenstofftetrachlorid
Hersteller: VEB Berlin-Chemie Berlin-Adlershof
6. Waschbenzin
Vertrieb: VEB Minol
Berlin C 2,
Neue Königstraße
und dessen Außenstellen
Vorschrift
1. Allgemeines
a) Gehäuse abnehmen
b) Maschine einschalten
2. Überprüfung des Streifentransportes des Lochers
a) Den Arbeitsumschalter auf BL und den Betriebsartenum-
schalter auf K stellen.
b) Abwechselnd 32. Kombination und Dauerauslösung für
Zwischenraum geben (ca. fünfmal). Richtiges Lochen
der Kombinationen prüfen.
c) Abwechselnd Wagenrücklauf und Dauerauslösung für
Zwischenraum geben (ca. fünfmal). Richtiges Lochen
der Kombinationen prüfen.
d) Hintereinander (ca. zehnmal) Wagenrücklauf drücken.
Richtiges Lochen der Kombinationen prüfen.
e) Den Betriebsartenumschalter auf C stellen.
f) Mit dem Schraubenzieher das Zeichenzählwerk auslösen
und prüfen, ob die Teilung in Fünfergruppen einwandfrei
durchgeführt wird. Ca. 30 bis 40 Fünfergruppen lochen
lassen.
g) Schrittgruppenabstand prüfen und wenn nötig einjustieren.
h) Das Zeichenzählwerk in der 2. bis 4. Fünfergruppe abschalten.
i) Dauerauslösung für Zwischenraum geben und prüfen, ob das
Zeichenzählwerk abgeschaltet wird.
j) Die Punkte 2f, 2h und 2i werden dreimal wiederholt.
3. Überprüfung. ob in der Stellung B des Arbeitsumschalters
der Locher und bei L das Druckwerk abgeschaltet wird
4. Überprüfung der Arbeit des Druckwerkes, des Transmitters,
des Dekombinators und des Lochers
a) Arbeitsumschalter auf BL und Betriebsartenumschalter
auf K stellen
b) 10 Zeilen des folgenden Klartextes über die Tastatur
eingeben:
Kaufen sie jede Woche vier gute bequeme Pelze
ryryry … (bis zum Ende der Zeile).
c) 32. Kombination drücken und den Streifen durch Daueraus-
lösung für Zwischenraum vorlaufen lassen.
d) Den erhaltenen Lochstreifen über den Transmitter am Dekom-
binator eingeben und den Text noch einmal unter den von
Tastatur aus geschriebenen schreiben.
e) Prüfen, ob der Transmitter auf die 32. Kombination anspricht
und die Maschine abschaltet. f) Die beiden erhaltenen
Lochstreifen werden auf Abweichungen überprüft.
5. Überprüfung der Arbeit des Chiffrators
5.1 Herstellung eines Schlüssellochstreifens für Prüfzwecke
Es wird ein Schlüssellochstreifen von ca. 1,5 m Länge herge-
stellt. Dazu ist folgendes notwendig :
a) 5 bis 10 cm Zwischenraum durch Dauerauslösung geben.
b) Wahllos alle möglichen Kombinationen lochen (auch Wagen-
rücklauf, Zeilenvorschub und ca. zehnmal in verschiedenen
Abständen die 32. Kombination).
c) Die vordere Ecke des Streifens abreißen. Dadurch erhält
man einen Streifen, der einem Schlüssellochstreifen in
technischer Hinsicht äquivalent ist.
5.2 Prüfvorgang
a) Arbeitsumschalter auf BL und Betriebsartenumschalter
auf K stellen.
b) Den nach Punkt 5.1 hergestellten Schlüssellochstreifen
einlegen.
c) Durch Drücken auf verschiedene Tasten prüfen, ob die
Maschine tatsächlich gesperrt ist.
d) Betriebsartenumschalter auf D stellen. Dabei muß die Haupt-
welle der Maschine einmal anlaufen. Der Wagen und der
Gruppenzähler dürfen keinen Schritt machen, während sich
der hergestellte Schlüssellochstreifen um einen Schritt
weiterbewegt.
e) Den Betriebsartenumschalter auf C stellen. Dabei muß der
Stanzstempel ein Loch in den Streifen stanzen.
f) Den Klartextstreifen in den Transmitter des Dekombinators
einlegen und chiffrieren.
g) Da im hergestellten Schlüssellochstreifen die 32. Kombination
vorkommt muß über den Chiffrator die 2. Sperrschiene an-
sprechen. Hält die Maschine an, so muß auf K zurückgeschal-
tet werden.
h) Den Deckel des Chiffrators öffnen. Der Mechaniker muß sich
davon überzeugen, daß die 32. Kombination unmittelbar links
von den Abfühlstiften liegt.
i) Den Deckel wieder schließen.
j) Den Betriebsartenumschalter auf C stellen.
k) Durch Drücken auf die Tasten prüfen, ob die Sperre gegen
Benutzen eines falschen Schlüssellochstreifens ausgelöst
wurde.
l) Danach die Sperre aufheben und wieder chiffrieren.
m) Nachdem der Schlüssellochstreifen einmal durchgelaufen ist,
den Schlüssellochstreifen und auch den Klartextlochstrei-
fen nochmals einlegen.
n) Den Betriebsartenumschalter auf erstellen.
o) Durch Drücken auf die Tasten prüfen, ob die Sperre gegen
doppelte Benutzung des Schlüssellochstreifens anspricht.
p) Danach die Sperre aufheben und die Punkte g bis l wieder-
holen und den entstehenden Geheimtext unter den ersten Ge-
heimtext schreiben.
q) Prüfen, ob gleicher Geheimtext entsteht.
r) Gegen Ende des Schlüssellochstreifens prüfen, ob die Ma-
schine blockiert wird, wenn der Schlüssellochstreifen nicht
transportiert wird. Zu diesem Zweck den Streifen festhalten.
s) Beide Geheimtextstreifen dechiffrieren und auf Blatt unter-
einanderschreiben. Der Locher muß unabhängig von der
Stellung des Arbeitsumschalters bei D abgeschaltet sein.
Vorschrift
über die Anwendung des Materialanforderungs- und -ausgabescheines
1. Allgemeines
Bei Anforderung bzw. Ausgabe von Ersatzteilen wird der
Materialanforderungs- bzw. -ausgabeschein in dreifacher
Ausfertigung ausgefüllt.
Der Zweck dieser Scheine besteht darin, daß ein Nachweis
über ausgegebene Ersatzteile geführt werden kann.
2. Handhabung des Materialanforderungs- und -ausgabescheines
Dieser Schein ist nur mit Schreibmaschine oder mit Kugel-
schreiber in Blockschrift auszufüllen.
Das Original ist in Schwarzdruck, der erste Durchschlag
in Druck und der zweite Durchschlag in Rotdruck aus geführt.
2.1 Anforderung des Bereichslagers an das Hauptlager
Bei Ersatzteilbedarf wird eine Anforderung in dreifacher
Ausfertigung geschrieben. Das Original und der erste
Durchschlag werden an das Hauptlager des Reparaturdien-
stes des MfS geschickt. Der zweite Durchschlag verbleibt
bei der ausfertigenden Stelle. Nach Bearbeitung der An-
forderung schickt das Hauptlager die Ersatzteile mit dem
jetzt als Lieferschein fungierenden ersten Durchschlag
an das Bereichslager zurück, während das Original bei
Hauptlager des MfS verbleibt.
Kann nur ein Teil der Bestellung realisiert werden, so
nennt das Hauptlager des MfS auf dem ersten Durchschlag
in der Spalte "Bemerkung" einen neuen Liefertermin oder
ein anderes Lager, an das sich das Bereichslager wenden
kann. Sind die Ersatzteile und der erste Durchschlag
beim Bereichslager eingetroffen, wird unter Bezugnahme
auf die Nummer des Scheines telefonische Empfangsbe-
stätigung an das Auslieferungslager gegeben.
2.2 Anforderung eines Bereichslagers an ein anderes Bereichs-
lager
Eine Anforderung eines Bereichslagers an ein anderes Be-
reichslager darf nur dann ausgeführt werden. wenn das
Hauptlager beim MfS nicht liefern kann und von diesem der
Hinweis gegeben wurde. sich an ein bestimmtes anderes Be-
reichslager zu wenden.
Die Anforderung wird ebenfalls in dreifacher Ausfertigung
geschrieben. Das anfordernde Bereichslager schickt das
Original und den ersten Durchschlag an das liefernde Be-
reichslager. Der zweite Durchschlag verbleibt beim an-
fordernden Bereichslager. Das liefernde Bereichslager
schickt die Ersatzteile mit den als Lieferschein fungie-
renden ersten Durchschlag an die anfordernde Stelle zu-
rück. Das Original der Anforderung wird vom liefernden
Bereichslager mit einen Vermerk der vollzogenen Auslie-
ferung an das Hauptlager des MfS geschickt.
Das Hauptlager entlastet das liefernde Bereichslager
durch eine schriftliche Empfangsbestätigung.
Das anfordernde Bereichslager bestätigt den Eingang tele-
fonisch dem liefernden Bereichslager den Empfang der Er-
satzteile.
2.3 Anforderung des Chiffreur-Mechanikers an das Bereichs-
lager
Die Anforderung erfolgt sinngemäß in der gleichen Form
wie die Anforderung des Bereichslagers an das Hauptlager,
nur verbleibt jetzt das Original beim Bereichslager.
3. Ausfüllen des Materialausgabescheines
3.1 Bei "Dienststelle" wird der Absender des Scheines
eingetragen.
3.2 "An" enthält die Adresse der angeschriebenen Dienststelle.
3.3 Unter "Laufende Nummer (Lfd. Nr.)" erfolgt die Numerierung
der angeforderten Ersatzteile.
3.4 Bei "Bezeichnung" wird der Name des angeforderten
Gegenstandes eingetragen.
3.5 In der Spalte "Ersatzteilnummer" wird die genaue Nummer
des angeforderten Teiles lt. Ersatzteilliste T 301 El
eingetragen.
3.6 Die benötigte Stückzahl wird unter "Stück benötigt"
eingetragen.
3.7 Die ausgelieferte Anzahl wird in Spalte "Stück geliefert"
eingetragen.
3.8 Die Spalte "Bemerkung" ist besonderen Angaben vorbehalten.
(siehe 2.1) Die Eintragung nimmt nur das Auslieferungs-
lager vor.
3.9 In der Spalte "Erhalten" quittiert der Abholende den
Empfang der Ersatzteile und i n der nebenstehenden
Spalte wird das Empfangsdatum angegeben.
3.10 In der Spalte "Ausgegeben" unterschreibt der Ausgebende
und in der nebenstehenden Spalte wird das Ausgabedatum
eingetragen.
3.11 Die Spalte "Leiter des Reparaturdienstes" wird vom je-
weiligen Leiter des Reparaturdienstes der absendenden
Dienststelle unterschrieben.
Seite 160
Vorschrift
für das Ausfüllen von Reparaturscheinen
Ein Reparaturschein wird nach der Beendigung einer Repa-
ratur bzw. nach Wartung lt. "Wartungsanweisung für das
Schlüsselgerät CM-2" mit Schreibmaschine, Kugelschreiber
oder Tinte (in Blockschrift) ausgefüllt. Die Eintra-
gungen in den Reparaturschein nimmt der Mechaniker vor,
der die Reparatur durchgeführt hat. Ein Reparaturschein
wird nicht ausgefüllt für Arbeiten, die unter Punkt 1.,
2.1, 2.2, 2.3 in der Wartungsanweisung angeführt sind.
Der Mechaniker, der die Reparatur ausführt, ist verant-
wortlich dafür, daß der ausgefüllte Reparaturschein an
den Leiter des Reparaturdienstes des MfS geschickt
wird.
Verschriebene oder ungültig gemachte Reparaturscheine
werden durchgestrichen und wie die gültigen Reparatur-
scheine an den Leiter des Reparaturdienstes des MfS
geschickt.
Der Aufbau des Reparaturscheines (Anlage 1)
1. Gerätenummer: Die Nummer des Gerätes, an dem die
(Maschinennummer:) Reparatur durchgeführt wurde.
2. Dienststelle: Die Nummer der Dienststelle, der die
zu reparierende Maschine gehört.
3. Mechaniker: Die Nummer des Mechanikers, der die
Reparatur durchgeführt hat.
4. Benötigte Stunden: Die Anzahl der Stunden, die zur voll-
ständigen Reparatur einschließlich
Fehlersuche benötigt wurden.
5. Datum: Der Tag, an dem die Reparatur durchge-
führt bzw. begonnen wurde.
6. Zählerstand: Es wird der Zählerstand eingetragen,
der zum Zeitpunkt der Reparatur an-
gezeigt wird.
7. Maschinentype: Es wird eine dreistellige gerätege-
bundene Nummer angegeben. Diese Nummer
wird vom Reparaturdienst des MfS
festgelegt.
8. Fehler:
8.1. Baugruppe: Baugruppe, in der die Fehlerursache
festgestellt wurde. (Anlage 2)
8.2 Fehlernummer: Diese fünfstellige Nummer wird aus
den beiden Tabellen zusammengestellt
a) Benummerung der Teile (Anlage 3)
b) Benummerung der Fehler (Anlage 4)
9. Ersatzteile:
9.1 Nummer: Diese Nummern sind aus der Ersatz-
teilliste zu entnehmen.
9.2 Stück: Die Anzahl der verbrauchten Ersatz-
teile.
10. Art des Fehlers: Es wird aufgeführt, in welcher Art
und Weise der Fehler auftritt und
wie er sich auswirkt.
11. Behebung des Fehlers: Es wird die genaue Behebung des Feh-
lers beschrieben.
Anlage 2
Benummerung der Baugruppen
01 - Chiffrator
02 - Tastatur
03 - Transmitter
04 - Dekombinator
05 - Stromversorgung
06 - Automatikantrieb
07 - Locher
08 - Druckwerk
09 - Wagen
10 - Filter
11 - Antrieb
12 - Grundplatte
13 - Gehäuse mit Konzepthalter
Anlage 3
Benummerung der Teile
001 - Abfühlstift 037 - ...............
002 - Abfallkasten 038 - Elektromagnet
003 - Anschlag 039 - Exzenter
004 - Anschluß 040 - ...............
005 - Andruckrollen 041 - ...............
006 - Ansatzstück 042 - ...............
007 - Auflagestück 043 - ...............
008 - Auslöserahmen 044 - ...............
009 - ............... 045 - Farbband
010 - ............... 046 - Farbbandgabel
011 - ............... 047 - Farbbandführung
012 - ............... 048 - Farbbandumschalter
013 - ............... 049 - Federkontakt
014 - ............... 050 - Führungszylinder
015 - Bedienungshebel 051 - Führungsprismen
016 - Bedienungsknopf 052 - ...............
017 - Blattführung 053 - ...............
018 - Bolzen 054 - ...............
019 - Bügel 055 - ...............
020 - ............... 056 - ...............
021 - ............... 057 - Gehäuseschluß
022 - ............... 058 - Gewinde
023 - ............... 059 - Gleitlager
024 - ............... 060 - Gummikissen
025 - Chiffratordeckel 061 - Gummiwalze
026 - Chiffratorklappe 062 - ...............
027 - ............... 063 - ...............
028 - ............... 064 - ...............
029 - Diode 065 - ...............
030 - Draht 066 - Haltedraht
031 - Drehfeder 067 - Hebel
032 - Druckfeder 068 - ...............
033 - ............... 069 - ...............
034 - ............... 070 - ...............
035 - ............... 071 - Impulskontakt
036 - ............... 072 - Isolation
073 - ............... 112 - ...............
074 - ............... 113 - ...............
075 - Kabelschuh 114 - Nocke
076 - Kardanwelle 115 - ...............
077 - Kardangabel 116 - ...............
078 - Kegelrad 117 - ...............
079 - Klinke 118 - ...............
080 - Kohlebürsten 119 - Ölfilz
081 - Kollektor 120 - ...............
082 - Kontakt 121 - ...............
083 - Kondensator 122 - ...............
084 - Kontaktleiste(n) 123 - ...............
085 - Konzepthalter 124 - Papier
086 - Kupplung 125 - Papierführung
087 - Kugellager 126 - Papierführungskanal
088 - Kugellagersitz 127 - Papierandruckwalze
089 - Kugel 128 - ...............
090 - Kurbel 129 - ...............
091 - ............... 130 - ...............
092 - ............... 131 - .................
093 - ............... 132 - ...............
094 - ............... 133 - Riegel
095 - ............... 134 - Rolle
096 - ............... 135 - Rollenkäfig
097 - Lederstreifen 136 - ...............
098 - Lochabstand 137 - ...............
099 - Lötstelle (kalte) 138 - ...............
100 - Lötleiste 139 - ...............
101 - ............... 140 - Schraube
102 - ............... 141 - Schraubenschlitz
103 - ............... 142 - Schalter
104 - ............... 143 - Schaltrad
105 - Maschine 144 - Schlagbügel
106 - Motor 145 - Scheibe
107 - Motordrehzahl 146 - Schnecke
108 - Mutter 147 - Sicherung
109 - ............... 148 - Sicherungselement
110 - ............... 149 - Spannungswahlschalter
111 - ............... 150 - Sperrschiene
151 - Spiralfeder 189 - Wagenrücklauf
152 - Spule 190 - Wählschiene
153 - Stift 191 - Welle
154 - Stanzstempel 192 - Widerstand
155 - Stanzmatrize 193 - Wicklung
156 - Streifentransportrad 194 - Winkel
157 - Stecker 195 - ...............
158 - Stoßdämpfer 196 - ...............
159 - Stange 197 - ...............
160 - Stiftrad 198 - ...............
161 - ............... 199 - ...............
162 - ............... 200 - Zahnrad
163 - ............... 201 - Zahnstange
164 - ............... 202 - Zählwerk
165 - ............... 203 - Zugstange
166 - ............... 204 - Zugfeder
167 - ............... 205 - ...............
168 - Tastaturkontakt(e) 206 - ...............
169 - Taste 207 - ...............
170 - Tastenhebel 208 - ...............
171 - Transmitterdeckel 209 - ...............
172 - Transmitterklappe 210 - ...............
173 - Trommel
174 - Trafo
175 - Type
176 - Typenhebel
177 - ...............
178 - ...............
179 - ...............
180 - ...............
181 - Unterlegescheibe
182 - ...............
183 - ...............
184 - ...............
185 - Voltmeter
186 - ...............
187 - ...............
188 - ...............
Anlage 4
Benummerung der Fehler
01 - abgebrochen 35 - ...............
02 - abgenutzt 36 - ...............
03 - abgeschert 37 - ...............
04 - abgeschmiert 38 - (zu) hoch
05 - ausgehangen 39 - ...............
06 - ausgelaufen 40 - ...............
07 - ausgelötet 41 - ...............
08 - ............... 42 - ...............
09 - ............... 43 - läuft fest
10 - ............... 44 - locker
11 - beschädigt 45 - ...............
12 - ............... 46 - ...............
13 - ............... 47 - ...............
14 - ............... 48 - ...............
15 - ............... 49 - schief
16 - defekt 50 - schleift
17 - durchgebrannt 51 - (zu) schlaff
18 - durchgeschlagen 52 - (zu) straff
19 - durchgeschliffen 53 - ...............
20 - ............... 54 - ...............
21 - ............... 55 - ...............
22 - ............... 56 - ...............
23 - ............... 57 - taub
24 - falsch justiert 58 - ...............
25 - fehlt 59 - ...............
26 - festgelaufen 60 - ...............
27 - ............... 61 - ...............
28 - ............... 62 - überdreht
29 - ............... 63 - ...............
30 - gebrochen 64 - ...............
31 - gelockert 65 - ...............
32 - gelöst 66 - ...............
33 - geölt 67 - verbogen
34 - gereinigt 68 - verklemmt
69 - verschmort
70 - verschmutzt
71 - verstellt
72 - verstopft
73 - ...............
74 - ...............
75 - ...............
76 - ...............
Fehlerquellen an der CM - 2 und ihre Ursachen
1. Fehler, die im Zusammenhang mit dem Transmitter und dem
Dekombinator auftreten
1.1 Ein Zeichen am Ende der Zeile fällt aus
a) Die Zugstange (Abb. 49/10) hat sich verstellt.
1.2 Die Kombinationen werden verstümmelt
a) Die Abfühlstifte klemmen
b) Die Feder (Abb. 19/51) ist gebrochen oder ausgehangen
c) Die Schienen des Kombinators klemmen oder die Feder an den
Schienen ist ausgehangen oder gebrochen
d) Der Aufzugshebel (Abb. 19/41) hat sich verstellt
e) Der Schrittgruppenabstand des Transmitters hat sich verändert
1.3 Bei Klartext werden keine Zeichen abgedruckt
a) Die Feder (Abb. 19/53) ist ausgehangen oder gebrochen
1.4 Der Transmitter wird bei Wagenrücklauf nicht abgeschaltet
a) Die Zugstange (Abb. 1/34 ) hat sich verstellt
b) Die Zugstange (Abb. 19/26) ist ausgehangen
2. Es liegt keine Spannung an
a) Es liegt ein Drahtbruch in der Netzschnur vor.
b) Der Netzschalter gibt keinen Kontakt.
c) Der Kondensator im Filter ist defekt.
d) Die Sicherung 2 A ist durchgebrannt.
3. Der Elektromotor arbeitet nicht
a) Es liegt keine Spannung an.
b) Zwischen Kohlebürste und Kollektor ist schlechter Kontakt.
c) Der Kollektor ist stark verschmutzt.
d) Die Kohlebürsten sind verklemmt.
e) Der Fliehkraftregler ist geöffnet.
f) Es liegt eine Unterbrechung im Stromkreis der Erregerwicklung
vor.
g) Es liegt eine Unterbrechung im Stromkreis der Ankerwicklung
vor.
4. Defekte die mit dem Nichtabdrucken von Zeichen zusammenhängen
4.1 Der Zeichenabdruck fehlt bei K, D, und C vollständig
a) Die Sicherung 1 A ist durchgebrannt.
b) Der Impulskontakt (IK) ist verschmutzt oder ständig geöffnet.
c) Der Kupplungskontakt (KK) ist geöffnet oder verschmutzt.
d) Der Kontakt am Betriebsartenumschalter ist geöffnet oder
verschmutzt.
e) Es liegt ein Drahtbruch des gemeinsamen Leiters im Chiffrator,
in der Tastatur, im Druckwerk oder in den Übergangskontakt-
leisten vor.
4.2 Der Abdruck von Zeichen fehlt bei D und C vollständig
a) Die Kupplung am Chiffrator ist nicht richtig eingerastet -
der Kupplungskontakt (KK) ist geöffnet.
4.3 Der Abdruck eines oder mehrerer Zeichen fehlt bei K, D und C
a) Der Kontakt in der Übergangskontaktleiste (ÜKL) von der
Tastatur zum Chiffrator und vom Chiffrator zum Druckwerk
fehlt.
b) Das Kunststoffmesser (Abb.4/16) am Tastenhebel ist abge-
brochen.
c) Der Tastaturkontakt schließt nicht.
d) Der Kontakt im Betriebsartenumschalter fehlt.
e) Der Kontakt in der Übergangskontaktleiste der Grundplatte
fehlt.
f) Der Elektromagnet (EM) ist durchgebrannt oder erhält
keinen Strom.
g) Die Stange des Elektromagneten (EM ist verbogen oder fest-
gelaufen.
h) Der Elektromagnet hat sich verstellt.
i) Der Typenhebel hat sich verklemmt.
j) Der Stoßhebel wird nicht freigegeben.
k) Die Feder des Stoß- oder Freigabehebels ist gebrochen
oder ausgehangen.
4.4 Der Abdruck eines oder mehrerer Zeichen fehlt bei D und C
a) Es liegt ein Drahtbruch im feststehenden Teil des Betriebs-
artenumschalters vor.
b) Die Kontaktleisten sind verschmutzt.
4.5 Der Abdruck eines Zeichens fehlt nur in einer der 3
Betriebsarten
a) Der Flächenkontakt im feststehenden Teil des Betriebs-
artenumschalter ist oxydiert.
b) Es liegt eine Unterbrechung der Verbindung, im Betriebs-
artenumschalter vor.
5. Zwei Typenhebel schlagen gleichzeitig an
a) Der Elektromagnet klebt.
b) Der Freigabehebel klemmt.
c) Ein Kontakt der Tastatur ist ständig geschlossen.
6. Einzelfälle, in denen der Zeichenabdruck fehlt
a) Der Typenhebel hat zu viel seitliches Spiel.
b) Die Tastatur ist nicht gut justiert, der Bügel (Abb.4/17)
nimmt die Gleitstücke schlecht mit.
c) Der Elektromagnet (EM) klemmt.
d) Schlechter Kontakt in der Tastatur.
e) Schlechter Kontakt in der Übergangskontaktleiste.
f) Schlechter Kontakt beim Kupplungskontakt (KK) oder am
Kontakt des Betriebsartenumschalters.
7. Defekte, die mit der Tastatur zusammenhängen
7.1 Die Hauptwelle wird dauernd ausgelöst
a) Die Feder (Abb. 2/38) des Auslösehebels ist gebrochen
oder ausgehangen.
b) Die Zugstange (Abb. 2/80) hat sich gestreckt.
c) Der kleine Auslösehebel (Abb. 2/39) klemmt.
d) Der Bügel (Abb. 2/49)ist verbogen.
e) Der Zahn des dreiarmigen Auslösehebels (Abb. 2/43)
ist abgenutzt;.
7.2 Die Tastatur wird während des Wagenrücklaufs nicht blockiert
a) Der Dreizackhebel (Übertragungshebel) hat sich auf der
Achse verdreht.
b) Die Feder der Sperrschiene ist gebrochen oder ausgehangen.
c) Die Sperrschiene klemmt.
d) Die Feder am Hebel (Abb. 2/101) ist gebrochen oder
ausgehangen.
8. Es ist nicht möglich. eine Taste zu drücken
a) Der linke dreiarmige Hebel des Tastaturaufzuges hat sich ver-
stellt (der U-Bügel steht schief).
b) Die Stifte auf den dreiarmigen Hebeln sind abgenutzt.
(der U-Bügel steht schief)
c) Die Spannstange zwischen den beiden dreiarmigen Hebeln ist
zu lang bzw. zu kurz.
d) Der dreiarmige Hebel (Abb. 2/93), der bei Ende des Schlüssel-
lochstreifens anspricht, hat sich verstellt.
e) Die Feder an der 1. Sperrschiene der Tastatur ist ausgehangen
oder gebrochen.
f) Die Sperrvorrichtung gegen ein gleichzeitiges Drücken von
zwei oder mehr Tasten ist nicht richtig eingestellt.
9. Die Kupplung an der Hauptwelle rastet nicht ein
a) Die Auslösevorrichtung ist verstellt.
b) Die große Feder (Abb. 2/57) am dreiarmigen Auslösehebel in
der Tastatur ist gebrochen oder zu schlaff.
10. Fehler, die mit dem Antrieb verbunden sind
a) Die L-förmige Spannstange {Abb. 16/12) hat sich verstellt.
b) Die Stellschrauben des Dreizackhebel (Übertragungshebel)
haben sich verstellt.
c) Die Zahnkupplung für Wagenrücklauf schleift.
d) Die Steuerstange der Wagenrücklauf-Kupplung hat
sich verstellt.
e) Die Schraube am Hebel mit dem Kunststoffklotz hat sich
verstellt.
f) Die Friktionskupplung arbeitet nicht richtig.
11. Nicht einwandfreies Arbeiten der Hauptwelle
a) Die Feder des Feststellhebels ist gebrochen oder ausgehangen.
b) Die Zahnkupplung pfeift.
c) Die Zahnkupplung ist defekt.
12. Defekte im Druckwerk
12.1 Undeutlicher Abdruck der Zeichen
a) Das Farbband ist abgenutzt.
b) Die Typen sind verschmutzt.
c) Die Farbbandumkehrung ist defekt.
d) Der Typenhebel ist verbogen.
e) Der Typenhebel hat im Führungskamm zu viel Spiel.
f) Der Abwurfbügel ist nicht richtig eingestellt.
g) Die Druckfeder ist zu schlaff (die Rolle drückt nicht
fest genug auf den Nocken).
h) Die Type hat sich auf dem Typenhebel gelockert oder
verschoben.
12.2 Bei "BL" werden die Zeichen nicht richtig gestanzt
a) Die Elektromagneten (EM) im Druckwerk haben sich verstellt.
b) Eine der Federn an den Kombinatorschienen ist herunterge-
sprungen oder gebrochen.
c) Eine Schiene des Kombinators schleift oder die Auflage-
stücke des Lochers klemmen.
12.3 Die Farbbandumschaltung funktioniert nicht
a) Die Fähnchen, die auf die Farbbandrolle drücken,
haben sich verstellt.
b) Das Kegelrad vom Farbbandantrieb hat sich gelockert
und stellt.
13. Defekte, die mit dem Locher zusammenhängen
13.1 Der Schrittgruppenabstand beträgt nicht 2,54 mm
a) Die Streifentransporttrommel hat sich verstellt.
b) Die Feder des Rasthebels am Streifentransportrad ist ge-
brochen oder ausgehangen.
c) Der Streifenvorschub ist nicht richtig eingestellt.
d) Der Streifen stößt an die Führung an.
e) Die Streifentransporttrommel schleift. Die Achse hat sich
seitlich verschoben.
f) Der Papierandruckhebel drückt zu stark oder zu schwach
auf die Transporttrommel
g) Die Stellschrauben, die den Streifenvorschub bei Wagen-
rücklauf, Zeilenvorschub und Zwischenraum steuern, haben
sich verstellt.
h) Der Exzenter des Bügels (Abb. 21/27) hat sich verstellt.
i) Der Hebel (Abb. 21/26) hat sich verstellt (Wagenrücklauf
und Zeilenvorschub werden beim Drücken der Wagenrücklauf-
taste nicht richtig gestanzt).
j) Die Lochstreifenvorratsrolle ist falsch eingelegt.
k) Es ist dünneres bzw. dickeres Lochstreifenpapier eingelegt
worden.
13.2 die Löcher werden schlecht in den Streifen gestanzt
a) Der Bügel, der die Stanzstifte zurückführt,
hat sich verstellt.
b) Der Papierabfallkasten ist voll.
c) Der Streifen schleift in der Papierführung.
d) Die Stanzstempel sind stumpf.
e) Die Stanzstempel klemmen in der Führung.
13.3 Keine richtige Gruppenteilung im hergestellten Geheimtextstreifen
a) Die Stoppstellung des Rastrades (Abb. 21/6) ist nicht rich-
tig eingestellt.
b) Der Hebel "Teilung" steht in einer Zwischenstellung.
c) Die Bügel mit den Auflagestücken für Steuerkombinationen
haben sich verstellt.
d) Die Schaltklinke (Abb. 21/48) des Zeichenzählwerkes hat
sich verstellt.
e) Die Rastklinke (Abb. 21/3) für den Antrieb des Zählwerkes
ist abgenutzt.
f) Der Streifenvorschub ist nicht richtig eingestellt.
14. Defekte, die mit dem Wagen verbunden sind
14.1 Die Zeichen werden übereinander geschrieben
a) Die Wagenfortschaltung ist nicht richtig eingestellt.
b) Die Aufzugfeder (Abb. 16/7) ist nicht straff genug aufge-
zogen.
c) Das Zahnrad des Rollenkäfigs hat sich verbogen oder
ist verschmutzt.
d) Die Rastklinken (Abb. 16/39, 40) schleifen oder sind ver-
schmutzt.
e) Die Zahnräder (Abb. 16/9, 10, 11) sind festgelaufen.
14.2 Der Wagen geht nicht auf das erste Zeichen zurück
a) Die Feder der Rastklinke (Abb. 16/39, 40) ist schlaff
geworden.
b) Der erste Zahn der Zahnstange (Abb. 16/41) ist abgenutzt.
c) Die Blockierung der Wagenfortschaltung während des Wagen-
rücklaufes hat sich verstellt. (Bügel Abb. 25/20, 22)
14.3 Der Wagentransport wird nicht eingeschaltet
a) Die Hebel für die Wagenfortschaltung in der Grundplatte
haben sich verstellt.
b) Die Zugstange für die Wagenfortschaltung in der Grundplatte
ist verklemmt.
14.4 Falsche Gruppenteilung des Textes
a) Die Zahnstange für Gruppenteilung am Wagen hat sich ver-
stellt oder ist verbogen.
b) Die Feder des Wagenauslösebügels ist heruntergesprungen.
c) Die Spannstange (Abb. 52/7) oder der Hebel (Abb. 52/2) für
die Einstellung der Gruppenteilung sind verstellt bzw. ver-
bogen.
14.5 Kein richtiger Zeilentransport
a) Die Gummiwalze schleift.
b) Die Papierandruckwalzen schleifen.
c) Der Sektor (Abb. 16/27) für den Zeilentransport hat sich
verstellt.
15. Defekte, die mit dem Chiffrator verbunden sind
15.1 Die Maschine wird bei "C" blockiert
a) Der Exzenter am Gummikissen hat sich verstellt.
b) Der Hebel (Abb. 33/14) schleift.
c) Der schwarze Bolzen (Abb. 34/27) ist verklemmt.
d) Die Feder am Abfühlhebel, der das Steuerloch beim Schlüs-
sellochstreifen abfühlt, ist heruntergesprungen.
e) Die Feder am Hebel (Abb. 33/39) ist zu straff.
f) Das Gummikissen ist abgenutzt oder durch Öl zersetzt.
15.2 Der Schlüssellochstreifen wird im Transportloch eingerissen
a) Konfetti ist unter den Deckel gekommen.
b) Der Stanzstempel ist stumpf.
c) Die gerändelte Rolle am Chiffratordeckel schleift.
d) Die Exzenter der Streifenführung haben sich verstellt
oder gelockert.
15.3 Die Maschine blockiert bei "C" und "D"
a) Der Aufzug der Sperrvorrichtung des Chiffrators hat
sich verstellt.
b) Der dreiarmige Rebel, der die 2. Sperrschiene steuert,
hat sich verstellt.
c) Die 2 Stützschrauben unter der Tastatur sind zu stark
angezogen.
GVS 2038/63
Ex.-Nr. 000*
90 Blatt
| Handbuch |
| für das Schlüsselgerät CM-2 |
| Das Schlüsselgerät CM-2 |
1. Allgemeine Hinweise:
Das halbautomatische buchstabenschreibende Schlüsselgerät
CM-2 (Abb. 1) kann auf drei Betriebsarten eingestellt werden:
a) Klartext - K
b) Dechiffrieren - D
c) Chiffrieren - C
Die Umschaltung von einer Betriebsart zur anderen erfolgt
mit dem Betriebsartenumschalter (21). Die Eingabe des Textes
erfolgt manuell von Tastatur (25) oder automatisch, indem ein
Lochstreifen in den Transmitter eingegeben wird. Die Lochung
des Textes erfolgt nach dem Internationalen Telegraphenal-
phabet Nr. 2 (5 Kanäle), in einen 17,5 mm breiten Lochstreifen.
Das Schlüsselgerät gestattet die Anwendung von drei Arbeits-
arten:
a) Schreiben des Textes auf Blatt - B
b) Schreiben des Textes auf Blatt bei gleichzeitiger
Lochung im Streifen - BL
c) Lochung im Streifen - L
Der Übergang von einer auf die andere erfolgt mit
Hilfe des Arbeitsartenumschalters (20). Im Prinzip arbeitet das
Schlüsselgerät elektromechanisch.
Die nominelle technische Geschwindigkeit des Schlüsselgerätes
ist 500 Zyklen/min.
Die mechanischen Teile des Schlüsselgerätes werden durch
einen Universal-Elektromotor Typ SL 369 uA 1 in Bewegung
gesetzt. Die Speisung erfolgt vom Wechselstromnetz mit einer
Spannung von 100-250 V und einer Frequenz von 50 Hz, oder
Gleichstrom mit einer Nennspannung von 110 V.
Zur Ausrüstung des Schlüsselgerätes gehören:
a) Ersatzteilkasten I
b) Werkzeugkasten
c) 1 Transportkiste für das Schlüsselgerät
d) 1 Transportkiste für Ersatzteil- und Werkzeugkasten
Abmessungen des Schlüsselgerätes: 509x488x285 mm
Gewicht des Schlüsselgerätes ohne Transportkiste 46,75 kg
Abmessung der Transportkiste für das Schlüsselgerät:
618x548x327 mm
Gewicht des Schlüsselgerätes mit Transportkiste: 62,2 kg
Abmessung der Transportkiste für Ersatzteil- und
Werkzeugkasten 520x438x115 mm
Gewicht der Transportkiste: 10,25 kg
Gesamtgewicht des Schlüsselgerätes mit Zubehör: 72,45 kg
2. Aufbau des Schlüsselgerätes CM-2 (Abb. 1)
Das Schlüsselgerät CM-2 besteht aus einzelnen Baugruppen.
Die mechanische Verbindung zwischen den einzelnen Baugrup-
pen erfolgt durch Zahnradgetriebe und Zugstangen; die elek-
trische Verbindung durch Kontaktleisten. Alle Baugruppen des
Schlüsselgerätes sind auf einer Grundplatte montiert.
Von unten wird die Grundplatte mit einer Bodenplatte ver-
schlossen. Der elektrische Anschluß des Schlüsselgerätes an
Netz erfolgt durch Schukostecker (34).
Entsprechend der Art des Stromes, wird der Hebel (13) auf
(Gleichstrom) oder (Wechselstrom) gestellt. Der Spannungs-
wahlschalter (27) wird entsprechend der vorhandenen Netz-
spannung eingestellt. Gleichzeitig wir der Stromartenstecker
am Motor des Schlüsselgerätes unter dem Deckel (16) des Ge-
häuses (2) entsprechend gesteckt. Bei Speisung vom Wechsel-
stromnetz wird die Spannung auf der Skala des Voltmeters
(28) kontrolliert. Das Gehäuse, das die Baugruppen des Schlüs-
selgerätes verdeckt, besitzt drei Klappdeckel (12), (16), (35). Da-
durch ist es möglich, das Gehäuse abzunehmen, ohne den Wa-
gen des Schlüsselgerätes entfernen zu müssen. Das Gehäuse ist
rechts und links an der Grundplatte durch zwei unverlierbare
Schrauben (9) befestigt. An dem Gehäuse kann man einen Kon-
zepthalter (1) zur Ablage von Formblättern mit dem zu be-
arbeitenden Text befestigen.
Formblätter, auf die der Text geschrieben wird, werden in den
Wagen (11) eingespannt. Durch den Schalter (23) wir das
Schlüsselgerät an das Netz angeschlossen.
Die Einstellung des Schlüsselgerätes erfolgt gemäß der durch-
zuführenden Arbeit, indem man den Betriebsartenschalter
(21) auf K
, D
oder C
stellt. Der Arbeitsumschalter (20) wird
ebenfalls entsprechend der durchzuführenden Arbeit in eine
der drei angeführten Stellungen (B, BL, L) gebracht.
Das Eintasten des zu bearbeitenden Textes geschieht auf der
Tastatur; sie hat 26 Tastenhebel (25), die Zwischenraumtaste
(26) und die Wagenrücklauftaste. Die Tastenhebel haben Buch-
stabenbezeichnung, die Taste für Wagenrücklauf ist nicht be-
sonders gekennzeichnet. Die Tastatur ist mit einer Verkleidung
(4) versehen.
Bei automatischer Texteingabe wir der gelochte Streifen in
die Streifeneinführung des Transmitter eingelegt und die Klappe
(36) geschlossen. Der Transmitter wir eingeschaltet, indem
man auf den Knopf EIN
drückt. Bei Drücken des Knopfes
AUS
erfolgt die Abschaltung.
Das Auslösen des Transmitters nur für einen Zyklus erfolgt
durch Drücken des Knopfes AUS
. Durch Drehen der Scheibe
(29) kann der Lochstreifen um jede erforderliche Anzahl von
Schritten in beide Richtungen fortbewegt werden.
Beim Chiffrieren oder Dechiffrieren wird der Schlüsselloch-
streifen in die Streifeneinführung des Chiffrators (24) gelegt und
die Klappe (22) geschlossen.
Die verschlüsselten bzw. entschlüsselten Zeichen werden durch
den vierstelligen Zähler (18) gezählt. Beim dechiffrieren ist die
Möglichkeit, den Schlüssellochstreifen von Hand aus mit der
Kurbel (15) in beide Richtungen zu bewegen, vorgesehen.
Beim Schreiben von Klartext sowie beim Chiffrieren und De-
chiffrieren kann der bearbeitete Text mit Hilfe des Lochers (14)
im Fünfercode in den Streifen gestanzt werden. Der Locher hat
ein Zeichenzählwerk mit Zwischenraumgeber, das beim Chiff-
rieren nach je 5 Zeichenkombinationen die Kombination Zwi-
schenraum und nach je 10 Fünfergruppen die Kombination
Wagenrücklauf und Zeilenvorschub bringt. Das Ein- und Aus-
schalten des Zeichenzählwerkes mit Zwischenraumgeber erfolgt
durch Betätigung des Schalters (8) in die Stellung EIN
bzw.
AUS
.
Das Einschalten des Lochers für Streifenvorlauf erfolgt durch
Drücken des Knopfes (5). Es wird die Kombination Zwischen-
raum gelocht. Das Einschalten des Lochers für einen Schritt,
wobei nur das Transportloch gestanzt wird, erfolgt durch den
Schalthebel (3). Die ausgestanzten Papierteilchen fallen in den
Abfallkasten (10).
Die Vorratsrolle mit dem Lochstreifen ist in einer Kassette,
die sich in der Grundplatte befindet. Beim Rollenwechsel wird
die Kassette am Knopf (19) herausgezogen.
Der Text, der beim Chiffrieren gedruckt wird, wird automatisch
in Fünfergruppen zu je 10 Gruppen pro Zeile geteilt.
Diese Teilung in Fünfergruppen kann auch bei Arbeiten mit
Klartext erfolgen, wenn der Hebel (17) in die Stellung EIN
gebracht wird.
2.1. Baugruppen des Schlüsselgerätes CM-2
01) Chiffrator
02) Tastatur
03) Transmitter
04) Dekombinator
05) Stromversorgung
06) Automatikantrieb
07) Locher mit Zeichenzählwerk und Zwischenraumgeber
08) Druckwerk
09) Wagen
10) Filter
11) Antrieb
12) Grundplatte
13) Gehäuse mit Konzepthalter
1. Tastatur Über die Tastatur wird der Text manuell in das Schlüsselgerät eingegeben. Bei der Betätigung einer Taste wird die Haupt- welle des Schlüsselgerätes für einen Arbeitszyklus ausgelöst. (Siehe 1.2. Auslösevorrichtung). Die Tastatur hat 26 Tastenhebel, auf deren Tastenköpfen die 26 Buchstaben des deutschen Normalalphabetes eingraviert sind. Außerdem hat die Tastatur eine Zwischenraumtaste, um die geschriebenen Wörter zu trennen und eine Wagenrücklauf- taste. Nach Drücken der Wagenrücklauftaste erfolgt der Zei- lenvorschub und der Wagen fährt automatisch an den Anfang der neuen Zeile zurück. An die Tastatur werden zusätzlich folgende Forderungen, die die Arbeit an dem Schlüsselgerät erleichtern, gestellt: a) Arretierung des betätigten Tastenhebels für die Zeit eines Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes in der unteren Stellung. b) Es muß unmöglich sein, die Hauptwelle auszulösen, wenn zwei oder mehrere Tastenhebel gleichzeitig gedrückt wer- den. (Rollensperre) c) Es muß unmöglich sein, die Hauptwelle durch Drücken einer Taste auszulösen, wenn der automatische Wagen- rücklauf erfolgt. d) Die Tastenhebel, die bei der gegebenen Arbeit nicht ge- braucht werden, müssen blockiert werden können. Diese Forderungen und auch die Auslösung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes für einen Arbeitsgang werden durch folgende mechanische Gruppen erfüllt: a) Tastenhebel b) Auslösevorrichtung c) Auslösesperre bei Drücken von zwei oder mehr Tasten (Rollensperre) d) Sperrvorrichtung e) Sperrschienen f) Tastenhebel Wagenrücklauf g) Zwischenraumtaste Das Funktionsschema ist auf Abb. 2 abgebildet. 1.1. Tastenhebel (Abb. 4) Die Tastenhebel drehen sich frei auf der Achse (11). Das rechte Ende des Tastenhebels wird von der Feder (12) herunterge- zogen. Die Federspannung kann man verstärken, indem man die Feder in das Gewinde der Leiste, die an der Tastaturplatte befestigt ist, hineinschraubt. Die Spannung dieser Feder ist ausschlaggebend für den auf den Tastenhebel auszuübenden Anfangsdruck. Die linken Enden der Tastenhebel liegen in den Ausschnitten des Führungskammes. Auf der Tastaturplatte sind Kontaktgruppen in zwei Reihen angeordnet (13) und (15). Jeder Tastenhebel hat ein Gleitstück (9), das sich in Längs- richtung des Tastenhebels auf den Stiften (8) und (10), die in den Hebel eingenietet sind, verschieben kann. Jedes Gleit- stück hat ein Kunststoffprisma (16) oder (14), das aus Isolier- stoff besteht, dieses steht in der Ausgangsstellung des Tasten- hebels entweder über der ersten oder der zweiten Reihe der Kontaktgruppen. Am linken Teil des Tastenhebels befindet sich ein Messer (4), das beim Betätigen einer Taste die Rollen der Auslösesperre so verschiebt, daß ein Anlaufen der Haupt- welle des Schlüsselgerätes beim Drücken einer weiteren taste verhindert wird. Bei bestimmten Arbeitsbedingungen muß ver Anlauf der Hauptwelle bei Betätigen gewisser Tasten ausge- schlossen sein. Diese Forderung wird durch die Sperrschienen erfüllt, die mit den Nasen der linken Enden der Tastenhebel zusammenwirken. Bei Betätigen eines Tastenhebels wird er Auslöserahmen (5) nach unten verschoben und wirkt seiner- seits auf die Auslösevorrichtung ein und bewirkt das Anlaufen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes. Dabei nehmen die Nase (18) des Gleitstückes (9) und der U-Rahmen (17) eine Stellung ein, wie es in (Abb. 4 B) gezeigt ist; bei Ansprechen der Aus- lösevorrichtung wird das Gleitstück von dem U-Rahmen (17) in die rechte Endstellung gebracht. Die obere Nase (6) des Gleitstückes schiebt sich unter die Schiene(7) und verhindert dadurch die Rückkehr der Tasten- hebels in die obere Ausgangsstellung, nachdem die Taste los- gelassen wird (Abb. 4 C). Das Prisma (16) oder (14) liegt zwi- schen den Kontakten (15) oder (13) und schließt sie. Kurz vor Ende des Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes kehrt der Tasten- hebel in seine obere Ausgangsstellung zurück. 1.2. Auslösevorrichtung (Abb. 2) Nachdem eine Taste betätigt wurde, spricht die Auslösevor- richtung an. Die Kontaktgruppe der Tastatur wird geschlossen. Die Hauptwelle des Schlüsselgerätes wird für einen Arbeits- zyklus, der einer Umdrehung der Welle entspricht, freigegeben. Die Auslösevorrichtung arbeitet wie folgt: Bei Betätigung der Taste E, z. B., drückt die untere Kante des Tastenhebels den rechten Teil des Auslöserahmens (13) nach unten und bewegt die Achse (16) im Uhrzeigersinn. Dabei wirkt der Hebel (40), der starr mit der Achse des Auslöserahmens verbunden ist, mit seinem unteren Arm auf die Hebel (39) und (47) ein und klinkt den Hebel (45) aus dem dreiarmigen Hebel (43) aus. Die rechten Arme der Hebel (43) und (2) sind durch eine ver- stellbare Zugstange (15) verbunden. Die mittleren Arme sind durch die Begrenzungshebel (41) und (83) mit dem U-Rahmen (48) verbunden. Nach Freigabe der Hebel (45) und (43) bewegt sich der U-Rahmen (48) zusammen mit dem eingefallenen Gleitstück (6) unter dem Einfluß der Feder (57) nach links. Das Prisma des Gleitstückes schließt die Kontaktgruppe (58). Dabei klinkt der Hebel (81), der starr mit dem dreiarmigen Hebel (82) verbunden ist, durch die Zugstange (80) die Halte- klinke aus dem getrieben Teil der Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes aus. Die Hauptwelle mach eine Umdrehung und gegen Ende der Umdrehung wird die Auslösevorrichtung durch einen Nocken, der auf der Hauptwelle steht, in die Ausgangsstellung gebracht. Indem der U-Rahmen am Ende des Arbeitsganges auf den ab- geschrägtem Arm des Hebels (49) aufläuft, wir der Hebel (39) aus dem Hebel (47) bei der Rückkehr der U-Rahmens in die Ausgangs- stellung vorbereitet. Nach Betätigen der Taste eines Tasten- hebels bleibt dieser bis gegen Ende des Zyklus in der unteren Stellung, weil die obere Nase des Gleitstückes (60) sich unter der unteren Kante der Schiene (78) befindet. Das Gleitstück wird erst wieder vom U-Rahmen (48) bei der Rückkehr mit weggezogen. 1.3. Sperrvorrichtungen 1.3.1. Auslösesperre (Rollensperre) Die Auslösesperre (Abb. 5) verhindert das Anlaufen der Haupt- welle des Schlüsselgerätes wenn gleichzeitig mehr als ein Tastenhebel gedrückt wird. Als Grundplatte für die Rollensperre dient der Bügel (2) mit den eingefrästen Schlitzen, in denen die Messer (4) der Tasten- hebel liegen. Durch die vordere und hintere Wand der Grund- platte (2) gehen die Achsen (3) um die sich die U-Bügel (8) frei drehen können. Auf den Achsen dieser Bügel liegen Rollen (7). Auf der Abb. 5 ist die Rollensperre dargestellt, nachdem das Messer (4) des Tastenhebels die untere Stellung eingenommen hat. Ein Teil der Rollen sind dadurch nach rechts und ein Teil der Rollen nach links verschoben. Die äußeren Rollen stoßen an die Anschläge (6) und (9), deren Stellung durch die Schrau- ben (1) mit Kontermuttern einjustiert werden kann. Diese Stellung der Auslösevorrichtung entspricht dem Zeitpunkt, in dem die Hauptwelle des Schlüsselgerätes anläuft. Wenn gleichzeitig 2 oder mehr Tastenhebel betätigt werden, dann verhindern die Rollen (7) eine Bewegung der Messer in die untere Grenzstellung, und der Anlauf der Hauptwelle ist nicht möglich. 1.3.2. Sperrung der Tastatur während des automatischen Wagen- rücklaufes (Abb. 2) Die Hebel (84) und (109) sind mit dem rechten Arm des Hebels (82) verbunden. Zusammen mit ihm führen sie während eines jeden Zyklus eine Hin- und Herbewegung aus. Nachdem das 58. Zeichen der Zeile auf dem Papier abgedruckt ist, wird die Zugstange (74) durch den Wagen über ein Hebelsystem nach links verschoben, und mit ihr drehen sich die Hebel (84) und (85). Der Ansatz (98) des Hebels (109) stellt sich gegenüber dem Ansatz des Hebels (86). Beim folgenden 59. Zyklus klinkt der Hebel (109) mit seinem Ansatz den Hebel (86) aus der Sperr- schiene (22) aus. Unter dem Zug der Feder verschiebt diese sich nach rechts. Die Zähne der Sperrschiene legen sich unter die nichtgedrückten Tastenhebel und Verhindern, daß sie gedrückt werden. Ein betätigter Tastenhebel wird in der unteren Stel- lung von einem Zahn der Sperrschiene festgehalten, indem er in die Aussparung am rechten Ende des Tastenhebels einfällt. Nach dem Wagenrücklauf verschiebt sich die Zugstange (74) nach rechts und stellt mit dem Hebel (85) die Ausgangsstellung der Sperrelemente wieder her. 1.3.3. Sperrung der Tastatur, wenn beiKim Chiffrator ein Schlüssellochstreifen eingelegt wird (Abb. 2) Wenn bei der Betriebsart Klartext im Chiffrator ein Schlüssel- lochstreifen eingelegt wurde, so wird die Stange (68), die mit dem in der Streifenführung hervorstehenden Knopf verbun- den ist, heruntergedrückt. Über Zwischenelemente (69, 72, 62, 52) wir der Hebel (39) ausgehakt, wodurch ein Anlaufen der Hauptwelle nach Betätigung eines Tastenhebels unmöglich ist. 1.3.4. Sperrung der Tastatur, wenn im Chiffrator der Schlüsselloch- streifen zu Ende ist (Abb. 2) Nachdem der Schlüssellochstreifen, der in den Chiffrator ein- gelegt wurde, zu Ende ist, d. h. wenn im Streifen die 32. Kom- bination vorhanden ist, sprechen die Bauelemente an, die die Zugstange (96) freigeben. Diese geht in die untere Stellung. Da- bei entfernt sich der Hebel (8) von der Sperrschiene 2 (9) und gibt dieser die Möglichkeit, sich nach rechts zu verschieben, die Tastenhebel zu blockieren und das Anlaufen der Hauptwelle unmöglich zu machen. Die Hebel (92), (91) und die Zugstange (90) schalten gleichzeitig den Transmitter aus, indem sie auf dessen Auslöseelement einwirken. 1.3.5. Sperrung der Tasten Zwischenraum, Wagenrücklauf undXIn der Tastatur befinden sich die Sperrschiene 3 (20), die es er- möglichen, bestimmte Tastenhebel in Abhängigkeit von der Stellung des Betriebsartenschalters zu sperren. Die Sperrschiene wird durch die Nocken (6) Abb. 6 gesteuert. BetriebsartK(Abb. 6a) Wird der Betriebsartenumschalter aufKgestellt, so bewegt sich die Sperrschiene 3 (3) in der Längsrichtung auf 2 Stiften (2) und (7). Alle Tastenhebel können ungehindert betätigt werden. BetriebsartD(Abb. 6b) Steht der Betriebsartenumschalter aufD, so sperrt die Schiene (3) die Zwischenraumtaste (1) und die Wagenrücklauf- taste (5). BetriebsartC(Abb. 6c) Steht der Betriebsartenumschalter aufC, so sperrt die Schiene (3) die TastenX(4) und WR (5). 1.4. Wagenrücklauftaste (Abb. 2) Die Wagenrücklauftaste dient dazu, über die Wagenrücklauf- welle den Wagen aus einer beliebigen Stellung in die Anfangs- stellung zu bringen. Bei Betätigen der Wagenrücklauftaste läuft die Hauptwelle des Schlüsselgerätes an und der Elektro- magnet am Locher, der die Auflagestücke von Wagenrücklauf und Zeilenvorschub steuert, zieht an. Bei Drücken der Wagenrücklauftaste wir der Hebel (79) so- wie die Zugstange (73), die in den Zahn (65) des Hebels (66) eingreift, bewegt. Am ende der Bewegung rastet die Zug- stange (73) aus dem Zahn des Hebels (66) aus. Der Hebel (66) schaltet mit der Stange (74) über weitere Hebel die Kupplung für den Wagenrücklauf ein. Bei Ende des Wagenrücklaufes wird der Hebel (66) durch die Zugstange (74) in seine Aus- gangsstellung zurückgebracht. Nachdem die Wagenrücklauf- taste losgelassen wird, rastet die Zugstange (73) wieder in den Zahn des Hebels (66) ein. 1.5. Zwischenraumtaste (Abb. 2) Die Zwischenraumtaste besteht aus der Leiste (18) und 2 He- beln (11) und (21), die durch die Zugstange (14) verbunden sind. Die Bewegung dieses Systems bei Drücken der Leiste (18) wird über die Zugstange (23), die Hebel (31) und (26) auf den Hebel (54) übertragen, der auf die Auslösevorrichtung der Tastatur einwirkt. 2. Transmitter Transmitter und Dekombinator sind zum automatischen Ein- tasten der Zeichen vorgesehen. Das Funktionsschema des Transmitters und des Dekombinators ist in (Abb. 19) dar- gestellt. Der Transmitter besteht aus: a) Hauptwelle mit einer Start-Stopp-Kupplung b) Auslösevorrichtung, die ein einmaliges Anlaufen der Hauptwelle und ihr Anhalten gewährleistet c) Abfühleinrichtung d) Streifentransportvorrichtung e) Sperrvorrichtungen 2.1. Hauptwelle des Transmitters (Abb. 19) Die Hauptwelle des Transmitters besitzt eine ähnliche Start- Stopp-Kupplung wie die Hauptwelle des Schlüsselgerätes. Der treibende Teil der Kupplung wird von dem sich ständig dreh- enden Teil der Hauptwelle des Schlüsselgerätes über die Kar- dangabel (19) und zwei Zahnräder bewegt. Die Stoppstellung der Hauptwelle wird durch den Nocken (30), den Hebel (31) mit Rolle und Feder (33) fixiert. Die Start- Stopp-Kupplung besitzt eine Sperrnase (36), in die der Hebel (16) einrastet und eine Sperrnase an der Stirnfläche des ge- triebenen Kupplungsteils (32), in die der Hebel (20) einrastet. 2.2. Auslösevorrichtung Die Auslösevorrichtung des Transmitters besteht aus 2 Stan- gen mit den Knöpfen (1)EINund (2)AUS, den Gleitstük- ken (11) und (13), dem Hebel (16) und dem Sperrbügel (3) mit der Feder (5). Wird auf den KnopfEINgedrückt, so verschiebt die Stange das Gleitstück (11). Dieses dreht mit dem auf ihm befindlichen Finger den Hebel (16). Dadurch wir die Sperrnase (36) der Start-Stopp-Kupplung freigegeben und die Umdrehung der Hauptwelle ist möglich. Der Sperrbügel (3) wird durch die Feder (5) in die rechte Kerbe der Stange (1) ein- gerastet. Dadurch wird sie in dieser Stellung festgehalten und gewährleistet so eine blockierungsfreie Arbeit der Hauptwelle. Zum Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung und damit zum An- halten der Hauptwelle muß der KnopfAUSgedrückt werden. Dabei wird der Sperrbügel durch die Schräge der Kerbe der Stange, die mit dem KnopfAUSverbunden ist, angehoben und das Gleitstück (11) kehrt mit Stange (1) in seine Ausgangs- stellung zurück. Die Kupplung wird ausgerastet. Das Anlaufen der Hauptwelle für einen Arbeitszyklus erfolgt durch Drücken auf den KnopfAUS. Dabei führt das Gleitstück (13) und der mit ihm verbundene Hebel (14) das Gleitstück (11) mit sich. Durch den auf ihm be- findlichen Finger wir der Hebel (16) geschwenkt und die Sperrnase (36) freigegeben. Die Start-Stopp-Kupplung rastet ein. Am Ende der ersten Umdrehung der Hauptwelle wird der Hebel (18), durch den Feststellhebel (319 nach oben geschoben. Mit seinem rechten Arm rastet er den Hebel (14) aus dem Gleitstück (11) aus, das unter Einwirkung seiner Feder nach rechts geschoben wird. Der Hebel (16) legt sich gegen die Sperrnase (36), wodurch die Kupplung ausgerastet und die Hauptwelle angehalten wird. 2.3. Abfühlvorrichtung (Abb. 19) Die Abfühlvorrichtung besteht aus fünf Abfühlhebeln (42), den 5 Ansatzstücken (43), dem Hebel (10), dem Nocken (9) und den mit den Abfühlhebeln verbundenen Federn (51). Nach dem Anlaufen der Hauptwelle wird der Hebel (10) durch den Nocken (9) angehoben. Der rechte Arm des Hebels (10) gibt die Abfühlhebel frei, die sich unter dem Einfluß der Federn (51) haben. Wenn in dem Lochstreifen, welcher in den Transmitter eingelegt ist, gegenüber einem Abfühlstift kein Loch vorhanden ist, so hebt sich dieser bis er an den Streifen stößt. Ist gegen- über einem Abfühlstift ein Loch vorhanden, so geht er hindurch und hebt die auf ihm liegenden Ansatzstücke (43) mit an. Nach einer gewissen Zeit, die durch das Zeitdiagramm des Schlüssel- gerätes angegeben wird, werden alle Abfühlhebel durch den Hebel (10) wieder in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht. 2.4. Streifentransportvorrichtung In jedem Arbeitszyklus des Transmitters muß sich der Loch- streifen um einen Schritt weiterbewegen. Der Vorschub des Streifens erfolgt nach dem Abtasten der Zeichenkombination durch die Abfühlstifte und deren Rück- kehr in die untere Stellung. Der Streifentransport geht wie folgt vor sich: Der Nocken (12) schwenkt den Hebel (15) mit der Schaltklinke (38). Diese greift in einen Zahn des Schaltrades (39) ein und dreht sich weiter. Dadurch wird die Streifentransporttrommel (40) ebenfalls um einen Schritt weiter gedreht. Die Stifte, die sich an der Streifentransporttrommel (4) befinden, greifen in die Transportlöcher des Streifens ein und bewegen diesen so- weit vorwärts, bis die nächste Zeichenkombination den Ab- fühlstiften der Abfühlhebel (42) gegenüberstehen. Die beiden Finger (37) begrenzen die Bewegung der Schaltklinke (38) und verhindern eine Bewegung auf Grund der Trägheit des Schalt- rades (39) und der Streifentransporttrommel (40). 2.5. Sperrvorrichtungen 2.5.1. Anhalten des Transmitters für die Zeit des Zeilenvorschubs und Wagenrücklaufs Bei Weiterschaltung des Wagens vom 1. bis einschließlich 57. Schritt nimmt die Sperrvorrichtung die in (Abb. 19) angeführte Stellung ein. Die Zugstange (34) ist nach rechts geführt, und das Ansatz- stück (29) gelangt nicht unter die Einwirkung des Hebels (28). Der Hebel (22) ist durch den Arm (25) des Hebels (21) blockiert. Der Hebel (20) kann nicht in die Sperrnase der Start-Stopp- Kupplung (32) eingreifen. Nach Vollendung des 58. Schrittes durch den Wagen wird die Zugstange (34) vom wagen über Zwischenelemente nach Links geschoben. Das Ansatzstück (29) befindet sich dann mit seiner Nase an der rechten Seite unter dem Hebel (28). Im 59. Zyklus des Transmitters drückt der Nocken (23) über den Hebel (28), das Ansatzstück (29) und die Stange (26) auf den unteren Arm des Hebels (21). Der obere Arm (25) des Hebels (21) gibt den Hebel (24) frei. Unter dem Einfluß der Feder (27) dreht sich die Achse mit den Hebeln (20), (22) und (24). Der Hebel (20) greift in die Sperrnase des Hebels (36) ein und rastet die Start-Stopp-Kupplung aus. Am Ende des Wagen- rücklaufes schiebt der Wagen die Zugstange (34) nach rechts und schwenkt nach Überwindung der Kraft der Feder (27) die Hebel (22), (24) und (20). Der Hebel (21) dreht sich unter Ein- wirkung seiner Feder und fällt in die Einkerbung des Hebels (24) ein. Der Hebel (20) gibt die Sperrnase der Start-Stopp- Kupplung frei. Die Start-Stopp-Kupplung rastet ein und arbeitet blockie- rungsfrei bis zum nächsten Wagenrücklauf. Das Anhalten des Transmitters für die Zeit des Zeilenvorschubs und Wagenrücklaufes erfolgt nur dann, wenn die 59. Kombi- nation, die abgetastet wird, eine Zeichenkombination und keine Steuerkombination ist, d. h. wenn es eine Kombination ist, die vom Anlaufen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes be- gleitet ist. Zum Beispiel kann beim Dechiffrieren die 59. Kombi- nation eine Steuerkombination (Zwischenraum, Wagenrück- lauf, Zeilenvorschub oder 32. K.) sein. In diesem Falle läuft die Hauptwelle des Schlüsselgerätes nicht an. Ist die 59. Kombi- nation aber Buchstaben- oder Ziffernumschaltung, so läuft die Hauptwelle an. Um ein vorzeitiges Anhalten auszuschließen, ist in das Blok- kierungssystem des Transmitters beim Wagenrücklauf eine Stange (26) einbezogen, die vom Auslösebügel der Tastatur über die Stoßstangen (103), (102) Abb. 2 arbeitet. Beim Anlaufen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes gleitet die Stange (26) Abb. 19 nach links und schiebt ihren Ansatz unter den Hebel (29). Durch den Nocken (23) und die Hebel (28), (29), (26), (21) und (20) wird der Transmitter angehalten. Ist die 59. Schrittgruppe eine Steuerkombination (außer Buchsta- ben- und Ziffernumschaltung), so läuft die Hauptwelle des Schlüsselgerätes nicht an, der Ansatz der Stange (26) befindet sich nicht unter dem Hebel (29). Der Transmitter wird nicht gestoppt. 2.5.2. Das Anhalten des Transmitters, wenn im Schlüssellochstreifen eine 32. Kombination erscheint, oder der Streifen nicht mehr transportiert wird Die Zugstange (52) wird in einem solchen Falle nach rechts ge- bracht und schwenkt dadurch den Hebel (54). Der letztere hebt mit der abgeschrägten Kante seines linken Armes den Sperr- bügel (3) an und löst ihn von der KnopfstangeEIN. Sie springt nach rechts; die Start-Stopp-Kupplung des Trans- mitters wird ausgerastet. 2.5.3. Blockieren des Transmitters bei Erscheinen der 32. Kombi- nation Wird keine Wählschiene (44) verschoben, so fällt der Hebel (5) in die Aussparung der Wählschienen (44) ein und hebt mit seinem unteren Arm den Bügel (3) aus der KnopfstangeEINaus. 3. D e k o m b i n a t o r Der Dekombinator ist das ausführende Organ des Transmitters, der das Anlauf der Hauptwelle des Schlüsselgerätes nach Drücken auf einen bestimmten Tastenhebel je nach der Kombi- nation im Lochstreifen bewirkt. Der Dekombinator ist als selbständiges Organ ausgeführt, das sich an dem Transmitter befindet. Der Dekombinator besteht aus den 5 Wählschienen (44) Abb. 19 mit den Federn (48), den Hebeln (45) und dem Schlag- bügel (47). In Stoppstellung der Hauptwelle des Transmitters sind alle Wählschienen (44) nach rechts verschoben. Zwischen ihren lin- ken Kanten und den Ansatzstücken (43) besteht ein kleiner Spielraum. Die Hebel (45) werden durch den unteren Teil des Schlagbügels (47) von den Kanten der Wählschienen (44) ent- fernt. Nach Anlaufen der Hauptwelle des Transmitters und der Einstellung der Abfühlhebel (42) sowie der Ansatzstücke (43) in Abhängigkeit von der Kombination im Streifen, geht der He- bel (41), der die Linksbewegung der Wählschienen (44) be- grenzt, zurück und ermöglicht den Wählschienen (44) sich unter der Wirkung der Federn (48) in Richtung der Ansatz- stücke (43) zu verschieben. Jeder Wählschiene (44) steht ein Ansatzstück (43) gegenüber. Stehen die Ansatzstücke unten, so verhindern sie die Links- bewegung der Wählschienen (44). Es bewegen sich nur die Schienen (44) hinter dem Hebel (41) nach links, deren Ansatzstücke (43) durch die Abfühlhebel hochgezogen wurden. In den Kanten der Wählschienen sind Aussparungen. Nachdem sich der Hebel (41) nach links bewegt hat, nehmen je nach der Kombination im Lochstreifen die Wählschienen (44) eine Stel- lung ein, wo einem Hebel (45) die Aussparungen aller 5 Schie- nen gegenüberliegen. Nachdem die Schienen nach der Kombination im Lochstreifen eingestellt sind, tritt der Schlagbügel (47) in Aktion, der durch den Hebel (46) vom Nocken (6) über die Zugstange (4) und (49) gesteuert wird. Der untere Arm des Bügels schwenkt nach rechts. Einer der Hebel (45) kann unter Federeinwirkung in die gemeinsam vor- handenen Aussparungen der Wählschienen einfallen. Bei der Weiterbewegung des Bügels schlägt dessen linker Arm auf den Ansatz des oberen Teils des Hebels (45), der in die Aussparung eingefallen ist. Dabei wird ein bestimmter Tastenhebel ge- drückt. Die Hauptwelle des Schlüsselgerätes läuft an. Danach beginnt sich der Bügel (47) in entgegengesetzter Rich- tung zu bewegen und führt den eingefallenen Hebel wieder aus der Aussparung heraus. Die übrigen bringt er in Aus- gangsstellung. Zwischen den Hebeln (45) und den Kanten der Wählschienen (44) muß etwas Spielraum sein. Am Ende des Zyklus werden die Schienen (44) durch den Hebel (41) in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht. 4. L o c h e r Der Locher hat die Aufgabe, den in die Tastatur, mit Hand oder automatisch, eingegebenen Text im Fünfercode des Internatio- nalen Telegraphenalphabetes Nr. 2 in den Streifen zu lochen. Beim Chiffrieren können die Kombinationen, die in den Strei- fen gelocht werden, selbständig durch die KombinationZwi- schenraumin Fünfergruppen jeweils nach 10 Fünfergruppen durch die KombinationWagenrücklaufundZeilenvorschubgetrennt werden. Dazu besitzt der Locher einen Zeichenzähler mit Zwischen- raumgeber, der beim Chiffrieren in die Arbeit mit einbezogen werden kann. Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber arbeitet im gleichen Zyklus wie der Locher und erfordert keinen zu- sätzlichen Zeitaufwand. Bei der Arbeit mit Klartext und bei Dauerauslösung ZW wir der Zeichenzähler mit Zwischen- raumgeber in Ausgangsstellung gebracht (für das erste Zeichen der ersten Fünfergruppe der Zeile) und behält diese Stellung bis zum Übergang zum Chiffrieren bei. Das Lochen der SteuerkombinationenZwischenraum,Wa- genrücklaufu.Zeilenvorschuberfolgt gleichzeitig mit dem Lochen der fünften Zeichenkombination einer Fünfergruppe und je nach Anzahl der gleichzeitig gelochten Kombinationen erfolgt ein Streifentransport von 1, 2 oder 3 Schritten. Zum Lochen findet Lochstreifenpapier mit einer Breite von 17,5 mm Verwendung. 4.1. Eingabe und Lochen der Fünferschrittgruppen Die Eingabe der Kombinationen in den Locher erfolgt durch die Wählschienen des Kombinators des Druckwerkes. Die Wählschienen andern bei ihrer Bewegung die Stellung der He- bel (42) Abb. 20, deren vertikale Arme durch die Zugstangen (41) und die Hebel (28) die Auflagestücke (27) des Lochers steuern. Der Locher besitzt 12 Stanzstempel, die in drei Reihen ange- ordnet sind. (Abb. 20 - Schema für die Anordnung der Auf- lagestücke). a) In der ersten Reihe befinden sich 5 Stempel (18) zum Lochen der Kombinationen und 1 Stempel (19) zum Lochen der Transportlöcher. b) In der zweiten Reihe liegen 3 Stempel zum Lochen der Steuerkombinationen und 1 Stempel zum Lochen der Transportlöcher. c) In der dritten Reihe befindet sich 1 Stempel zum Lochen einer Steuerkombination und 1 Stempel zum Lochen von Transportlöchern. Wir haben also im Locher insgesamt 9 Stempel zum Lochen von Kombinationen und 3 Stempel zum Lochen von Transportlöchern. In Stoppstellung des Schlüsselgerätes befinden sich die 5 Auf- lagestücke (27) unter dem Stanzbügel (31). Das Auflagestück (26) liegt immer (außen beim Drücken der WR-Taste) unter dem Stanzbügel (31), über dem Stempel (1). der in jedem Zy- klus die Transportlöcher stanzt. 4.2. Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber (Abb. 21) Der Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber ist zum Steuern der Auflagestücke (29), (31) und (32) vorgesehen, die in einer be- stimmten Stellung über den Stempeln zum Lochen der Steuer- kombinationen angeordnet sind, sowie zum Steuern des Bügels (18), mit dessen Hilfe der Vorschub des Streifens um 1, 2 oder 3 Schritte erreicht wird. 4.2.1. Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber beim Chiffrieren Beim Chiffrieren werden die Elemente des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber durch die Scheiben (21) und (23) ge- steuert, die auf der Achse (22) sitzen. In Abb. 21 ist die Ausgangsstellung des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber vor dem Chiffrieren gezeigt. In jedem Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes vollführt der Nocken (49) eine Umdrehung und der Hebel (48), der drehbar auf dem Hebel (50) gelagert ist, vollzieht eine Vor- und Rück- wärtsbewegung, wobei er das Schaltrad (51) um eine fünfzig- stel Umdrehung verschiebt. Die Schalträder (51) und (4) sind auf einer Buchse angebracht, die sich auf der Achse (56) frei dreht. Die Stellungen der Achse (56) werden durch den Hebel (7) und die Scheibe (6) festgehalten, die mit der Achse (56) starr ver- bunden ist. An der Scheibe (6) befindet sich die Rastklinke (3), die drehbar gelagert ist. Sie greift in das Schaltrad (4) ein. Die Umdrehung des Schaltrades (51) überträgt sich über das Schaltrad (4), den Hebel (3) und die Scheibe (6) auf die Achse (56). Die auf der Achse (56) angebrachte Scheibe (23) besitzt 9 Zähne, die jeweils unter einem Winkel von 36° angeordnet sind. Der Winkel zwischen dem 1. und dem 9. Zahn beträgt 72°. Die Scheibe (21) besitzt nur einen Zahn, der zwischen dem 9. und 1. Zahn der Scheibe (23) angeordnet ist. In Ausgangsstellung des Zeichenzählers mit Zwischenraum- geber liegt sich der Zahn auf der Scheibe (21) und der Zahn auf dem Hebel (46) gegenüber. Dabei bewegt sich der Bügel (33) mit den Auflagestücken (29) entgegen dem Uhrzeigersinn und zwar durch die Spannung der Feder (40), die auf den Bügel (41) wirkt. Mit einer Schraube drückt dieser auf den Arm des Bügels (27), der mit dem Bügel (33) verbunden ist. Das linke Auflagestück (29) hat eine Nase, die bei einer Be- wegung das Auflagestück (31), das am Bügel (35) befestigt ist, mitnimmt und nach links bewegt. Die Ausgangsstellung der Auflagestücke (29), (31), (32) ist in (Abb. 20 Stellung II) dar- gestellt. 4.2.2. Automatisches Lochen von Zwischenraum Das Zusammentreffen des Zahnes am Hebel (20) mit den Zähnen der Scheibe (23) erfolgt am Anfang des 5. Zyklus einer jeden Fünfergruppe (1.-9. Gruppe) des Geheimtextes. Beim Zusammentreffen des Zahnes am Hebel (20) mit den Zähnen der Scheibe (23) geht der Stift (39) nach oben. Dadurch erhält der Bügel (38) die Möglichkeit, sich zu drehen. Er drückt mit der Stellschraube auf den Bügel (34) mit dem Auflagestück (32). Dieser bewegt sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Bei seiner Be- wegung zieht der Bügel (34) mit einer Schraube den Bügel (35) mit dem Auflagestück (31) mit. Dabei erhalten die Auflagestücke eine Stellung, die ein Lochen der SchrittgruppeZwischenraum(Abb. 20 Stellung III) er- möglichen. Der nach unten geführte linke Hebelarm (20) bringt über den Hebel (17) den Bügel (18) in eine Stellung, bei der nach dem Lochen der SchrittgruppeZwischenraumein Streifenvor- schub von 2 Schritten erfolgt. Wenn der Zahn des Hebels (20) zwischen den Zähnen der Scheibe (23) liegt, werden die Bügel (38), (34) und (35) durch Federspannung vom Stanzbügel weg- geführt (Abb. 20 Stellung I). 4.2.3. Automatisches Lochen von Wagenrücklauf und Zeilenvorschub Vor dem Lochen der Schrittgruppe , die dem 5. Zeichen in der 10. Fünfergruppe des Geheimtextes entspricht, werden der Zahn der Scheibe (21) und der Zahn des Hebels (46) einander gegenübergestellt. Das Auflagestück wird in die oben beschrie- bene Stellung gebracht, in der auf dem Streifen gleichzeitig mit dem Lochen der KombinationenWagenrücklaufundZeilen- vorschub(Abb. 20 Stellung IV) gelocht werden. Dabei bringt der linke Arm des Hebels (46) über den Hebel (17) den Bügel (18) in eine Stellung, in der im Arbeitszyklus ein Streifen- vorschub von 3 Schritten erfolgt. Die Stellung des Bügels (18) verändert sich unter der Einwir- kung der Hebel (19), (20) und (46), die die Anzahl der Schritte in jedem Arbeitszyklus angeben. 4.3. Streifentransport Wenn die Rolle des Hebels (45) auf dem kleinen Radius des Nocken (44) sieht, ist die Streifenvorschubklinke (16) in ihrer oberen Stellung. Sie liegt mit ihrer Nase auf dem Bügel (18). Der Bügel (18), der durch den Hebel (17) eingestellt wird, läßt die Klinke (16) bei Vollführung ihres Arbeitsganges in den ersten, zweiten oder dritten Zahn am Schaltrad (15) (von der Sperrstellung aus gerechnet) einfallen und die Achse (14) in den entsprechenden Winkel drehen. Beim Chiffrieren drückt der Hebel (11), der mit dem Bügel (54) starr verbunden ist, auf den Stufenklotz (12). Dieser geht zu- rück und der Schaltbügel (13) kann ohne Behinderung zurück- gehen. 4.4. Abschalten des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber (Abb. 21) Es erfolgt beim Umstellen des Betriebsartenschalters aufKundD. BeiCdurch Ausschalten des Hebels (2), Abb. 26 oder durch Drücken des Knopfes Dauerauslösung ZW oder Auslösen der 32. Kombination. Dabei schwenkt der Hebel (55) den Bügel (54) im Uhrzeigersinn. Sein unterer Arm stellt sich über den Zwischenhebel (1). Der Hebel (5) kann sich nicht mehr im Uhrzeigersinn drehen. Er stellt sich dem unteren Teil des Hebels (3) in den weg, der beim Auftreffen auf den Hebel (5) aus dem Schaltrad (4) ausrastet. Die Mitnehmerscheibe (6) bleibt in ihrer festen Lage, die der Ausgangslage vor dem Chiffrieren entspricht. Der Hebel (11), der mit dem Bügel (54) verbunden ist, gibt dem Stufenklotz (12) die Möglichkeit, sich als Stützfläche unter den Bügel (13) zu stellen und den Leer- und Arbeitslauf der Schaltklinke (16) zu begrenzen, indem er im Arbeitszyklus nur einen Streifen- vorschub von einem Schritt zuläßt. Der rechte Arm des Bügels (54) schwenkt die Bügel (38) und (41) im Uhrzeigersinn. Durch die Spannung der Federn verschieben sich die Bügel mit den Auflagestücken (29), (31) und (32) in der gleichen Richtung. Die Einstellung der Auflagestücke für diesen Fall ist in Abb. 20 Stellung I dargestellt. 4.5. Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber, wenn die Taste WR/ZV gedrückt wird (Abb. 21) Wenn das Schlüsselgerät im Klartext arbeitet, sprechen nur einige Teile des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber an, wenn auf die Wagenrücklauftaste gedrückt wird. In diesem Falle müssen in den Streifen die Kombinationen Wagenrück- lauf und Zeilenvorschub gelocht werden. Das Drücken auf die Wagenrücklauftaste ist vom Anlaufen der Hauptwelle be- gleitet. Die Wicklung des Elektromagneten erhält einen Stromimpuls. Die Stange (25) bringt bei Ansprechen des Magneten den Hebel (24) außer Eingriff mit dem Bügel (26). Der Bügel (26) dreht sich unter Einwirkung der Spannung der Feder (28) entgegen dem Uhrzeigersinn. Er nimmt mit einer Stellschraube (30) den Bügel (33) mit dem Auflagestück (29) und das Auflagestück (31) mit dem Bügel (35) mit. Die Auflage- stücke werden zum Lochen der SchrittgruppenWagenrück- laufundZeilenvorschubnach links geschoben (Abb. 2 Stel- lung V). Der Bügel (27) bringt mit seinem Arm (19) den Bügel (18) in eine Stellung, in der der Lochstreifen um 2 Schritte vorwärts gerückt wird. Gleichzeitig drückt der rechte Arm des Hebels (19) auf einen Stift am Stufenklotz (12) und ermöglicht so, daß der Bügel (13) bis zum mittleren Anschlag des Stufenklotzes zurückgehen kann. Am Ende eines Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes rastet der Hebel (37), der auf dem Nocken (36) läuft, den Bügel (26) in den Hebel (24) ein. Der Bügel (33) mit den Auflagestücken (29) kehr unter Federspannung in seine Ausgangsstellung zurück. 5. A u t o m a t i k a n t r i e b (Abb. 22) Die Automatikgetriebewelle (32) ist mit der Kardangabel (36) und der Kardanwelle mit dem sich ständig drehenden Teil der Hauptwelle des Schlüsselgerätes verbunden. Die ständig Um- drehung wird auf folgende Bauteile des Schlüsselgerätes über- tragen: a) über das Zahnrad (34) auf den treibenden Teil (31) der Start-Stopp-Kupplung des Lochers b) über die Kegelräder (26), die Welle (19), die Kegelräder (16) und die Kardangabel (15) auf den treibenden Teil der Start-Stopp-Kupplung des Transmitters 5.1. Steuerung der Start-Stopp-Kupplung des Lochers Der Locher arbeitet, wenn der Arbeitsumschalter aufLoderBLsteht. In diesen Fällen wird die Start-Stopp-Kupplung des Lochers durch den Nocken (41), der sich auf der Hauptwelle des Schlüs- selgerätes befindet, gesteuert. Zu Beginn eines Zyklus wird die Rolle (42) des Hebels (43) durch den Nocken (41) nach rechts geführt. Der untere Arm des Hebels (43) der auf die Kupp- lungsnase (45) drückt, schiebt diese nach unten und dreht die Welle (47) um einen bestimmten Winkel im Uhrzeigersinn. Dadurch wird der Hebel (40) mit der Achse (39) und dem Hebel (38) gedreht. Der Hebel (38) rastet aus der Sperrnase des ge- triebenen teils der Start-Stopp-Kupplung des Lochers aus. Beim Einrasten der Star-Stopp-Kupplung überträgt sich die Drehbewegung auf die Welle (29) und über die Kegelräder (37) und (35) auf die Nockenwelle (33) des Druckwerkes. Am Ende der Umdrehung wird der getriebene Teil der Start- Stopp-Kupplung durch den Hebel (38) ausgerastet und die Stellung der Welle (29) durch den Nocken (27) und dem He- bel mit der Feder (22) fixiert. Steht der Arbeitsumschalter aufB, so wird der Locher durch den Hebel (48) gesperrt, dessen unterer Arm unter der Feder- spannung (49) in die Vertiefung des Nocken (50) geführt wird. Der Nocken (50) befindet sich auf der Welle des Arbeitsum- schalters. Die Nase der Kupplung (45) wird vom unteren He- belarm (43), der die Start-Stopp-Kupplung einrastet, zurück- geführt. 5.2. Einschalten des Lochers für die Dauerauslösung des Streifen- transportes (Abb. 22) Der Lochstreifen, in den die Fünfergruppen gestanzt werden, muß ein Anfangsstück mit einigen eingelochten SchrittgruppenZwischenraumbesitzen. Zu diesem Zweck wird der Locher von Hand aus durch Drük- ken des Knopfes (14), der sich an der linken Wand der Grund- platte befindet, für die Dauerauslösung des Streifentransportes eingeschaltet. Dabei schiebt der mit dem Knopf (14) verbun- dene Hebel (13) das Gleitstück (2) nach rechts. Das Messer (52), das aus Isolierstoff besteht, schließt den Kontakt (1), der im Stromkreis der Wicklung des Elektromagneten fürZwischen- raumliegt. Dieser spricht an. Der Freigabehebel fällt in die Aussparung der Wählschienen des Kombinators des Druck- werkes ein. Der Locher wird zum Lochen der SchrittgruppeZwischenraumvorbereitet. Der mit dem Gleitstück (2) verbundene Bolzen rastet den He- bel (38) aus der Sperrnase des getriebenen Teils der Start- Stopp-Kupplung (31) aus. Die Kupplung rastet so lange ein, bis der Knopf (14) in seine Ausgangsstellung zurückkehrt. In den Streifen wird in jedem Arbeitszyklus die SchrittgruppeZwischenraumgelocht. Am Anfang eines Jeden Zyklus des Lochers geht der Hebel (25) auf den kleinen Radius des Nocken (28) über. Der Hebel (51) greift mit seiner Nase am unteren Hebelarm hinter das Gleitstück (2) und bleibt in dieser Stel- lung bis zum Ende eines jeden Zyklus. Wenn am Ende der letzten Umdrehung der Locherwelle der Druck auf den Knopf (14) aufhört, wird der Hebel (51) durch den Nocken (28) beim Gleitstück (2) ausgerastet. Dabei verschiebt sich das Gleitstück (2), da es unter Feder- spannung steht, nach links und die Kontaktfedern (2) öffnen sich. Der getriebene Teil der Start-Stopp-Kupplung (31) kommt durch den Hebel (38) in Sperrstellung. Die Hebel (25), (51) und der Nocken (28) wurden deshalb mit in das System einbezogen, weil es notwendig ist, den Kontakt (1) und den getriebenen teil der Start-Stopp-Kupplung gleichzeitig auszuschalten, da ein vorzeitiges Öffnen des Kontaktes (1) dazu führen kann, daß auf dem Lochstreifen statt der SchrittgruppeZwischenraumnur ein Transportloch gestanzt wird. 5.2.1. Betätigen des Knopfes für Dauerauslösung ZW beim Chiffrieren Bei Dauerauslösung des Lochers zu dem obengenannten Zweck wird der Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber durch die Hebel (4) und (23), die auf den Bügel (24) des Zeichen- zählers mit Zwischenraumgeber wirken, abgeschaltet. 5.3. Einschalten des Lochers zum Lochen der 32. Kombination Der Locher wird in diesem Falle durch den Hebel (18) ge- steuert, der auf der linken Seite des Automatikantriebes an- gebracht ist. Die Hebel (18) und (7) sind mit der Welle (8) starr verbinden. Auf dem Hebel (7) ist der zweiarmige Hebel (10) drehbar gelagert. Er greift in den Hebel (17) ein. Die He- bel (17) und (5) sind durch eine gemeinsame Welle fest ver- bunden. Wenn der Hebel (18) entgegen dem Uhrzeigersinn zum Anschlag gebracht wird, schiebt der obere Arm des Hebels (5) die ihn berührenden unteren Hebelarme der Hebel (4) und (38) nach rechts. Wird der Hebel (18) beim Chiffrieren betätigt, so wird über den Hebel (4) und (23) der Zeichenzähler mit Zwischenraum- geber abgeschaltet. Der Hebel (38) rastet die Start-Stopp- Kupplung (31) des Lochers ein. Zu Beginn des Zyklus geht die Hebelrolle, die auf dem Nocken (27) läuft, auf dessen größeren Radius über. Der untere Hebelarm drückt auf den Hebel (9). Dieser drückt seinerseits auf den Arm des Hebels (10). Durch die Spannung der Feder (12) dreht sich der Hebel (17). Mit ihm dreht sich der Hebel (5). Die Hebel (4) und (38) gehen bis zum Anschlag nach Links. Sie kehren in ihre Ausgangsstellung zurück, in der der Hebel (38) in die Sperrnase des getriebenen Teils der Start-Stopp- Kupplung (31) eingreift und diese am Ende des Zyklus aus- rastet. Wird der Hebel (18) in Ausgangsstellung gebracht, rasten die Hebel (10) und (17) wieder ein. Das System ist zum weiteren Anlaufen des Lochers für einen Zyklus bereit. 5.4. Start-Stopp-Kupplung des Lochers (Abb. 23 und 24) Auf der Welle (1) ist der Nocken (2) verstiftet, auf dessen Na- be ist die getriebene Scheibe (6) mit der Rolle (7) angebracht. Die Rolle (7) wird auf dem Nocken (2) durch eine Halterung gehalten, die auf der getrieben Scheibe (6) angebracht ist. Die Mitnehmerschale (5) wird von dem Teil der Hauptwelle des Schlüsselgerätes bewegt, der nicht zum Start-Stopp-Teil gehört. In ausgerasteter Stellung der Kupplung führt die getriebene Scheibe (6), die an der Nase (8) gehalten wird, die Rolle (7) in die Mitte des Nockens (2). Zwischen der Rolle (7) und der Schale (5) bildet sich ein Zwi- schenraum, der es der Schale (5) ermöglicht, sich frei zu be- wegen und der Welle (1) Ruhestellung einzunehmen. Beim Lösen der Scheibe (6) dreht sich diese unter der Feder- spannung (10) entgegen dem Uhrzeigersinn und ermöglicht der Rolle (7) sich zwischen die Schale (5) und den Nocken (2) zu keilen, worauf sich die Welle (1) mit der Geschwindigkeit der Schale (5) zu drehen beginnt. Zum Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung und zum Anhalten der Welle (1) muß die Scheibe (6) an einer der beiden Nasen festgehalten werden. Durch das Anhalten der Scheibe (6) verschiebt sich die Rolle (7), der Nocken (2) wird gelöst und die Welle (1) bleibt stehen. Die Kugel (4) mit der Feder (3) dient dazu, ein Überholen des treibenden teils der Kupplung durch die Bauteile des getrie- benen Teils zu verhindern. 6. C h i f f r a t o r Der Chiffrator dient zur Umwandlung des Klartextes in ver- schlüsselten Text, wenn der Betriebsartenumschalter aufCgestellt ist und des verschlüsselten Textes in Klartext, wenn der Betriebsartenumschalter aufDsteht. Die Umwandlung der Zeichen des Klartextes in Geheimtext er- folgt, indem jedes Zeichen des Klartextes mit Zeichen über- schlüsselt wird, die als Kombinationen in einen Schlüsselloch- streifen gelocht sind. Bei Einstellung des Betriebsartenumschalters aufKwerden die mechanischen und elektrischen Bauteile des Chiffrators abgeschaltet. Die Außenansicht des Chiffrators ist in Abb. 28 dargestellt. Der Chiffrator besteht aus folgenden Teilen: a) dem Antrieb (4) b) den KontaktleistenKL(1) c) dem Transmitter (6) d) dem Betriebsartenumschalter (3) e) dem Gruppenzähler (5) Die Teile des Chiffrators sind auf einer Grundplatte befestigt. 6.1. Antrieb (Abb. 29) Der Antrieb dient zum Übertragen der Umdrehung von der Hauptwelle des Schlüsselgerätes auf die Hauptwelle des Chiff- rators. Der Antrieb stellt einen selbständigen Teil dar, der auf einer Grundplatte montiert ist und an der Grundplatte des Chiffrators durch 4 Schrauben befestigt wird. Die Hohlwelle (1) des Antriebes besitzt 2 Kugellager. Das Zahnrad (23) dreht sich frei auf der Hohlwelle (16) und befindet sich im ständigen Eingriff mit dem Zahnrad (22) der Hauptwelle des Schlüssel- gerätes. Das Zahnrad (19) hat die Möglichkeit, sich axial auf der Hohl- welle (16) zu bewegen und mit seiner Buchse in die Buchse (21) des Zahnrades (23) einzugreifen. Die Hauptwelle des Chiffra- tors wird durch das Zahnrad (19) in Umdrehung versetzt. Wird der Betriebsartenumschalter aufCoderDgestellt, so geht der untere Arm des Hebels (6) auf den kleinen Radius des Nockens (7) über. Der obere Arm des Hebels (6) neigt sich nach rechts, wobei sich der Stift (9), der unter Spannung der Feder (11) steht, sich in der gleichen Richtung verschiebt. Das Zahnrad (19) verschiebt sich unter Wirkung der Feder, die auf der Hohlwelle (16) zwischen der Buchse (17) und dem Zahnkranz des Rades (19) angebracht ist, nach rechts bis zum Eingriff mit der Buchse (21) des Zahnrades (23). In diesem Falle wir die Umdrehung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes auf die Hauptwelle des Chiffrators übertragen. Wenn der Betriebsartenumschalter aufKgestellt wird, wird der untere Arm des Hebels (6) durch den Nocken (7) nach rechts geführt. Der obere Arm rastet mit dem Stift (9) die Buchsen (19) und (21) aus. in diesem Falle überträgt sich die Umdrehung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes nicht auf die Hauptwelle des Chiffrators. 6.1.1. Benutzung der Kurbel Zum Schlüsselgerät gehört die Kurbel (1), mit deren Hilfe die Hauptwelle des Chiffrators in beide Richtungen von Hand aus gedreht werden kann. Dazu wird die Stange der Kurbel so- weit in die Öffnung der Hohlwelle (16) geschoben, bis das Stan- genende am Stift (20) anschlägt, der mit der Buchse des Zahn- rades (19) fest verbunden ist. In der Hohlwelle (16) befindet sich ein Zapfenloch, durch wel- ches der Stift (20) ragt. Wenn die Stange der Kurbel (1) auf den Stift (20) drückt, wird die Buchse (19) aus der Buchse (21) des Zahnrades (23) aus- gerastet. Dabei gelangt der Bolzen (25) des Mitnehmers (24) in die Nut der Kurbel. Wird bei dieser Stellung der Bauteile die Kurbel (1) gedreht, so dreht sich mit der Welle (16) die starr mit dieser verbun- dene Buchse (17). Die Buchse (17) besitzt 2 Finger, die in die Öffnungen des Zahnrades (19) eingreifen. Dieses überträgt die Drehung auf die Hauptwelle des Chiffrators. 6.1.2. Benutzung der Kurbel beim Dechiffrieren Die Benutzung der Kurbel ist nur beim Dechiffrieren möglich und ist beim Chiffrieren ausgeschlossen. Im letzten Falle, wenn der Betriebsartenumschalter aufCsteht, führt der Nocken (15) den unteren Arm des Hebels (13) zurück. Der obere Arm des Hebels (13) kommt gegenüber dem Zahnkranz der Buchse (19) zu liegen. Dadurch wird verhindert, daß die Buchse (19) aus der Buchse (21) ausgerastet wird. Nach dem Gebrauch der Kurbel müssen die Buchsen (19) und (21) ein- gerastet werden. 6.1.3. KupplungskontaktKKIn dem Antrieb sind Bauteile eingebaut, die kontrollieren, ob die Buchsen (19) und (21) beiK,DundCdes Betriebs- artenumschalters richtig gekuppelt sind. Sie verhindern, daß das Druckwerk im Falle einer Störung der normalen Tätigkeit des Antriebes arbeitet. Steht der Betriebsartenumschalter aufK, so öffnet der un- tere Arm des Hebels (5) über den Stift (4) das obere Feder- paar des Kupplungskontaktes (2) und der untere Hebelarm (8) schließt mit seinem Finger 83) das untere Kontaktpaar. Steht der Betriebsartenumschalter aufCoderD, so sind die unteren Hebelarme (5) und (8) nach unten gestellt, wodurch das obere Kontaktpaar geschlossen und das untere geöffnet ist. Sind infolge Benutzung der Kurbel oder aus anderen Gründen die Buchsen (19) und (221) nicht eingeklinkt, so sind alle Federn des Kupplungskontaktes 82) geöffnet und die Bauteile des Druckwerkes stromlos. 6.2. Kontaktleisten (KL) (Abb. 36) Die KontaktleistenKLschalten in jedem Arbeitszyklus die Stromkreise des Druckwerkes des Schlüsselgerätes entspre- chend den Kombinationen des Schlüssellochstreifens. Die Kontaktleisten sind auf einer Metallplatte (2) angebracht, die an der rechten Wand der Grundplatte des Chiffrators be- festigt ist, sowie an der Klappe (5). Die Platte 82) und die Klappe (5) sind im unteren Teil durch das Scharnier 84) ver- bunden und im oberen Teil durch das Schloß 81) befestigt. Auf der Platte (2) sind 2 leisten (8) und 2 Leisten (6) angebracht, die aus Kunststoff mit eingepreßten Kontakten bestehen. Die Leisten (8) sind mit der Platte (2) starr verbunden, und die Leisten (6), die auf den Prismen (10) mit kugeln (7) liegen, können sich in bestimmten Grenzen entlang der Prismen auf und ab bewegen. In der Klappe (5) befinden sich auf Kugel- prismen (10) drei Leisten (9), die ebenfalls verschiebbar sind. In den Leisten (9) befinden sich die Kontakte (11) mit Federn, die den erforderlichen Kontaktdruck hervorgerufen. Jede Leiste besitzt eine Gabel (3), durch die sie mit dem Bauteil des Chiff- rators verbunden ist, das das verschieben der Leiste bewirkt. In jedem Arbeitszyklus verändern sich die LeistenKLihre Stel- lung. Sie nehmen entweder die obere oder die untere Stellung ein. 6.3. Transmitter des Chiffrators Der Transmitter beinhaltet 2 Systeme: 6.3.1. System der Bauteile, die in jedem Zyklus arbeiten: a) es verstellt jede der 5 Schienen der KontaktleistenKLje nach der Kombination des Schlüssellochstreifens in seine obere oder untere Stellung. b) es sperrt die Tastenhebel und verhindert, daß der Trans- mitter mit Dekombinator nach Ende des Schlüsselloch streifens mit Dekombinator nach Ende des Schlüsselloch- streifens anspricht. c) es macht unmöglich, daß nur mit einer Kombination überschlüsselt wird, wenn der Schlüssellochstreifen aus verschiedenen Gründen nicht transportiert wird. 6.3.2. System der Bauteile, die beim Umschalten des Betriebsarten- umschalters arbeiten: a) es macht unmöglich, daß dem Nachrichtensachbearbeiter bei der Benutzung des Schlüssellochstreifens Fehler unterlaufen b) es läßt beim Umschalten des Betriebsartenumschalter vonKaufDdie Hauptwelle des Schlüsselgerätes für einen Arbeitszyklus anlaufen. Dabei werden gleichzeitig der Gruppenzähler und die Weiterschaltung des Wagens gesperrt. 6.3.3. Konstruktive Ausführung des Transmitters (Abb. 31 und 30) Auf der oberen Platte84) Abb. 31 befinden sich eine Streifen- führung, in die der Schlüssellochstreifen eingelegt wird. An der Außenseite der hinteren Platte liegt die Hauptwelle (1) des Transmitters, die die Nockenwelle (3) über die Zwischenwelle (2) bewegt. Auf dem Winkel 88) befindet sich der Gruppenzähler (7). Die Zahnräder (6), (9) und (10) übertragen die Bewegung von der Hauptwelle (1) auf die Streifentransportwelle. An der vorderen platte812) Abb. 30 ist die Rastklinke 88) der Streifentransport- welle mit dem Rastrad (7) angebracht, sowie das Zwischenrad 83) zum übertragen der Bewegung von der Zwischenwelle (1) des Betriebsartenumschalters mit dem Zahnrad (2) auf die Nockenwelle (4) der Kontroll- und Sicherungseinrichtung und Stütze (10) mit dem Lager der Nockenwelle (9). 6.4. Das Verstellungssystem der KontaktleistenKLentsprechend den Schlüsselkombinationen (Abb. 32) Der Schlüssellochstreifen kann nur in die Streifeneinführung ein- gelegt werden, wenn der Betriebsartenumschalter aufKsteht und der Deckel der Streifenführung geöffnet ist. Beim Einschalten des Betriebsartenumschalters aufKbringen die Zahnstange (20) und das Zahnrad (21) die Welle (12) in die Stellung die in Abb. 32 dargestellt ist. Dabei befinden sich der Hebel (10) auf dem maximalen Radius des Nocken (11) und der Hebel (2) liegt unter dem Anschlag (25) des Hebels (22), Abb. 33, und bringt diesen in die obere Stellung. Nachdem der Betriebsartenumschalter aufDoderCge- stellt wird, liegt der Hebel (10) auf dem kleinen Radius des nockens (11). Der Bügel (2) befindet sich in der unteren Stel- lung. Am Anfang eines Arbeitszyklus fällt die Rolle des Hebels (42) in die Vertiefung des Nockens (47) ein, die Abfühlhebel (9) können sich unter der Spannung der Feder 834) heben. liegt einem der Abfühlhebel auf dem Streifen ein Loch gegenüber, so hebt er sich nach oben. Die übrigen verschieben sich nur so- weit, bis sie den Streifen berühren. Die nach oben vor- gestoßenen Abfühlhebel heben die Hebel (8) an, deren untere Arme aus den Einstellstücken (6) ausklinken. Danach läßt die Klappe (43), die vom Nocken (44) gesteuert wird, die ausgeklinkten Einstellstücke (6) unter dem Druck der Feder (7) nach oben gehen. Die Stellung der Einstellstücke 86) wird durch den Hebel (5) verriegelt, der vom Nocken (49) ge- steuert wird. Der Nocken (41) steuert über den Zwischenhebel (36) die Klap- pe (35) mit den darauf befindlichen 5 dreiarmigen Hebeln (5), die den Einstellstücken (6) gegenüberliegen. An den rechten Armen der Hebel (5) sind Rollen (3) angebracht, die in die Gabeln (1) eingreife. Die Gabeln sind auf den Kontaktleisten (45) und (46) befestigt. Die Einstellstücke (6) haben 2 Nasen. Je nach der Stellung des Einstellstückes stößt der untere bzw. obere Hebelarm der Hebel (5) an die untere bzw. obere Nase. Nachdem die Einstellstücke (6) ihre Stellung entsprechend der Bewegung der Abfühlhebel (9) eingenommen haben, schwenkt die Achse (4) mit den Hebeln (5) nach Links. Jeder Hebel (5) dreht sich, wenn er auf die obere oder unter Nase des Ein- stelltückes stößt, auf der Achse (4) und Schiebt mit der Rolle (3) die Gabel (1) mit der Leiste nach oben oder unten. Wenn in einem Arbeitszyklus einem Abfühlhebel (9) ein Loch auf dem streifen gegenüberseht, wird die dazugehörige Leiste nach oben geführt, wenn sie sich im vorangegangenen Zyklus unten befand. Haben die Leisten die Stellung eingenommen, die durch die Abfühlhebel (9) bestimmt wird, so werden die letzteren durch den Hebel (42) in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht. der Schlüssellochstreifen wird durch die Streifentransport- trommel (33), die auf der Welle (31) sitzt, um einen Schritt vor- wärts transportiert. Die Klappe (35) mit den dreiarmigen He- beln (5) nimmt danach seine Ausgangsstellung ein. Der Hebel (50), der vom Nocken (49) gesteuert wird, entriegelt die Ein- stellstücke (6). Die Einstellstücke, die sich in der oberen Stel- lung befand, werden durch den Nocken (44) und die Klappe (43) in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht. Im folgenden Arbeitszyklus wiederholt sich die oben beschriebene Arbeits- weise der Bauteile. 6.5. Sperrung der Tastenhebel und Anhalten des Transmitters mit Dekombinator bei Ende des Schlüssellochstreifens (Abb. 33) Bei Ende des Schlüssellochstreifens muß es unmöglich sein, Zeichen mit der Hand einzutasten bzw. die Arbeit des Trans- mitters mit Dekombinator fortzusetzen. Diese Forderung wird in folgender Weise Rechnung getragen: Zu Beginn des Zyklus ermöglicht der Hebel (3), der vom Nok- ken (20) gesteuert wird, den Abfühlhebeln (2) sich unter Span- nung der Feder (1) zum Abtasten der Kombinationen in den Schlüssellochstreifen zu heben. Sind in dem Schlüsselloch- streifen Löcher der Schlüsselkombinationen vorhanden, so heben sich die Abfühlhebel soweit nach oben, wie es der Hebel (3) gestattet. Bei der Aufwärtsbewegung heben die Abfühl- hebel (2) den linken Arm des Hebels (39) an. Der rechte Hebel- arm senkt sich und verhindert die Bewegung der Schiene (28) nach rechts. In dem Augenblick, wo die Abfühlhebel (2) ihre obere Stellung erreicht haben, wird die Schiene (28) vom He- bel (24) der durch den Nocken (34) gesteuert wird, freigegeben. Die freigegebene Schiene (28) kann sich nach rechts bewegen und legt sich mit ihrem Ansatz vor das rechte Ende des Hebels (39), nachdem sie ihn an den Anschlag (27) gedrückt hat. Am Ende des Arbeitszyklus bringt der Nocken (34) mit Hilfe des Hebels (24) die Schiene (28) in ihre Ausgangsstellung zu- rück. Der linke Arm des Hebels (39) legt sich auf die Nase der Abfühlhebel (2). Liegt den Stiften der Abfühlhebel (2) ein Stück Schlüsselloch- streifen ohne Löcher gegenüber, so heben sich die Abfühl- hebel nur so weit, bis sie den Streifen berühren. Der rechte Arm des Hebels (39) wird zwar etwas gesenkt, stört aber die Bewegung der Schiene (28) nicht. Die Schiene (28) schiebt sich nach rechts und klinkt mit Hebel (31) den Hebel (32) aus. Der rechte Arm des Hebels (32) senkt sich unter der Spannung der Feder (33) und verschiebt die Stange (30), die über Bau- teile, die sich in der Tastatur befinden, die Tastenhebel sperrt und den Transmitter mit Dekombinator anhält. Um einen neuen Schlüssellochstreifen einlegen zu können, muß der Be- triebsartenumschalter aufKgestellt werden. Dabei werden durch den Nocken (11) und die Hebel (10) und (2), Abb. 32, der Hebel (22), Abb. 33, in Hochstellung gebracht, der rechte Arm des Hebels (32) angehoben und in den Hebel (31) eingeklinkt. Durch die Stange (30) wird jetzt die Sperre der Tastenhebel und des Transmitters mit Dekombinator auf- gehoben. 6.6. Verhinderung der Überschlüsselung nur mit einer Kombina- tion des Schlüssellochstreifens bei Störung des normalen Strei- fentransportes (Abb. 33) Nach Abtasten der Kombinationen durch die Abfühlhebel (2) wird der Schlüssellochstreifen um einen Schritt transportiert. Vor dem Streifentransport geht die Rolle des Hebels (38) auf den kleineren Radius des Nockens (16) über. Das Gummi- Kissen (17), das auf dem Hebel (10) angebracht ist, drückt den Streifen unter der Spannung der Feder (40) an die Rolle (18). Der Hebel (35) drückt bei der Bewegung seiner Rolle auf den maximalen Radius des Nockens (21) den Hebel (11) nach unten. Der Hebel (11) wird durch den Sperrhebel (14) blockiert. Der Hebel (0), der durch den Finger (12) des Hebels (11) bewegt wird, legt sich mit seinem unteren vertikalen Arm gegen den Hebel (3), der die Bewegung der Abfühlhebel ermöglicht. Beim Transport des Streifens bewegt sich gleichzeitig das Gummikissen (17) von rechts nach links, wobei der Finger (15) den Sperrhebel (14) entfernt. Der Hebel (11) mit dem Finger (12) geht am Ende des Zyklus, wenn die Rolle des Hebels (35) auf den kleinen Radius des Nockens (21) übergeht, wieder in die Ausgangsstellung zurück. Der untere vertikale Arm des Hebels (9) verschiebt sich nach rechts, ohne die Bewegung des Hebels (3) im folgenden Zyklus zu behindern. Hat der Hebel (11) seine obere Stellung erreicht, senkt der Nocken (16) und der Hebel (38) das Gummikissen (17). Es nimmt, nachdem es sich entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht hat, wieder seine Ausgangsstellung ein. Wenn sich der Streifen während der Umdrehung der Streifentransporttrommel (6) aus irgendwelchen Gründen nicht vorwärtsbewegt, bleiben die Hebel (11) und (9) durch den Hebel (14) gesperrt. Im folgenden Arbeitszyklus läßt der untere vertikale Hebelarm (9) den He- bel (3) nicht nach oben gehen. Alle Abfühlhebel (2) bleiben in der unteren Stellung. Dadurch werden die Tastenhebel ge- sperrt und der Transmitter mit Dekombinator angehalten. Steht der Betriebsartenumschalter aufKoderD, arbeitet die geschilderte Einrichtung nicht, da die Hebel (10) und (14) durch die Nocken (4) und (7) außer Betrieb gesetzt werden. 6.7. Verhinderung von Fehlern des Nachrichtensachbearbeiters beim Benutzen des Schlüssellochstreifens Die Systeme, die Fehler des Nachrichtensachbearbeiters beim Benutzen des Schlüssellochstreifens vorbeugen, sind unter dem Sammelbegriff Kontroll- und Sicherungsvorrichtung (KSV) zusammengefaßt. DieKSVverhindern: a) Arbeit mit Klartext bei eingelegtem Schlüssellochstreifen b) doppelte (teilweise oder ganz) Benutzung eines Schlüs- sellochstreifens beim Chiffrieren c) Chiffrieren mit einem Schlüssellochstreifen, der zum De- chiffrieren bestimmt ist. 6.7.1.KSV, die die Möglichkeit der Arbeit am Schlüsselgerät mit Klartext bei eingelegtem Schlüssellochstreifen verhindern (Abb. 34) Wenn der Betriebsartenumschalter aufKsteht, befindet sich der rechte Arm des Hebels (35) auf dem großen Radius des Nocken (33) und das Ansatzstück (30) liegt mit einem kleinen Spielraum unter dem Einschnitt des rechten Armes des Hebels (2). Der Knopf (21), der am linken Hebelarm (2) drehbar gela- gert ist, tritt bei geöffnetem Deckel des Chiffrators in der Streifenführung hervor. Wird in die Streifenführung des Chiffrators der Schlüsselloch- streifen eingelegt und der Deckel geschlossen, so senkt sich der Knopf (21) unter dem Druck des Deckels und des Streifens. Der linke Arm des Hebels (2) wird nach unten gedrückt. Mit diesem geht sein rechter Arm nach unten. Dieser drückt auf das Ansatzstück (30). Dieses drückt auf den Finger (25) und schiebt das Gleitstück (26) nach unten. Der unter dem Gleitstück (26) angebrachte Bolzen (27) schwenkt die in der Tastatur befindlichen Hebel (28) und (29) mit der Achse (62) Abb. 2 und rastet mit dem Hebel (52) den Hebel (39) aus dem Hebel (47) aus. Dadurch wird verhindert, daß die Hauptwelle des Schlüsselgerätes anläuft. Beim Einstellen des Betriebsartenumschalters aufDoderCliegt der Hebel (35) Abb. 34 auf dem kleinen Radius des Nockens (33) und schiebt mit der Nase des Ansatzstückes (30) den Knopf (219 unter den Chiffratordeckel. 6.7.2.KSV, die doppeltes Benutzen eines Schlüssellochstreifens ausschalten (Abb. 34) Wird der Betriebsartenumschalter aufDgestellt, so verän- dern die Bauteile der KSV ihre Stellung nicht, ausgenommen sind die Abfühlhebel (4) und (8), die sich heben und sich dem Streifen, der in dem Chiffrator eingelegt ist, nähern, ihn jedoch nicht und berühren und seine Vorwärtsbewegung beim Dechiffrie- ren nicht behindern. Wird der Betriebsartenumschalter aufCgestellt, so fällt der Hebel (3) mit seiner Nase in die Vertiefung des Nockens (20) ein, und die Abfühlhebel (4) und (8) heben sich unter der Spannung der Feder (6). Der Abfühlhebel (4) hebt sich höher als der Abfühlhebel (8), da im Schlüssellochstreifen dem Ab- fühlstift des Abfühlhebels (4) gegenüber ein Loch sein muß, durch das der Abfühlstift hindurchgeht. Der Abfühlhebel (8) kommt nur bis an die Oberfläche des Schlüssellochstreifens heran. Dabei liegen die Aussparungen in den Abfühlhebeln (4) und (8) auf gleicher Höhe mit den Zähnen der Schiene (11). Beim weiteren Drehen der Nockenwelle (15), die mit dem Be- triebsartenumschalter verbunden ist, fällt der Bolzen (13) vom Hebel (14) in die Vertiefung der Kurvenscheibe (12) ein. Der Hebel (14) schwenkt unter der Spannung der Feder (10) im Uhrzeigersinn. Dabei gehen die Zähne der Schiene (11) durch die Aussparung in den Abfühlhebeln (4) und (8). Mit der Schiene (11) verschiebt sich durch den Nocken (12) auch das Auflagestück (9), das mit seiner Nase unter die Nase des Stanzstempels (5) kommt. beim Weiterdrehen der Nocken- welle (15) hebt der Nocken (17) den Hebel (18) an und stanzt durch das Ansatzstück mit Stanzstempel (5) ein Loch in den Schlüssellochstreifen. Die Nocken (16) und (20) aber, bringen die Abfühlhebel (4) und (8) und den Stanzstempel (5) in ihre untere Stellung, die den Streifenvorschub in der Streifenfüh- rung ermöglicht. Der rechte Hebelarm (14) schwenkt beim Ein- fallen des Bolzen (13) in die Vertiefung der Kurven (12) den Hebel (23) nach links. Das Gleitstück (26) und die Stange (27) bewegen sich nach oben. Die Hebel (28) und (29) und die mit ihnen verbundenen Bau- teile, die sich in der Tastatur befinden, gewährleisten das nor- male Anlaufen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes Bei der doppelten Benutzung eines Schlüssellochstreifens er- schienen beim Umschalten vonDaufCüber beiden Ab- fühlstiften der Abfühlhebel (4) und (8) im Schlüssellochstrei- fen Löcher, und beide Abfühlhebel heben sich auf gleiche Höhe. Die Aussparung des Abfühlhebels (4) steht dem Zahn der Schiene (11) gegenüber. Die Aussparung des Abfühlhebels (8) steht höher, wobei sie verhindert, daß sich die Schiene (11) in Richtung des Nockens (12) bewegt. Der Hebel (14) bleibt in Ausgangsstellung, und sein rechter Arm stößt nicht an den Arm des Hebels (23). Der rechte Arm des Hebels (23) drückt auf das Gleitstück (26) und den Bolzen (27). Die Hebel (28), (29) und die mit diesen verbundenen Bauteile, die sich in der Tastatur befinden, wer- den so eingestellt, daß ein Anlaufen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes unmöglich ist. 6.7.3.KSV, die die Möglichkeit des Chiffrierens mit einem Schlüs- sellochstreifens, der für die Dechiffrierung bestimmt ist, aus- schließt (Abb. 34) Wenn beim Chiffrieren in den Chiffrator ein Schlüsselloch- streifen eingelegt wurde, der für die Dechiffrierung bestimmt ist, (er hat ein Kontrolloch), so haben die Abfühlhebel (4) und (8) beim Drehen der Nockenwelle (15) nur die Möglichkeit, sich beis zum Anstoßen an den Streifen zu heben. Dabei befindet sich die Aussparung des Abfühlhebels (4) weiter unten als die des Abfühlhebels (8). In dieser Stellung der Abfühlhebel wir eine Bewegung der Schiene (11) und die Drehung des Hebels (14) durch den Abfühlhebel (4) verhindert. Das Gleitstück (26) mit dem Bolzen (27) und die Hebel (28) und (29) werden in eine solche Lage gebracht, die ein Anlaufen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes verhindert. 6.8. Auslösen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes beim Umschal- ten des Betriebsartenumschalters vonKaufDBeim Chiffrieren oder Dechiffrieren ist es notwendig, daß die erste Kombination des Schlüssellochstreifens mit dem ersten Klartextzeichen überlagert wird. Da im Lauf des Arbeitszy- klus das Druckwerk eher in Tätigkeit tritt als die Einstellung der Kontaktleisten erfolgt, ist es notwendig, zu Beginn des Chiffrierens oder Dechiffrierens die Kontaktleisten in die Stel- lung zu bringen, die der ersten Kombination im Schlüsselloch- streifen entspricht. Zur Erfüllung dieser Forderung wird die Hauptwelle des Schlüsselgerätes für einen Arbeitszyklus beim Umschalten des Betriebsartenumschalters vonKaufDausgelöst, nachdem der Schlüssellochstreifen in den Chiffrator eingelegt wurde. Dabei wird die Wagenfortschaltung und das Ansprechen des Gruppenzählers unterbunden. Während dieses Arbeitsganges fühlen die Abfühlhebel des Chiffrators die Schlüsselkombi- nation ab, und die Kontaktleisten nehmen eine Stellung ent- sprechend dieser Kombination ein. Danach kann mit dem Chiff- rieren oder Dechiffrieren bei der entsprechenden Stellung des Betriebsartenumschalters begonnen werden. 6.9. Verhinderung der Wagenfortschaltung beim Umschalten vonKaufDBeim Umschalten des Betriebsartenumschalters vonKaufDgeschieht folgendes: a) Der Nocken (46) rastet durch den Hebel (45), Abb. 25, das Zahnrad des Chiffratorantriebes ein. b) Der Nocken (1), Abb. 2, der Welle, die durch das Zahn- rad (67) mit der Welle des Betriebsartenumschalters ver- bunden ist, verschiebt die Schiene (27) nach links. Die mit der Schiene (27) zusammenwirkenden Hebel (34), (46) und (47) geben die Hebel (45) und (43) frei, und die Hauptwelle des Schlüsselgerätes wir für einen Arbeitszyklus aus- gelöst. c) Der Hebel (39), Abb. 25, klinkt während seines Laufes auf dem Nocken die Zugstange (36) aus dem Hebel (22) aus. Während sich die Zugstange (36) nach oben bewegt, drückt sie mit ihrer rechten abgeschrägten Kante den He- bel (20) nach rechts und legt sich mit ihrer unteren Kante auf den oberen Lappen des Hebels (20). Wenn der Nocken für die Weiterschaltung des Wagens nach Auslösen der Hauptwelle anläuft und der mit ihm gekoppelte Hebel (16) die Hebel (22) und (20) nach rechts dreht, so wird der Wagen nicht fortbewegt, da die Zugstange (36) nicht mehr in den Hebel (22) eingreift. Bei seiner Bewegung drückt der Hebel (22) mit seinem eingenieteten Bolzen den Hebel (20) zu- rück und bringt ihn mit der Stange (36) außer Eingriff. Bei der Rückwärtsbewegung des Hebels (22) fällt er in die Aussparung der Zugstange (36) ein und gewährleistet im weiteren eine schrittweise Fortschaltung des Wagens während eines jeden Arbeitszyklus. 6.10. Sperrung des Gruppenzählers beim Umschalten des Betriebs- artenumschalters vonKaufD(Abb. 32) Der Finger (19) des Zahnrades (21), das sich bei Betätigung des Betriebsartenumschalters dreht, rastet den rechten Arm des Hebels (24) aus der Nase des Hebels (18) aus. Dabei wird der Hebel (29), der die Drehung der Achse des Zählers bewirkt, durch die Nase des oberen Teiles des Hebels (24) gesperrt. Beim Umschalten des Betriebsartenumschalters vonKaufDlaufen die Hauptwelle und der Chiffrator für einen Ar- beitszyklus an. Während der Umdrehung der Welle (26) rastet der Nocken, der auf ihrem linken Ende befestigt ist, den Hebel (29) aus der oberen Nase des Hebels (24) aus, indem er den rechten Arm in den Hebel (18) einrastet. In den folgenden Ar- beitszyklen beim Chiffrieren oder Dechiffrieren ist der Hebel (29) für die Arbeit frei. 6.11. Betriebsartenumschalter (Abb. 37) Der Betriebsartenumschalter dient zur Umschaltung der Stromkreise des Schlüsselgerätes auf die 3 bekannten Betriebs- artenK,DundC. Die Teile des Umschalters sind auf einer Grundplatte (1) angebracht, die auf der unteren Seite der Grundplatte des Chiffrators montiert ist. Mit der Grundplatte (1) sind die 2 Leisten (4), die aus Kunststoff mit eingepreßten Kontakten hergestellt sind, starr verbunden. Auf der Platte (6), die sich in Führungsschienen bewegt, sind zwei leisten mit gefederten Kontakten befestigt und ein Metallständer (2) mit einer Achse, durch den die Platte (6) in einer der drei festen Stellungen verharrt. Die Teile des Umschalters werden durch die Verkleidung (3) abgedeckt. Die Einstellung des Betriebsartenumschalters auf die ge- wünschte Stellung geschieht mit dem Drehknopf, der an der rechten Seite der Grundplatte herausgeführt ist und auf dem die BezeichnungK,DundCeingraviert sind. Bei Drehung des Knopfes bewegt sich die Zahnstange (2), Abb. 32, deren Bewegung sich über die Zahnräder (21) und (22) auf die Welle (12) überträgt und von dort aus durch den Exzenter (16) über den Hebel (13) auf die Platte des Umschalters mit den Leisten (15). 6.12. Gruppenzähler (Abb. 35) Der Zähler, der sich am Chiffrator befindet, dient zum Zählen der Anzahl der Gruppen des Geheimtextes. Das Ablesen der Zähleranzeige erfolgt von den vier Zifferntrommeln. Die letzte rechte Zifferntrommel zeigt die Zahl der Arbeitszyklen von 0-4 an und die drei anderen mit den Ziffern von 0-9 zeigen die Anzahl der Fünfergruppen an. Der Zähler hat Klinkenantrieb. Die Drehung der treibenden Achse des Zählers erfolgt durch den Hebel (5) und den Exzenter, der auf der Antriebswelle (6) am Chiffrator sitzt. Während einer Umdrehung der Antriebs- welle wird das Antriebsrad (2) des Zählers durch den Hebel (5) über das Zahnrad (3) um eine zehntel Umdrehung weiter- bewegt. Durch Drücken des Hebels (1) erfolgt die Rückstellung des Zäh- lers, das heißt, alle Zifferntrommeln gehen in die Nullstellung zurück. 7. G e h ä u s e m i t K o n z e p t h a l t e r Das Gehäuse (2), Abb. 1, deckt die Baugruppe, die auf der Grundplatte befestigt sind, ab. Über dem Chiffrator (24) ist im Gehäuse ein Ausschnitt, damit der Schlüssellochstreifen be- quem eingelegt werden kann. In der Vorderfront ist ein Aus- schnitt für die Stromversorgung. Die Farbbandspulen des Druckwerkes befinden sich unter einem Deckel (35), der ge- öffnet werden kann. So kann ein Auswechseln des Farbbandes ohne Abnehmen des Gehäusedeckels erfolgen. Im hinteren Teil des Gehäuses sind die Deckel (12) und (16), die das Abnehmen des Gehäuse bei aufgesetztem Wagen erleichtern. Der Deckel (16) gibt auch die Möglichkeit, die Umschaltung des Elektromotors für die Arbeit mit Gleich- oder Wechselstrom vorzunehmen. Links oben auf dem Gehäuse sitzt der Konzepthalter. Das Gehäuse wird auf der Grundplatte durch zwei unverlierbare Schrauben befestigt. 8. A n t r i e b Er enthält: a) den Elektromotor SL-369 uA 1 mit Fliehkraftregler b) die Hauptwelle des Schlüsselgerätes c) die Welle für den Wagenrücklauf d) die Steuerung für die Kupplung der Welle für Wagen- rücklauf e) den Zähler für den Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes f) den ImpulskontaktIK8.1. Der Elektromotor SL-369 uA 1 Der Elektromotor SL-369 uA 1 wird vom Gleichstromnetz mit einer Spannung von 110 Volt oder vom Wechselstromnetz mit einer Spannung von 127 Volt über einen Trafo, der im Stromversorgungsteil eingebaut ist, gespeist. Die elektrische Verbindung der Wicklung des Elektromotors mit den Bau- elementen, die sich in der Grundplatte des Schlüsselgerätes befinden, erfolgt durch einen Stecker. An einem Ende der Welle des Elektromotors ist eine Klauenkupplung, am anderen Ende der Fliehkraftregler (Abb. 86), angebracht. Um die Welle des Elektromotors bequem mit der Hand drehen zu können, was beim Einstellen des Schlüsselgerätes erforder- lich ist, besitzt der Regler eine Kappe mit gerändelter Ober- fläche. Unter der Kappe befindet sich auf Achsen zwei Winkel (2) und (5), die frei drehbar sind. In dem Winkel (2) ist eine Schraube (3) zum Spannen der Feder (4) eingeschraubt, die zwischen den Winkeln (2) und (5) be- festigt ist. Die Konsole (11) ist an der Lagerschale des Elektro- motors befestigt. Die Kontaktfedern (6) und (7) sind am Win- kel (8) befestigt. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Welle des Elektromotors verändert sich je nach dem Abstand der Kontaktfedern vom Winkel (5). Der Abstand wird von Hand aus durch die Rändelmutter (9) eingestellt. Diese ist auf das Gewinde der Stange (10) aufgeschraubt. Alle Teile des Motors sind im Gußgehäuse untergebracht. 8.2. Hauptwelle des Schlüsselgerätes (Abb. 13) Auf der Hauptwelle des Schlüsselgerätes befindet sich: a) eine Start-Stopp-Kupplung, die aus einem getriebenen Teil (69) und einem treibenden teil, der mit dem Schnek- kenrad (70) fest verbunden ist, besteht, b) einen Nocken (61), der die Arbeit des Impulskontaktes (62) steuert, c) eine Nocken (60), der die Stopp-Stellung der Hauptwelle durch den Hebel (59) mit der Feder (58) fixiert, d) ein Zahnrad (64), das die Bewegung über das Zahnrad (65) auf die Antriebswelle des Chiffrators überträgt, e) ein Nocken (66), der die Stopp-Stellung der Auslöservor- richtung der Tastatur wiederherstellt, f) ein Nocken (17), der den wagen in jedem Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes schrittweise weiterschaltet, g) eine Schnecke (18), für die mechanische Übertragung zum Zähler (13), h) ein Nocken (20), der den Antrieb des Druckwerkes steuert, i) ein Nocken (19), der die Start-Stopp-Kupplung des Lochers einschaltet Vom treibenden Teil der Hauptwelle des Schlüsselgerätes wird die Bewegung über das Zahnrad (52) und die Welle mit der Kardangabel des Kreuzgelenkes (24) auf den Automatikantrieb übertragen und über die Zwischenwelle (41) mit den Kegel- rädern (42) und dem Zahnrad (40) auf die Wagenrücklaufwelle. 8.3. Start-Stopp-Kupplung (Abb. 14) Aufbau der Start- Stopp-Kupplung: In der Hauptwelle des Schlüsselgerätes wird eine Start-Stopp- Kupplung mit Stirneingriff verwendet. Die Kupplung besteht aus 2 Teilen - dem Treibenden und dem Getrieben. Bei ein- geschaltetem Schlüsselgerät wird der treibende Teil der Kupp- lung ständig durch den Elektromotor angetrieben. Wenn eine Taste gedrückt wird, greift der getriebene Teil der Kupplung in den treibenden Teil ein und vollführt eine Um- drehung. Eine Umdrehung der Hauptwelle entspricht einem Arbeitszyklus. Nach jeder Umdrehung wird der getriebene Teil vom treiben- den Teil gelöst und in der Stoppstellung festgehalten. Die Scheibe (7) mit den Stirnzählern auf der rechten Seit ist der treibende Teil der Kupplung und mechanisch fest mit dem Schneckenrad (18), der Buchse (19) und dem Zahnrad (20) ver- bunden. Die angeführten Elemente sind auf Kugellagern gelagert und können sich auf der Welle (1) drehen. Die beiden Schreiben (8) und (9), die mit den Schrauben (22) verschraubt sind, bilden den getriebene Teil der Kupplung. Auf der linken Seite der Oberfläche der Scheibe (8) sind Stirnzähne eingeschnitten. Die Scheiben (8) und (9) sind auf der Buchse des Hebels (16) angebracht. Sie können sich in bestimmten Grenzen axial dar- auf verschieben. Die Welle (1) bewegt sich frei in der Buchse des Hebels (16). Der Nocken (11), der durch einen Stift fest mit der Welle (1) verbunden ist, hat im linken Stirnteil Klauen, die in die Nuten der Scheibe (9) eingreifen. Durch diese Stirnkupplung wird eine feste mechanische Verbindung des getrieben Teils der Kupplung mit der Welle (1) und den auf ihnen angebrachten Bauteilen erreicht. Der dreiarmige Hebel (16) und die Scheibe (9) besitzen je 3 konische Lagerpfannen, die im Hebel (16) von 120° zueinander stehen. Die Lagerpfannen im Hebel (16) liegen den Lagerpfannen in der Scheibe (9) gegenüber. In jedem sich gegenüberliegenden Pfannenpaar befindet sich eine Stahl- kugel (10). Der Eingriff des getriebenen Teils der Kupplung in den Trei- benden Teil wird durch die 4 Federn (12) gewährleistet, die den getriebenen Kupplungsteil bis zum Eingriff der Klauen ineinander nach links verschieben. Der linke Teil der Lager- buchse des Hebels (16) legt sich dabei auf das Lager (17). Das Lager kann sich nicht nach links verschieben, da der Hebel (5) starr mit der Welle (1) verbunden ist. Auf der Abb. 14 ist die Hauptwelle mit der geschlossenen Start- Stopp-Kupplung dargestellt. In diesem Falle wird die Drehung des treibenden Teils der Kupplung über die in Eingriff befind- lichen Zähne auf den getrieben Teil übertragen und über den Nocken (11) auf die Welle (1) mit den darauf angebrachten Bauteilen. Bei der eingerasteten Start-Stopp-Kupplung wird der Hebel (16) durch die Feder (21) entgegen dem Uhrzeiger- sinn gedreht. Dabei zeigt der untere rechte Arm des Hebels (16) auf einer der Klauen (23) der Scheibe (9) und die konischen Lagerpfannen mit den Kugeln (10) im Hebel (16) und in der scheibe (9) liegt sich gegenüber. Um den getriebenen Kupp- lungsteil vom treibenden Teil zu lösen, ist es erforderlich, den Hebel (16) zu stoppen, indem über seinen oberen Arm der über den Umfang der Scheibe hinausragt, ein fester Anschlag ge- schoben wird. Nach dem Stoppen des Hebels (16) dreht sich der getriebene Kupplungsteil noch um einen bestimmten Winkel und rastet dann aus, da die Kugeln (10), indem sie sich an den schrägen Oberflächen der konischen Lagerpfanne abwälzen, den Spiel- raum zwischen Hebel (16) und der Scheibe (9) vergrößern. Bei der Vergrößerung dieses Spielraumes kann sich der Hebel (16) nicht nach links verschieben, da seine Lagerbuchse auf das Lager (17) drückt. Die Kugeln (10) drücken die Scheibe (9) und die fest mit ihr verbundene Scheibe (8) nach rechts bis der getriebene Kupplungsteil aus der Zahnkupplung des treiben- den Teils ausrastet. Der ausgerastete getriebene Kupplungsteil und die Welle (1) mit den darauf befindlichen Bauteilen wird nach dem Stopp durch den Nocken (13) und einen Hebel mit der Rolle und Feder in die Stoppstellung fixiert. Das Ein- und Ausrasten der Start-Stopp-Kupplung der Haupt- welle erfolgt durch einen Hebel, der auf dem Getriebeblock an- gebracht und mit dem Auslösebügel der Tastatur mechanisch verbunden ist. In der Start-Stopp-Kupplung befindet sich eine Vorrichtung (6), die eine Erhöhung der Umdrehungsgeschwindigkeit des ge- triebenen Teiles der Kupplung im Vergleich zum treibenden Teil verhindert. Das ist praktisch möglich, wenn über Zwi- schenelemente Federkräfte, die durch die starken Federn der mechanischen Baugruppen entstehen, auf den getriebenen Kupplungsteil einwirken. Diese Vorrichtung besteht aus dem Nocken (5), der auf der Welle (1) verstiftet ist, der Rolle (27), der Zarge (26) und der Feder (25). Bei Erhöhung der Umdrehungsgeschwindigkeit des getriebenen Kupplungsteiles im Vergleich zum treibenden Teil keilt sich die Rolle (27) zwischen die schrägen Oberflächen der Scheibe (7) und des Nockens (5). Dadurch ist ausgeschlossen, daß die beiden Kupplungsteile sich mit verschiedener Ge- schwindigkeit drehen. In Abb. 14 ist dargestellt, wie die Nocken auf der Hauptwelle des Schlüsselgerätes bei Stoppstellung der Start-Stopp-Kupp- lung stehen 8.4. Wagenrücklaufwelle Die Wagenrücklaufwelle dient dazu, den Wagen aus einer be- liebigen Stellung in die StellungZeilenanfangzurückzufüh- ren. Die Wagenrücklaufwelle wird von dem sich ständig dre- henden Teil der Hauptwelle des Schlüsselgerätes über die Zahn- räder (52), (42), (40) und (27), Abb. 13, in Umdrehung versetzt. Beim Schließen der Kupplung (34) wird die Bewegung über das Schraubenrad (33) auf das Rad (32) übertragen. Dieses befindet sich am Druckwerk und ist mit der Wagenaufzugsfeder im Unterbau des Wagens mechanisch verbunden. 8.4.1. Aufbau der WR-Welle (Abb. 15) Auf der Welle (1) befindet sich ein Zahnrad (2), das vom Ge- triebe des Schlüsselgerätes angetrieben wird, eine Rutschkupp- lung (11) und eine Zahnkupplung (9). Die Rutschkupplung dient zur Abschwächung des Stoßes auf die Wagenteile, der in dem Augenblick auftritt, wenn die Kupplungsteile (9) und (10) ineinander eingreifen. Die Zahnkupplung besteht aus dem treibenden Teil (9) und dem getriebenen Teil (10). Die Rutschkupplung besitzt 3 Stahlscheiben (6), (7) und (12). Die Scheibe (12) ist mit der Welle durch den Keil (8) vebun- den und trägt die Scheiben (6) und (7). Die Scheiben (6) und (12) sind miteinander gekuppelt. Zwischen den Scheiben (6), (7) und (12) befinden sich Filzscheiben (13). Die Reibkraft zwischen den Scheiben (6), (7) und (12) und den Filzscheiben (13) wird durch die Federn (14) verstärkt, deren Spannung von der Mutter (4) eingestellt wird. Diese Einstel- lung wird von der Kontermutter (3) fixiert. Die Scheibe (7) hat zwei Nasen, die in die Aussparung der getriebenen Buchse (11) eingreifen. Die letztere ist mit dem treibenden Teil (9) der Kupplung, deren Stellung auf der Welle (1) durch den Wagen- steuerungshebel verändert wird, durch Klauen verbunden. Nach Schreiben des 59. Zeichens auf einer Zeile rastet der Wa- gen, indem er an der Zeile entlang gleitet, über ein Hebel- und Stangensystem den treibenden Teil (9) der Kupplung mit den getriebenen Teil (10) ein. Dabei wird die Umdrehung des Zahnrades (2) über den Keil (8), die Scheiben(6), (12) und die Zwischenbeläge (13) auf die Scheibe (7), die Buchse (11) und die im Eingriff befindliche Kupplung (9) und (10) übertragen. Diese Stellung nehmen die Bauteile der Welle bis Zeilenvor- schub und Wagenrücklauf beendet ist, ein. Danach wird der treibende Teil (9) der Kupplung selbständig außer Eingriff mit dem getriebenen Teil (10) gebracht. 8.4.2. Steuerung der Kupplung der Wagenrücklaufwelle (Abb. 13) Auf der Achse (53), die sich in Gleitlagern auf dem Getriebe- block des Schlüsselgerätes dreht, sind die Hebel (47), (51) und (54) angebracht. Der Hebel (47) ist an der Achse (53) befestigt und wird über die Stange (43) durch den Wagen gesteuert, wenn dieser die Zeile entlanggleitet. Der Hebel (51) mit der Zugstange (45) ist mit dem Hebel (37) verbunden, der den treibenden Teil (34) der Zahnkupplung der Wagenrücklaufwelle steuert. In ausgerasteter Stellung des treibenden teils (34) der Kupp- lung verbleibt letzteres in dieser Stellung durch die Hebel (50) und (51), die mit den Sperrnasen einrasten. Beim Schreiben des Textes auf das Blatt verändert sich bis zum 57. Zeichen der Zeile die Stellung der Bauteile der Steuerung nicht. Nach dem Schreiben des 58. Zeichens verschiebt der Wa- gen den Hebel (47) über die Zugstange (43) in die mittlere Stellung, die durch den Hebel (55) und Feder (56) fixiert wird. Dabei drückt die untere Schraube am Hebel (47) auf den linken Arm des Hebels (50) und dreht ihn teilweise vom Hebel (51) weg. Es handelt sich hierbei um eine vorbereitende Stellung der Bauteile. Nach dem Schreiben des 59. Zeichens in der Zeile ver- schiebt der Wagen bei seiner Bewegung den Hebel (47) weiter nach links. Die untere Schraube am Hebel (47) rastet den He- bel (50) aus dem Hebel (51) aus. Durch die Feder (44) schließt der Hebel (37) über die Zugstange (45) die Kupplung (34). Die Schreibwalze springt auf eine neue Zeile über. Danach beginnt der Wagenrücklauf. Nach dem Rücklauf schlägt der Wagen mit der rechten Seite auf den Anschlag (46) und bringt den Hebel (47) über die Schraube (48) in die Ausgangsstellung zurück. Durch die Schraube (57) wir der Hebel (51) in Hebel (50) wieder einge- rastet und der treibende Teil der Kupplung (34) aus dem ge- treibenen Teil der Kupplung (33) ausgerastet. 8.5. Zähler für die Arbeitszyklen der Schlüsselgeräts (Abb. 13) Für jeden Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes wir die Drehung des Start-Stopp-Teils der Hauptwelle auf den Zähler (13) über das Schneckenradpaar (18) und (23), die Welle (15) und die Schnecke (14) übertragen. Der Zähler besitzt 4 Ziffernschreiben. Jede Zähleinheit einer Scheibe des Zählers entspricht 5000 Arbeitszyklen des Schlüsselgerätes. Die Periode des Zählers entspricht 50 Millionen Arbeitszyklen des Schlüsselgerätes. 8.6. ImpulskontaktIK(Abb. 13) Der Impulskontakt (62) wird durch den Nocken (61) gesteuert und von ihm für einen bestimmten Teil des Arbeitszyklus des Schlüsselgerätes geschlossen. Nach Drücken einer Taste und Auslösen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes schließt der Impulskontakt den Stromkreis für eine der Spulen der Elektromagneten im Druckwerk. Ent- sprechend der gedrückten Taste wird gewährleistet, daß ein Stromimpuls durch die Wicklung eines der Elektromagneten läuft und dieser anzieht. 9. W a g e n Funktionen des Wagens: a) Halten des Blattes beim Schreiben des Textes b) Horizontales Verschieben des Blattes um 2,8 mm nach Schreiben eines jeden Zeichens c) Vorschub des Blattes auf eine neue Zeile. Der Wagen ist für Blätter vorn Format DIN A 4 berechnet. Auf jeder Zeile des Blattes finden 59 Zeichen Klartext oder 10 Fünfergruppen Geheimtext mit Zwischenräumen Platz. 9.1. Aufbau des Wagens (Abb. 16) Der Wagen besteht aus dem Unterbau (2) und dem beweglichen Teil (3). Im Unterbau des Wagens befinden sich zwei Führungsbolzen (8) und (24), die in die Führungsbuchsen im Druckwerk hinein- ragen. Der bewegliche Teil des Wagens kann sich längs des Unterbaus mit Hilfe eines Rollenkäfigs bewegen, der in Füh- rungsprismen liegt. In den Führungsprismen werden sie durch Zahnscheiben gehalten, indem diese in die Zahnstangen (14) eingreifen. Zum Verschieben des beweglichen Wagenteils dient die Spiral- feder (7), die in der Zahnradtrommel (6) liegt. Das eine Ende der Spiralfeder ist am Bolzen (8) befestigt, das andere Ende an der Trommelwand (6). An der unteren Seite der Trommel befinden sich zwei Zapfen (5), die in die Löcher des Zahnrades (4) eingreifen, das durch die Kupplung der Wagenrücklaufwelle bewegt wird. Nach dem Schreiben des 59. Zeichens einer Zeile bewirkt die Wagenrück- laufwelle einen Sprung der Walze (53) auf die nächste Zeile und den Rücklauf des beweglichen Wagenteils an den Anfang dieser Zeile. Gleichzeitig wird die Spiralfeder aufgezogen. Die Kraft der Spiralfeder überträgt sich über die Zahnräder (9), (10), (11) und die Zahnstange (29) auf den beweglichen Wagen- teil, dessen Bewegung durch die Rastklinken (39) und (40) ver- hindert wird. Die Nasen der Rastklinken greifen in die Zähne der Zahnstange (41) ein, die mit dem beweglichen Wagenteil fest verbunden ist. Die Schreibwalze besteht aus dem Holzzylinder (54) mit Gummiüberzug (53). An den Stirnflächen sind das Rastrad (55) und das Schaltrad (23) befestigt. Durch den Holzzylinder (54) geht eine Stahlachse (31) mit 2 Drehknöpfen (1) und (32), die zum Drehen der Schreibwalze von Hand aus dienen. Die Achse (31) dreht sich in Lagern auf den Ständern (33) und (60). 9.2. Papierführung Unter der Schreibwalze (53) befindet sich die Papierführung (51), die an den Bügeln (17) und (61) befestigt ist. Zwischen den Bügeln liegen auf 4 Spitzen (63) zwei Papierandruckwalzen (16). Die letzteren sind unter den Einschnitten in der Papier- führung (51) angebracht und ragen etwas über deren Oberfläche hinaus. Die Bügel (17) und (61) liegen auf den Zapfen (18) der beiden Hebel (19), die sich auf der Achse (44) drehen können. Die beiden Federn (42), deren Spannung über die Zahnkupplungen (15) und (43) eingestellt wird, drücken die Papierandruckwalzen (16) an die Schreibwalze (53). Zum Ein- spannen des Blattes in den Wagen wird die Papierführung durch Zurückdrücken des Hebels (57) nach unten geführt. Der untere Arm des Hebels (57) bewegt den Hebel (58), der mit der Achse (44) verbunden ist. Dadurch gehen die Hebel (20) und (19) mit der Papierführung (51) in die untere Stellung, wobei sich zwischen den Papierandruckwalzen (16) und der Schreib- walze (53) ein Zwischenraum bildet, der zum Einlegen des Blattes genügt. Bei Rückführung des Hebels (57) in die Ausgangsstellung wird das Blatt durch die Papierandruckwalzen der Führung (51) an die Schreibwalze (53) des Wagens gedrückt. Nach dem Schreiben des Zeichens wird der bewegliche Teil des Wagens mit dein Blatt einen Schritt weiterbewegt. 9.3. Wagenfortschaltung (Abb. 17) Die Zahnstange (7) ist mit dem beweglichen Wagenteil fest ver- bunden. In die Zähne der Stange (7) greifen die Nasen der Rastklinken (5) und (6) ein. Die Rastklinken besitzen Lang- löcher, durch die eine Achse (3) geht. Durch die Federn (4) werden die Klinken nach rechts gezogen. Ihre stabile Stellung in der horizontalen Ebene wird durch die entsprechenden Füh- rungen gewährleistet. Die Stange (7) mit dem beweglichen Wagenteil strebt durch die Kraft der sie bewegenden Spiralfeder danach, sich nach links zu verschieben. Das wird jedoch durch die Nase der Rastklinke (6) verhindert. Die rechte Kante des Langloches stößt auf die Achse (3), Abb. 17a. Nach Schreiben des Zeichens rastet der Vorschubhebel (2) die Rastklinke (6) aus der Stange (7), Abb. 17b, aus. Die Bewegung des beweglichen Wagenteils wird durch die Klinke (6), Abb. 17b, begrenzt. Bei der Arbeit mit Klar- text schiebt sich der bewegliche Wagenteil nach Schreiben eines jeden Zeichens schrittweise vorwärts. 9.3.1. Wagenfortschaltung bei der Einteilung in Fünfergruppen (Abb. 18) Bei dem Chiffrieren muß der Text in Fünfergruppen geteilt werden. Zwischen den Fünfergruppen muß ein Zwischenraum sein. Diese Forderung wird durch ein System erfüllt, das in Abb. 18 dargestellt ist. An dem beweglichen Wagenteil ist die Stange (9) befestigt. Auf der Stange läuft der Hebel (8), der auf dem Gleitstück (10) des unbeweglichen Wagenteils drehbar gelagert ist. Wird der Betriebsartenumschalter aufCgestellt, so schiebt der Hebel (11) das Gleitstück (10) mit dem Hebel (8) nach links. In Abb. 18a ist die Stellung der Bauteile vor dem Schreiben des 5. Zei- chens einer der Fünfergruppen dargestellt. Nachdem der Vorschubhebel (2) des Hebels (1) die Rastklinke (6) aus der Stange (7) ausgerastet hat, müßte die Bewegung des beweglichen Wagenteils durch die Klinke (5) und die Achse (3) begrenzt werden. Die Klinke (5) wird jedoch durch die Nase der Stange (9) und den Hebel (8) aus der Stange (7), Abb. 18b, ausgerastet. Dadurch bewegt sich der bewegliche Wagenteil zwei Schritte vorwärts und wird durch die Rastklinke (6) ge- stoppt, Abb. 18b. Die 4 nächsten Zeichen werden geschrieben, wenn sich der Hebel (8) in der Vertiefung der Stange (9) befindet, d. h. der Wa- gen bewegt sich immer um einen Schritt weiter. Nach Schrei- ben des 5. Zeichens schiebt sich der bewegliche Wagenteil um 2 Schritte vorwärts usw.. Wird der Betriebsartenumschalter aufKoderDgestellt, so wird das Gleitstück (10) mit dem Hebel (8) durch den Hebel (11) nach rechts verschoben, und die automatische Teilung des Textes in Fünfergruppen hört auf. Damit sich der bewegliche Wagenteil durch Neigen oder Stöße nicht nach rechts bewegt, besitzt er eine Zahnstange (45), Abb. 16, in die die Sperrklinke (50) einrastet. Zum Einstellen des beweglichen Wagenteils auf einen belie- bigen Punkt der Zeile, von Hand aus, ist es erforderlich, den Hebel des Wagenauslösebügels (48) nach vorn zu ziehen. Dabei werden die Rastklinken (39) und (40), die Sperrklinke (50) und der Hebel (47) durch den Wagenauslösebügel (48) aus den Zahnstangen ausgehoben und der bewegliche Wagenteil kann in die erforderliche Stellung gebracht werden. 9.4. Zeilenvorschub der Schreibwalze (Abb. 16) Nach Schreiben des 59. Zeichens wird die Schreibwalze mit dem Blatt automatisch auf die nächste Zeile gestellt. Der bewegliche Wagenteil wird an den Anfang der neuen Zeile gebracht. Dieses geschieht wie folgt: Nach Schreiben des 59. Zeichens einer Zeile wirkt der beweg- liche Wagenteil beim Verschieben auf das Steuerungssystem, das sich am Antrieb befindet, ein. Die Kupplung der Wagen- rücklaufwelle rastet dadurch ein. Der getriebene Kupplungsteil ist durch ein Schraubenrad mit dem Zahnrad (4), das frei drehbar in einer Buchse des Druckwerkes gelagert ist, ver- bunden. Die Zahnradtrommel (6) mit der Spiralfeder (7), die durch 2 Zapfen (5) mit dem Rad (4) verbunden ist, dreht sich im Uhrzeigersinn, wobei sie durch die Zahnräder (9), (10) und (11) die Zahnstange (29) nach rechts schiebt. Der mit der Stange verbundene Sektor (27) bringt mit dem Hebel (30) und dem Gleitstück (28) den Hebel (26) in die Stellung, in der die Schaltklinke (22) in Eingriff mit dem Schaltrad (23) kommt. Dieses ist mit der Walze (54) starr verbunden. Es bewegt sich bis zum Auftreffen der Schaltklinke auf den Anschlag (37). Dabei wird die Schreibwalze in die Stellung gebracht, die zum Schreiben der nächsten Zeile erforderlich ist. Die Nase des He- bels (25), der im Unterbau des beweglichen Wagenteils ange- bracht ist, hält den Sektor (27) in der von ihm eingenommenen Stellung fest. Gleichzeitig führt der Hebel (26) bei seiner Be- wegung den rechten Arm des Hebels (35) nach unten. Der Letztere dreht mit seinem 2. Arm den Wagenauslösebügel (48). Dadurch werden alle Hebel aus den Zahnstangen des Unter- baues ausgehoben, darunter auch der Hebel (50), der eine Längsbewegung des beweglichen Wagenteils nach rechts ver- hindert. Nachdem sich die Zahnstange (29) so weit nach rechts verschoben hat, daß der Bolzen an der linken Seite des Lang- loches anstößt, wird der bewegliche Wagenteil mit nach rechts genommen. Nach Beendigung des Wagenrücklaufs wird die Kupplung der Wagenrücklaufwelle durch den beweglichen Wagenteil über ein Hebelsystem ausgerastet. Gleichzeitig wird der Hebel (25), wenn er auf den Anschlag (13) des Unterbaues trifft, aus dem 2. Zahn des Sektors (27) aus- geklinkt. Durch Federkraft kehren der Hebel (26) und der Sektor (27) in ihre Ausgangsstellung zurück, in der die Schaltklinke (22) auf den Anschlag (21) zu liegen kommt und nicht in das Schaltrad (23) eingreift. 10. D r u c k w e r k Das Druckwerk dient zum Drucken des Textes auf das Papier und zur Steuerung der Auflagestücke des Lochers mit Hilfe der Wählschienen des Kombinators. Der prinzipielle Aufbau des Druckwerkes ist in Abb. 7 dar- gestellt. Auf Grund der Aufgabenstellung enthält das Druckwerk: a) Exzenterantrieb b) Druckwerk c) Kombinator d) Farbbandgabel e) Farbbandtransport und Farbbandumkehrung f) Nockenwellen g) Zusätzliche Bauteile In Abhängigkeit von der Stellung des Arbeitsumschalters führt das Druckwerk folgende Arbeiten aus: a) Drucken des Textes auf Papier b) Einstellung einer Kombination von Ansatzstücken des Lochers c) Drucken des Textes auf Papier und Einstellung einer Kombination von Ansatzstücken des Lochers. 10.1. Exzenterantrieb (Abb. 8) Der Exzenterantrieb dient zur Umwandlung der Drehbewegung des Exzenters in eine Hin- und Herbewegung der Stange (4) mit dem Bügel (5). Der Bewegungsablauf der Stange (4) wird durch das Profil des Exzenters (11) bestimmt. Der Exzenter- antrieb besteht aus dem Hebel (8) mit der Rolle (10), der Feder (9) und der Zugstange (6), die die Hebel (2) und (8) miteinander verbindet. Die Lage des Hebels (2) auf der Achse (I) kann in gewissen Grenzen durch Schrauben und Andruckleiste (12) verändert werden. Die Achse (1) ist starr mit dem Hebel (3) verbunden, der die Stange (4) mit dem Bügel (5) bewegt. Auf der Abb. 8 ist die Stoppstellung des Exzenterantriebes dargestellt. In die- sem Falle befindet sich die Rolle (10) des Hebels (8) auf dem maximalen Radius des Exzenters (11) und wird durch die Feder (9), deren Spannung mit Hilfe der Mutter (7) reguliert werden kann, an den Exzenter gedrückt. Die Stange (4) mit dem Bügel (5) sind in ihrer linken Endstellung. Bei Drehung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes läuft die Rolle (10) auf dem Exzenter (11). Die Zugstange (6) und der Hebel (2) dreht die Achse (1) entgegen dem Uhrzeigersinn. Der Hebel (3) schiebt die Stange (4) mit dem Bügel (5) in die rech- te Endlage, wie es in Abb. 9 dargestellt ist. 10.2. Abdruck eines Zeichens auf Blatt (Abb. 10) Das Druckwerk besteht aus den Elektromagneten (1), den Freigabehebeln (14), dem Druckbügel (5), den Stoßhebeln (11) und den Typenhebeln (8). Bei Stoppstellung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes sind die linken Enden der Stoßhebel (11) durch den Druckbügel in die untere Stellung gebracht, so daß ein Spalt zwischen ihnen und der Sperrnase des Freigabehebels (14) vorhanden ist. Bei Be- tätigen eines Tastenhebels wird die Hauptwelle für einen Ar- beitszyklus freigegeben und die Wicklung eines der Elektro- magneten (1) erhält einen Stromimpuls. Der Anker des Elektromagneten überwindet die Kraft der Fe- der (13) und bewegt die Stange (2) nach rechts. Der Freigabe- hebel (14) nimmt die punktiert gezeichnete Stellung ein. Nach Anziehen des Elektromagneten beginnt sich der Hebel (3) zu bewegen und schiebt die Stange (4) mit dem Druckbügel (5) nach rechts. Das linke Ende des Stoßhebels (11), der nicht vom Freigabe- hebel (14) festgehalten wird, wird durch die Kraft der Feder (15) an die obere Kante des Druckbügels (5) gedrückt und greift bei Rechtsbewegung des letzteren ein. Von diesem Moment an bewegen sich der Druckbügel (5) und der Stoßhebel (11) gemeinsam. Da der Typenhebel (8) mit dem Stoßhebel (11) verbunden ist, wird er um die Achse (9) gedreht. Die Bewegung des Druckbügels (5) und des Stoßhebels (11) geht im Laufe eines Arbeitszyklus in einem kurzen Zeitab- schnitt (t = 30 ms) vor sich, infolgedessen erhält der Typen- hebel eine bedeutende Beschleunigung. Auf der Abb. 11 ist eine Zwischenstellung der Teile des Druck- werkes und auf Abb. 12 der Zeitpunkt, an dem die Type auf die Schreibwalze aufschlägt, dargestellt. Vor dem Aufschlag der Type auf die Schreibwalze läuft der Typenhebel (8) in einer Führungsgabel, die die Stelle des Abdruckes auf dem Papier festlegt und mit deren Hilfe ein gleichmäßiger Abstand zwischen den gedruckten Zeichen erreicht wird. Die Einfärbung des Buchstabens erfolgt durch das Farbband, das durch die Farbbandführung (7) gehalten wird, die durch den Hebel {6) gesteuert wird. Der Hebel (6) nimmt vor dem Anschlag der Type auf die Walze, (Abb. 11 und 12), die obere und in der Stopplage des Druckwerkes, (Abb. 10), die untere Stellung ein. Die Deutlichkeit des abgedruckten Zeichens hängt von der Endgeschwindigkeit des Typenhebels ab, die durch den Ab- wurfbügel (12) bestimmt wird. Praktisch wird der Abwurfbügel (12) so angeordnet, daß er den Stoßhebel (11) von dem Druckbügel (5) bereits vor dem Anschlag des Typenhebels auf die Wagenwalze abstreift (Abb. 11). Infolgedessen legt dieser den letzten Teil des Weges auf Grund seiner Trägheit zurück, wodurch der Schlag der Type abgeschwächt und folglich auch die Deutlichkeit geringer wird. Nach dem Anschlag auf die Schreibwalze wird der Typenhebel durch die Kraft der Feder (15) wieder in die Ausgangsstellung gebracht, die durch den Typenhebelkorb (16) begrenzt ist. 10.3. Steuerung des Lochers durch den Kombinator (Abb. 7) Der Kombinator dient zur Steuerung der Auflagestücke des Lochers und besteht aus 5 Wählschienen (29) mit Federn (38). Die Wählschienen sind als Teil eines Kreisbogens ausgeführt und mit Aussparungen versehen, in die beim Anziehen eines Elektromagneten (31) der untere Arm des jeweiligen Freigabe- hebels (36) einfällt. In der Stoppstellung der Welle mit dem Nocken (19) befindet sich die Rolle des Hebels (20) auf dem maximalen Radius. Mit dem Regelarm des Hebels (27) werden die Wählschienen (29) in die rechte Stellung gebracht. In dieser Stellung befindet sich in. allen Wählschienen für die unteren Arme der Freigabehebel eine Aussparung. In diese Aussparung kann bei Ansprechen eines beliebigen Elektromagneten des Druckwerkes der untere Arm des Freigabehebels (36) einfallen. Bei Drehung der Welle mit dem Nocken (19) geht die Rolle des Hebels (20) auf den kleinen Radius über. In diesem Falle bewegen sich die Wähl- schienen (29) unter dem Einfluß der Federn (30) nach links. Die Drehung der Nockenwelle erfolgt erst nach dem An- sprechen eines der Elektromagneten des Druckwerkes, d. h. nach den1 Einfallen des Freigabehebels (36) in die Aussparun- gen der Wählschienen (29). Die Abmessungen der Aussparun- gen der Wählschienen (29) sind in der Länge verschieden und so berechnet, daß jeder Freigabehebel eine nur ihm eigene Stellung der Wählschienen (29) und der mit letzteren verbun- denen Hebel (26) gewährleistet. Die oberen Arme der Hebel (26) sind mit den Auflagestücken des Lochers verbunden. Die unteren Arme der Hebel (26), die mit dem Feststellhebel (23) zusammenwirken, dienen zum Verriegeln der Wählschie- nen bis zur Beendigung des Stanzens des entsprechenden Zeichens. Der Feststellhebel (23) wird durch den Nocken (22) und die Feder (24) gesteuert. Nach Einstanzen der Kombination in den Lochstreifen wird der Feststellarm des Hebels (23) durch den Nocken (22) nach unten gebracht und die Wählschienen (29) werden durch den Exzenter (19) und die Hebel (20) und (27) in die Ausgangsstellung ge- bracht. 10.4. Farbbandgabel (Abb. 7) Während der Stoppstellung der Hauptwelle des Schlüsselge- rätes befindet sich das Farbband, mit dessen Hilfe die Typen eingefärbt werden, unter der zu schreibenden Zeile und behin- dert nicht die Kontrolle des geschriebenen Textes. Zum Mo- ment des Anschlages wird das Farbband angehoben und zwischen Type und Papier gelegt. Das Heben und Senken des Farbbandes erfolgt durch die Farbbandgabel. Am rechten Ende der Stange (38) ist eine frei drehbare Rolle angebracht, die mit der unteren Nase des Hebels (46) zusammenwirkt. In der Nut des Hebels (46) liegt ein Finger, der starr mit der Farbband- gabel (47), in deren oberen Ende das Farbband durchgeführt wird, verbunden ist. Bei Bewegung der Stange (38) nach rechts läuft die Rolle, die an ihrem einen Ende befestigt ist, an der Schräge des Hebels (46) entlang, verschiebt denselben und die mit ihm verbun- dene Farbbandgabel (47) vor dem Anschlag der Type in die obere Stellung vor das Blatt; der Hebel (46) mit der Farbband- gabel (47) wird durch eine Feder in die untere Lage gezogen. 10.5. Farbbandtransport und Farbbandumkehrung (Abb. 7) Beim Abdrucken des Textes bewegt sich das Farbband auto- matisch nach Abdruck eines Zeichens weiter. Die Weiterschal- tung des Farbbandes erfolgt durch den Farbbandtransport. In dem Schlüsselgerät wird ein Farbband von 13 mm Breite ver- wandt. Die Enden des Farbbandes sind auf 2 Spulen, die starr mit den Achsen (54) verbunden sind, befestigt. Am Hebel (57), der der Umlaufbahn des Druckexzenters (58) folgt, befindet sich der Hebel (56), der das Schaltrad (1) um einen Zahn weiter bewegt. Die Achse (6) mit dem auf ihr befestigten Schaltrad (1), den zwei Kronenrädern (9) und den abgeschrägten Buchsen (4) und (8) nimmt im Laufe der Arbeit entweder die rechte oder linke Endstellung ein. In der rechten Endstellung der Achse (6) greift das rechte Zahn- rad in das Zahnrad (2) ein, das auf der Achse (54) mit der Spule, auf die das Farbband gewickelt wird, sitzt. In dieser Stellung sind die Zahnräder (9) und (11) nicht im Eingriff und das Farbband kann ungehindert aufgewickelt werden. Das linke Fähnchen (53) wird durch die Feder (10) an das Farbband gedrückt. In dem Maße wie sich das Farbband aufwickelt, nähert sich das untere gebogene Ende der Achse der abge- schrägten Buchse (8) und greift letzten Endes in die Abschrä- gung ein. Bei einer weiteren Drehung der Achse (6) wird diese nach links geschoben. Die Zahnräder (9) und (11) kommen zum Eingriff, folglich ändert sich die Bewegungsrichtung des Farb- bandes. In jeder Einstellung wird die Achse (6) festgehalten, damit ein Ausrasten der arbeitenden Zahnräder verhindert wird. 10.6. Zusatzvorrichtungen für die Arbeit des Druckwerkes bei den einzelnen Betriebsarten (Abb. 7) Zu den Zusatzvorrichtungen gehören: a) Der Feststellhebel (61), der durch den Nocken (62) ge- steuert wird. Steht der Arbeitsumschalter aufL, so wird durch den Hebel (61) der Hebel (57) blockiert. b) Der Hebel (48), der die Bauteile für die Teilung des Ge- heimtextes in Fünfergruppen einstellt. Die Steuerung des Hebels erfolgt vom Betriebsartenumschalter oder vom Hebel (11), Abb. 52, durch die Zugstange (59). c) Das System von Zugstangen, (51), (44), (42), (35) und (34), das von dem Nocken der Hauptwelle gesteuert wird und die Fortbewegung des Wagens in jedem Zyklus bewirkt. 11. G r u n d p l a t t e (Abb. 25) Die Grundplatte dient zur Befestigung aller Baugruppen und Steuerteile des Schlüsselgerätes. Die mechanischen Bauteile der Grundplatte werden hauptsächlich vom Knopf (1) des Betriebs- artenumschalters und vom Knopf (48) des Arbeitsumschalters gesteuert. Der Knopf (1) hat drei feste StellungenK,DundC, die den drei Betriebsarten entsprechen. Jede dieser drei Stellungen wird durch die Rastklinke (3) mit Feder fixiert. Die Drehung des Knopfes (1) wird durch das Kegelradpaar auf die Welle (4) übertragen. Das Zahnrad (12) verschiebt die Zahn- stange (15), die über Zwischenelemente die notwendige Stellung des Betriebsartenumschalters erreicht. Der Nocken (46), der den im Chiffrator gelegenen Hebel (45) steuert, schaltet in der StellungDoderCden Antrieb des Chiffrators ein und in der StellungKaus. Befindet sich der Nocken (40) in der StellungC, so stellt er den Hebel (41) so ein, daß eine Teilung des zu druckenden Textes in Fünfergruppen erfolgt. Der Nocken (29) und der Hebel (30) schalten in der StellungCdas Zeichenzählwerk mit Zwischenraumgeber ein. Durch das Zahnrad (11) wird die Drehbewegung der Welle (4) auf die welle (8) übertragen, die in der Tastatur liegt. Der Arbeitsumschalter (48) hat drei feste StellungenB,BLundL. Der Nocken (24) blockiert in der StellungLdas Druckwerk. Der Nocken (25) und der He- bel (26) schalten in der StellungB6den Locher ab. Der Nok- ken (23) schaltet in der StellungLdie Weiterschaltung des Wagens während eines jeden Zyklus ab, indem er auf die Zug- stange (36) einwirkt und sie aus dem Hebel (22) ausklinkt. Die Zugstange (10) verhindert, daß, wenn die Wagenrücklauftaste gedrückt wurde, der Wagen fortgeschaltet wird. Indem sie auf den Bügel (43) und die Stange (36) einwirkt, wird letzterer aus dem Hebel (22) ausgeklinkt und es wird das Ansprechen der Elemente für die Wagenweiterschaltung ausgeschlossen. 12. S t r o m v e r s o r g u n g (Abb.38) Die Stromversorgung ermöglicht das Anschließen der elektri- schen Bauteile des Schlüsselgerätes an ein Wechselstromnetz mit einer Spannung von 100 bis 250 V bei einer Frequenz von 50 Hz oder an ein Gleichstromnetz mit einer Nennspannung von 110 V, Die Stromversorgung ist auf einem rechtwinkligen Chassis (2) aufgebaut und an der Grundplatte des Schlüssel- gerätes befestigt. Die Stromversorgung besteht aus: a) Dem Transformator (4). b) 2 Umschaltern (7), die durch den Schalthebel (5) gesteuert werden und die elektrischen Stromkreise des Schlüssel- gerätes entsprechend der Art der Stromquellen verbinden. c) Dem Begrenzungswiderstand (9). d) Der Steckerleiste (3, die zur Verbindung der elektrischen Teile der Stromversorgung mit den elektrischen Teilen der Grundplatte dient. e) Einem Voltmeter (I), mit einer Skala von 0-150 V zum Messen der Spannung an der Sekundärwicklung des Transformators (4). f) Einem Spannungswahlschalter (6), der entsprechend der Nennspannung des Netzes, die auf der Skala (8) eingra- viert ist, eingestellt wird. 13. F i l t e r (Abb. 27) Der Filter dient zur Schwächung der Funkstörungen, die von den elektrischen Bauteilen des Schlüsselgerätes hervorgerufen werden. Auf einer Metallplatte (6) sind 4 Drosseln (4) paarweise und auf zwei Winkeln (7) vier Kondensatoren (5) angeordnet. Die Drosseln sind auf Alsiferringe gewickelt. Jeder Ring hat eine Wicklung mit 160 Windungen aus Draht von 0,69 mm Im Filter wurden Durchführungskondensatoren vom TypKBPmit einer Kapazität von 0,251 my F und einer Betriebs- spannung von 250 V verwandt. Zum Anschalten des Filters an das Netz und an die elektrischen Bauteile sind auf der Metallplatte (6) zwei Steckerleisten (1) und (8) angebracht. Der Filter ist an der hinteren Wand der Grundplatte unter den Elektromagneten des Druckwerkes be- festigt. 14. D i e e l e k t r i s c h e n B a u t e i l e d e r B a u g r u p p e n Die elektrische Prinzipschaltung des Schlüsselgerätes ist auf dem Stromlaufplan 40 S1 dargestellt. Die Verdrahtung der elektrischen Bauteile des Schlüsselge- rätes ist für jede Baugruppe einzeln ausgeführt. Die elektrische Verbindung zwischen den Baugruppen wird durch Stecker her- gestellt. 14.1. Elektrische Bauteile der Stromversorgung a) Der Transformator (Tr I), dessen Primärwicklung 10 An- schlüsse hat und an ein Wechselstromnetz mit einer Fre- quenz von 50 Hz und einer Nennspannung von 100, 110, 127, 145, 160, 190, 220, 230 und 250 V angeschlossen werden kann. Die Anschlüsse des Transformators sind an die Lamellen des Spannungswahlschalters angeschlossen, dessen Schleifkontakt auf die der Netzspannung des Netzes entsprechende Lamelle eingestellt wird. b) Das Voltmeter (MI I) für die Kontrolle der Größe der Wechselspannung an der Sekundärwicklung des Trans- formators (Tr 1). c) Die zweipoligen Schalter, Sch 3 und Sch 2, für die Um- schaltung der Stromkreise in Abhängigkeit von der Art des Stromes der Stromquelle. d) Die Steckerleiste, St 8, für die elektrische Verbindung zwischen den Bauteilen der Stromversorgung mit den Bauelementen der Grundplatte. e) Widerstand R 6 (390 Ohm, 20 W), der den Strom im Kreis der Elektromagneten begrenzt, wenn das Schlüssel- gerät an ein Wechselstromnetz angeschlossen wird. 14.2. Elektrische Bauteile der Grundplatte a) Federleiste, Hü 5, für die elektrische Verbindung durch die Messerleiste, St 6, mit dem Motor, (M 1), der sich im Antrieb des Schlüsselgerätes befindet. b) Federleiste, Hü 7, die in die Messerleiste, St 8, der Strom- versorgung gesteckt wird. c) Die Federleiste Hü 1 und die Federleiste Hü 4, die an der hinteren Wand der Grundplatte angebracht sind, dienen zur Verbindung mit den Bauteilen des Filters. d) Die Sicherungen Si-1 A und Si-2 A befinden sich an der rechten Seite der Grundplatte. e) Regelbarer Drahtwiderstand R 3 (510 Ohm, 50 W), der in Serie mit der Erregerwicklung des Elektromotors (M 1) liegt und zum Regeln der Drehzahl bei der Arbeit vom Gleichstromnetz dient. f) Drahtwiderstand R 4 (820 Ohm, 50 W) und Kondensator C 3 (0,015 my F, 500 V), die bei Speisung vom Wechsel- stromnetz in den Stromkreis des Fliehkraftreglers des Elektromotors (M 1) eingeschaltet sind. g) Widerstand R 2 (1000 Ohm, 1 W) und Kondensator C 2 (0,25 my F, 400 V) bilden die Funkenlöschung für den Im- pulskontakt, der sich am Antrieb des Schlüsselgerätes befindet. h) Widerstand R 1 (1000 Ohm, 1 W) und Kondensator C 1 (0,25 my F, 400 V) bilden die Funkenlöschung für den Kon- takt ZWD. i) Vier Germaniumdioden Ge1, Ge2, Ge3, Ge4, die als Graetz- gleichrichter geschaltet sind und die Elektromagnete des Druckwerkes bei Anschluß des Schlüsselgerätes an das Wechselstromnetz speisen. j) Elektrolytkondensator C 4 (50 my F, 300 V) zur Glättung der gleichgerichteten Spannung. k) Übergangskontaktleisten ÜKL 5, die mit der Übergangs- kontaktleiste ÜKL 6, die sich ihrerseits am Antrieb befin- det und an den Impulskontakt angeschlossen ist, verbun- den ist. l) Netzschalter Sch 1 zum Einschalten des Schlüsselgerätes. m) Übergangsleiste ÜKL 1, die die elektrische Verbindung zwischen den Elementen des Chiffrators und des Druck- werkes herstellt. n) Elektromagnet EM 28, der sich am Locher befindet. o) Sicherungskontakt SK, der die Leitung unterbricht, wenn der Betriebsartenumschalter nicht richtig eingestellt ist. p) Widerstand R 5 (470 Ohm, 10 W) im Stromkreis der Wick- lung des ElektromagnetenZwischenraum. 14.3. Elektrische Bauteile des Antriebes a) Elektromotor (M 1), Typ SL-369 uA 1. Die Speisung des Elektromotors erfolgt vom Gleichspannungsnetz mit der Spannung 110 V oder vom Wechselstromnetz 127 V unter Anwendung eines Reglers. Die Umschaltung der Wicklung des Elektromotors für die Arbeit mit Gleich- oder Wechselstrom erfolgt durch den entsprechenden Stecker St 10. Wird der Elektromotor vom Wechselstromnetz ge- speist, so arbeitet er als Reihenschlußmotor, wobei eine Erregerwicklung MI-M2 benutzt wird. Wird der Elektro- motor vom Gleichstromnetz gespeist, so arbeitet er als Nebenschlußmotor mit hintereinander geschalteten Er- regerwickiungen. b) Messerleiste St 6 und Federleiste Hü 5 dienen zur Ver- bindung der Wicklung des Elektromotors mit den Bau- elementen, die sich in der Grundplatte befinden. c) Der Kontakt RK gehört zum Fliehkraftregler des Elektro- motors (M 1). d) Der Impulskontakt IK, der im Stromkreis der Elektro- magnete liegt, wird durch einen Nocken der Hauptwelle des Schlüsselgerätes für eine bestimmte Zeit des Arbeits- zyklus geschlossen. Der Kontakt IK ist an die Übergangs- kontaktleiste ÜKL 6 angeschlossen, die $mit der Über- gangskontaktleiste ÜKL 5 der Grundplatte verbunden ist. 14.4. Elektrische Bauteile der Tastatur a) Sie besteht aus 28 Kontaktgruppen. Die jeweils inneren und die jeweils äußeren Kontaktfedern jeder Gruppe sind miteinander verbunden. b) Die Übergangskontaktleiste ÜKL 4 mit 32 Federkon- takten. Die inneren Kontaktfedern der Kontaktgruppen in der Tastatur sind mit dem 1. bis 28. Kontakt der Über- gangskontaktleiste UKL 4 verbunden. Die äußeren Kon- takte der Kontaktgruppen mit dem gemeinsamen Pol am Kontakt 32. 14.5. Elektrische Bauteile des Druckwerkes a) 27 Elektromagnete EM1 bis EM27. b) Übergangskontaktleiste ÜKL 2 mit flächenartigen Kon- takten. Ein Ende der Wicklung ist auf die gemeinsame Leitung 28 geführt, die durch die Kontakte 38, 39 und 40 der Kon- taktleiste ÜKL 2 verbunden ist. 14.6. Elektrische Bauteile des Chiffrators a) Der Betriebsartenumschalter, der aus den Kontaktleisten KL 3, KL 4, KL 5 und KL 6 besteht. Die Kontaktleisten KL 3 und KL 6 sind auf der Grundplatte des Betriebs- artenumschalters befestigt. die Leisten KL 4 und KL 5 können verschoben werden. Sie nehmen eine der drei festen Stellungen ein, die den drei BetriebsartenK,DundCentsprechen. Jede der Leisten hat drei Reihen Kontakte I, I1 und 111. Die jeweils gleichen Reihen der Leisten KL 3, KL 4 und der Leisten KL 5, KL 6 geben miteinander Kontakt. Die Leisten KL 3 und KL 6 haben feste Kontaktstifte und die Leisten KL 4 und KL 5 gefe- derte Kontaktstifte. b) Die Kontaktleisten KL, die zwei mit der Grundplatte starr verbundene Kontaktleisten KL 7 und KL 8 besitzt, zwi- schen denen 5 Kontaktleisten liegen (auf der Zeichnung nicht angeführt). Jede der 5 Kontaktleisten besitzt vier Reihen von je 26 Kontakten. Die Leisten KL 7 und KL 8 haben zwei Reihen von je 13 Kontakten. Die 5 Kontakt- leisten KL verschieben sich bei jedem Arbeitsgang des Chiffrators und schließen die Stromkreise des Druck- werkes des Schlüsselgerätes, indem sie den Klartext ver- schlüsseln und den Geheimtext entschlüsseln. c) Die Übergangskontaktleiste ÜKL 3 stellt die elektrische Verbindung mit den Bauelementen der Tastatur durch die Übergangskontaktleiste ÜKL 4 und mit den Bauelemen- ten des Druckwerkes durch die Ubergangskontaktleiste ÜKL 1 der Grundplatte her. 14.7. Elektrische Bauteile des Filters a) 4 Drosseln Dr 1, Dr 2, Dr 3 und Dr 4, die hintereinander zu je zwei in jede Leitung der Stromquelle eingeschaltet sind. b) 4 Kondensatoren C 5, C 6, C 7 und C 8. Jeder Kondensa- tor hat einen stromführenden Draht, der mit einer Platte des Kondensators verbunden und in die Speiseleitung eingeschaltet ist. Die andere Kondensatorplatte wird mit dem Gehäuse des Schlüsselgerätes verbunden. Der Filter wird mit Hilfe von Messerleisten St 2, St 3, und den Fe- derleisten Hü 1, Hü 4 in die Speiseleitung eingeschaltet. 15. S t r o m l a u f p l a n Der Stromlauf von dem Netzstecker (Nst) der Schnur zu den Kontakten 2 und 5 der Leiste Hü 7 ist für die Arbeit mit Gleich- sowie Wechselstrom gleich und wird deshalb in. der weiteren Abhandlung nicht mehr erwähnt. a) Nst; Hü 1; St 2; Cs; Dr 1; C6; Dr 2; St 3; Hü 4; Si 2 A; Sch 1 Kontakt 4, 6; Kontakt.2 Hü 7. b) Nst; HÜ 1; St 2; C,; Dr 3; C8; Dr 4; St 3; Hü 4; Sc11 B Kontakt 3,5; Kontakt 5 Hü 7. 15.1. Stromkreis der Primärwicklung des Transformators (Tr 1) Kontakte 2 der Leisten Hü 7 und St 8; geschlossene Kontakte 4, 6 des Umschalters Sch 3, Primärwicklung des Transformators (Tr 1), geschlossene Kontakte 5, 3 des Umschalters Sch 3; Kon- takte 5 Leisten St 8, Hü 7. 15.1.1. Stromkreis der Sekundärwicklung des Transformators (Tr 1) Sekundärwicklung des Transformators; geschlossene Kontakte 6, 4 des Umschalters Sch 2; Kontakte 3 der Leisten St 8, Hü 7, Kontakte 4 der Leisten Hü 5, St 6; Kontakt 2 der Leiste Hü 9; Erregerwicklung M1 - M2; Kon- takte 5, 6 der Leiste Hü 9; Kontakt RK; Kontakt 3 der Leiste Hü 9; Ankerwicklung A 1, A 2; Kontakt 8 der Leiste Hü 9; Leitung 3; 3 der Leisten St 6, Hü 5; Kontakte 6 der Leisten Hü 7, St 8; Kontakte 3, 5 des Umschalters Sch 2; Se- kundärwicklung (Tr 1). 15.2. Stromkreis des Elektromotors (M 1) bei Anschluß an ein Gleicbstsromnetz Kontakte 2 der Leisten Hü 7, St 8; Kontakte 4, 2 des Umschal- ters Sch 3; Kontakte 2, 4 des Umschalters Sch 2; Kontakte 3 der Leisten St 8, Hü 7; Kontakte 1 der Leisten Hü 5, St 6; Kontakt 2 der Leiste Hü 9; Erregerwicklung Mi - M:,; Kontakte 5, 4 der Leiste Hü 9; Erregerwicklung M1 -M3; Leitung 5; Kontakte 5 der Leisten St 6, Hü 5, Regelwiderstand 3 ; Kon- takte 2 der Leisten Hü 5, St 6; Leitung 2; geschlossene Kon- takte 9, 8 der Leiste Hü 9; Leitung 3; Kontakt 3 der Leisten St 6, Hü 5; Kontakt 6 der Leisten Hü 7, St 3; Kontakte 3, 1 des Umschalters Sch 2; Kontakte 1, 3 des Umschalters Sch 3; Kontakte 5 der Leisten St 8, Hü 7. Die Ankerwicklung des Motors ist an den Kontakten 3 und 6 der Leiste Hü 9 angeschlossen, d. h. parallel zur Stromquelle. 15.3. Stromkreis im Druckteil des Schlüsselgerätes bei Anschluß an eine Wechselstromquelle Die Wechselspannung, die an der Sekundärseite des Trans- formators (Tr 1) anliegt, wird zum Gleichrichter von einer Seite der Sekundärwicklung aus geführt: Kontakte 6, 4 des Umschalters Sch 2; Kontakt 3 der Leiste St 8; Begrenzungswiderstand R 6; Kontakte 1 der Leisten St 8, Hü 7; gemeinsamer Punkt der Dioden Ge 1 und Ge 2. Von der anderen Seite der Sekundärwicklung des Transfor- mators: Kontakte 5, 3 des Umschalters Sch 2 Kontakte 6 der Leisten St 8, Hü 7; Kontakt 3 der Leiste Hü 5; Sicherung Si 1 A, ge- meinsamer Punkt der Dioden Ge 3 und Ge 4. Die Wechselspannung der Sekundärwicklung des Transforma- tors (Tr 1) wird von einer einphasigen Brücke, die aus 4 Dio- den besteht, die in Graetzschaltung geschaltet sind, gleichge- richtet. Die gleichgerichtete Spannung positiver Polarität (+ der Stromquelle) wird von dem gemeinsamen Punkt der Dio- den Ge 2 und Ge 3 und diejenige negativer Polarität (- der Stromquelle) vom gemeinsamen Punkt der Dioden Ge 4 und Ge 1 abgenommen und dem Kondensator C 4 zur Glättung zu- geführt. Bei einer Speisung von einer Wechselstromquelle liegt am Kondensator C 4 nach Einschalten des Schlüsselgerätes eine gleichgerichtete Spannung an, die für die Speisung der Elektromagneten des Druckteiles des Schlüsselgerätes verwandt wird. 15.4. Stromkreis im Druckteil des Schlüsselgerätes bei Anschluß an eine Gleichstromquelle Der oben beschriebene Stromverlauf beim Anschluß an eine Wechselstromquelle bleibt ohne Veränderung auch beim An- schluß an eine Gleichstromquelle. Wie oben beschrieben, wird die Wechselspannung von der Se- kundärwicklung des Trafos (Tr 1) an die Kontakte 1 und 6 der Leisten St 8 und Hü 7 gebracht. Wie aus dem Stromverlauf der Stromversorgung ersichtlich ist, wird bei der Umschaltung der Schalter Sch 2 und Sch 3 auf Gleichstrom die Spannung der Stromquelle ebenfalls an die Kontakte 1 und 6 der Leisten St 8 und Hü 7 gebracht, wobei der Begrenzungswiderstand R 6 überbrückt wird. Die Germaniumdioden Ge 1 - Ge 4 werden beim Anschluß an eine Gleichstromquelle aus dem Stromverlauf nicht abge- schaltet, sondern sind am Stromverlauf mit beteiligt. 15.5. Stromverlauf bei Klartext Nach Betätigung des Tastenhebels z. B.Aläuft die Haupt- welle des Schlüsselgerätes für einen Arbeitszyklus an, bei dessen Beginn der KontaktIKgeschlossen wird. Der Verlauf des Stromimpulses ist folgender: + der Stromquelle; Kontakt; SK; Kontakte 1, 2 der Leisten ÜKL 5 und ÜKL 6; geschlossener Kontakt IK; Kontakte 3, 4 der Leisten ÜKL 6, ÜKL 5; Leitung 32; Kontakt 32 der Leisten ÜKL 1 der Grundplatte; Kontakt 32 der Leiste ÜKL 3 des Chiffrators; Leitung 56; geschlossener Kontakt des Kupplungs- kontaktes KK; Leitung 55; Kontakte 32 der Leisten UKL 3, ÜKL 4; Leitung 32; geschlossener KontaktAder Tastatur; Leitung 1 ; Kontakt 1 der Leisten ÜKL 4, ÜKL 3; Leitung 28. Der Kontakt der Leiste KL 5, zu dem die Leitung 28 führt, be- rührt in der StellungKdes Betriebsartenumschalters den lin- ken Kontakt in der ersten und zweiten Reihe c)er Leiste KL 6. Vom linken Kontakt der zweiten Reihe der Leiste KL 6 geht der Stromimpuls auf den linken der zweiten Reihe der Leiste KL 5 und über die Leitung 1 auf den Kontakt 1 der Leisten ÜKL 3, ÜKL 1, ÜKL 2; an die Wicklung des ElektromagnetenAim Druckwerk; Leitungen 29, 28; Kontakte 40, 39, 38 der Leisten ÜKL 2, ÜKL 1; Leitung 30; - Stromquelle. Bei dem angeführten Stromlauf spricht der Elektromagnet an und ge- währleistet den Abdruck des BuchstabensA. 15.6. Stromverlauf beim Chiffrieren Nach Betätigen der Taste z. B.A, des Anlaufens der Haupt- welle des Schlüsselgerätes und Schließen des KontaktesIKgeht der Stromimpuls, wie schon oben beschrieben, bis an den Kontakt der ersten Reihe der LeisteKL5, der mit der Lei- tung 28 verbunden ist. In der StellungCdes Betriebsarten- umschalters liegen die Kontakte der ersten Reihe der LeisteKL5 über den dritten Kontakten (von links) der ersten Reihe der Leiste KL 6. Weiterer Stromverlauf: Leitung 82; Kontakt 5 der Leiste KL 8; Stromkreis Kontakt- leisten 1-5, auf Grund deren Stellung wir z. B. auf den Kon- takt 18 der Leiste KL 7 kommen; Leitung 73 auf den zweiten Kontakt von links der dritten Reihe der Leiste KL 3 des Be- triebsartenumschalters, der mit dem 6. Kontakt von links der gleichen Reihe verbunden ist; auf den 2. Kontakt von links der dritten Reihe der Leiste KL 4 und weiter mit der Leitung 18 auf den Kontakt 18 der Leisten ÜKL 3, ÜKL 1, ÜKL 2; Spule des ElektromagnetenR, Leistung 29, 28; Kontakte 40, 39, 38 der Leisten ÜKL 2, UKL 1; Leitung 30; - Stromquelle. Deshalb wird in der StellungCdes Betriebsartenumschalters bei Betätigen der TasteAeinRabgedruckt. 15.7. Stromverlauf beim Dechiffrieren Im vorhergehenden Falle wurde bei Drücken der TasteAdasRabgedruckt, d. h. es erfolgte ein Verschlüsseln des Zei- chensAin das ZeichenR. Im gegebenen Falle muß beim Dechiffrieren die TasteRgedrückt werden, und es wirdAabgedruckt. Wenn man den Stromverlauf von der nach Drük- ken der TasteRgeschlossenen KontaktgruppeRder Tastatur beginnt: Geschlossener KontaktR; Leitung I8; Kontakt 18 der Leisten ÜKL 4, UKL 3, Leitung 45; erster Kontakt von links der dritten Reihe der LeisteKL4 des Betriebsartenumschalters; zweiter Kontakt von links der dritten Reihe der LeisteKL3; Leitung 73; Kontakt 18. Weil beim Chiffrieren des ZeichensAund beim Dechiffrieren des ZeichensRadie Kontaktleisten für das Schließen des Stromkreises die gleiche Lage einnehmen sollen, so muß der Stromimpuls von Kontakt 18 der LeisteKL7 auf umgekehrtem Wege auf Kontakt 5 der LeisteKL8 kommen und weiter Leitung 82 auf den 3. Kontakt von links der ersten Reihe der LeisteKL6, die mit dem zweiten Kon- takt von links der zweiten Reihe der LeisteKL6 verbunden ist. Letzterer berührt den ersten Kontakt von links der zweiten Reihe der LeisteKL5. Weiterer Stromverlauf: Leitung 1; Kontakte 1 der Leisten ÜKL 3, UKL 1, ÜKL 2; Wicklung des Elektromagneten A; Leitungen 29, 28; Kontakte 40, 39, 38 der Leisten ÜKL 2, UKL 1; Leitung 30; - Stromquelle. Im gegebenen Falle wird bei Betätigen der TasteRdas ZeichenAabgedruckt, d. h. es wird dechiffriert. 15.8. Stromverlauf beim Drücken der Wagenrücklauftaste Der Elektromagnet EM 28 für den Wagenrücklauf befindet sich am Locher und ist dafür bestimmt, die Auflagestücke zu steuern, die gewährleisten, daß in den Lochstreifen die Kombi- nationen Wagenrücklauf und Zeilenvorschub nach Drücken der Wagenrücklauftaste eingestanzt werden. Der Elektromagnet für Wagenrücklauf kann nur eingeschaltet werden, wenn der Betriebsartenumschalter aufKsteht. Nach dem Drücken der Wagenrücklauftaste, Anlaufen der Hauptwelle und Schließen des Kontaktes IK, geht der Stromimpuls angefangen von der KontaktgruppeWRder Tastatur: geschlossene KontaktgruppeWR; Leitung 28; Kontakt 28 der Leisten ÜKL 4, ÜKL 3; Leitung 409; Kontakt 28 der Leisten ÜKL 3, ÜKL 1; Leitung 31; Wicklung des Elektromagneten EM 28; - Stromquelle. 15.9. Stromverlauf beim Auslösen des Lochers vorn Knopf Dauer- auslösung Zwischenraum Beim Drücken des Knopfes Dauerauslösung Zwischenraum, der den KontaktZWDschließt, wird ein Stromkreis geschlossen, der folgendermaßen verläuft: + der Stromquelle, Widerstand R 5, geschlossener KontaktZWD, Leitung 29, Kontakt 27 der Leisten ÜKL 1, ÜKL 2, Wicklung des ElektromagnetenZwischenraum, Leitung 29, Leitung 28, Kontakte 40, 39 und 38 der Leisten UKL 2, ÜKL 1, Leitung 30 und - der Stromquelle. Beim Drücken auf den Knopf Dauerauslösung Zwischenraum wird der Locher eingeschaltet, die Kombinatorschienen ein- gestellt und in jedem Zyklus die Kombination Zwischenraum gelacht bis zum Loslassen des Knopfes. 16. Z e i t d i a g r a m m d e s S c h l ü s s e l g e r ä t e s C M - 2 Das Zeitdiagramm, Abb. 39, gibt die Reihenfolge der Arbeits- gänge des Schlüsselgerätes CM-2 in Abhängigkeit von der Zeit und von den Graden der Umdrehung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes an. Die Zeit für einen Arbeitszyklus beträgt 109 ms, wenn das Schlüsselgerät mit einer Geschwindigkeit von 550 Zyklen/ Minute arbeitet. Die Zeitdiagramme der Druckteile des Schlüsselgerätes, des Lochers und des Transmitters mit Dekombinator sind unter Berücksichtigung der Übersetzungen ausgeführt: a) von der Hauptwelle des Schlüsselgerätes zur Hauptwelle des Transmitters mit Dekombinator i = 40/43 b) von der Hauptwelle des Schlüsselgerätes zur Hauptwelle des Lochers i = 1 Im Zeitdiagramm sind folgende Bezeichnungen angenommen: P a) Die erzwungene Bewegung eines Elementes ist durch eine schräge Linie (von unten nach oben) gekennzeichnet. b) Die Bewegung auf Grund von Federkraft ist durch eine schräge Linie (von oben nach unten) gekennzeichnet. c) Das Andauern eines Arbeitsganges wird durch eine Hori- zontale dargestellt. 17. Inbetriebnahme des Schlüsselgerätes geschieht folgender- maßen: Der Kastenboden des Schlüsselgerätes wird auf den Arbeits- platz gestellt. Die 4 Schrauben werden gelöst und die Winkel, mit denen das Schlüsselgerät am Kastenboden befestigt ist, abgenommen. Bei Arbeit vom Gleichstromnetz ist es erforderlich: (Abb. 1) a) den Deckel (16) im rechten hinteren Teil des Gehäuses öffnen und den Stromartenstecker am Motor mit dem Zeichen=auf dem Antrieb nach oben stecken; b) den Schalter (13) der Stromversorgung in die Stellung=bringen; c) den Netzstecker einstecken; d) den Netzschalter aufEinstellen; e) die Arbeit an dem Schlüsselgerät beginnen. Bei Arbeit vom Wechselstromnetz ist es erforderlich: (Abb. 1) a) den Deckel (16) des hinteren Teiles des Gehäuses öffnen und den Stecker mit dem Zeichen~nach oben auf den Antrieb stecken; b) den Schalter (13) der Stromversorgung in die Stellung~bringen; c) den Spannungswahlschalter (27) in die Stellung bringen, die der Nennspannung des Netzes entspricht (oder der nächstgelegenen); d) den Netzstecker einstecken; e) den Netzschalter (23) des Schlüsselgerätes aufEINbringen, die Anzeige des Voltmeters überprüfen und mit der Arbeit beginnen. Die Primärwicklung des Transformators in der Stromversor- gung ist in einzelne Wicklungen aufgeteilt, wodurch eine stu- fenweise Regelung der sekundärseitigen Spannung gewähr- leistet wird. Praktisch kann man mit der Arbeit beginnen, wenn die Spannung der Sekundärwicklung des Transforma- tors, die vom Voltmeter angezeigt wird, in den Grenzen 127 ± 10 % Volt liegt, d. h. unter diesen Bedingungen wird die Ge- schwindigkeit der Arbeit nicht wesentlich verändert, weil der Fliehkraftregler vorhanden ist. Bei einer solchen Spannung ist auch die einwandfreie Arbeit der elektrischen Bauteile ge- währleistet. 18. Drehzah1regelung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes CM-2 Die Drehzahl der Hauptwelle des Schlüsselgerätes wird im Prüffeld einreguliert. Nach einer gewissen Betriebszeit kann sich die Drehzahl des Schlüsselgerätes infolge des Einarbeitens der mechanischen Bauelemente, etwas erhöhen. Eine Abweichung der Drehzahl kann auch beim Auswechseln des Elektromotors eintreten, da die Geschwindigkeitskennlinien in gewissen Grenzen streuen. In den aufgeführten Fällen ist eine Geschwindigkeitsregelung der Hauptwelle des Elektromotors erforderlich, die folgender- maßen durchgeführt wird: Bei Speisung von einer Wechselstromquelle wird die Ge- schwindigkeitsgelung durch Drehen der Mutter (9), Abb. 86, erreicht. Die Regelung kann man als abgeschlossen betrachten, wenn die Spannung an der Sekundärwicklung des Transforma- tors der Stromversorgung 127 ± 10 Volt beträgt und die Umdrehungen der Hauptwelle in den Grenzen von 500 ± 10 % Umdrehungen/Minute liegen. Wird vom Gleichstromnetz gearbeitet, so wird die Geschwindig- keit durch Verändern des Widerstandes (32), Abb. 49, der in Reihe mit der Erregerwicklung des Motors liegt, eingeregelt. Die Änderung des Widerstandes erfolgt durch Verschieben der Schelle, nachdem die Schraube, die die Stellung sichert, ein wenig herausgedreht wird. Bei Vergrößerung des Widerstan- des erhöht sich die Umdrehungsgeschwindigkeit des Elektro- motors. Bei einer Gleichspannung von 140 V soll die Umdrehungszahl der Hauptwelle bei 500 Zyklen/Minute liegen. Die Geschwin- digkeitsmessung der Hauptwelle führt man am günstigsten unmittelbar an der Hauptwelle bei Durchlauf des Schlüsselge- rätes, oder an der Zwischenwelle (24), Abb. 13, aus. Wenn ein Tachometer nicht vorhanden ist, so kann man die Umdrehungs- zahl der Hauptwelle messen, indem man den Sekundenzeiger der Uhr und die Anzeige des Gruppenzahlers im Chiffrator bei automatischer Arbeit des Schlüsselgerätes benutzt. In diesem Falle muß man der Anzahl der angezeigten Zeichen die An- zahl der Wagenrückläufe mal 4 hinzufügen, da der Wagen- rücklauf 4 Arbeitszyklen umfaßt. Um die Drehzahl der Haupt- welle des Schlüsselgerätes zu bestimmen, ist es notwendig, die in Zyklen/Minute bei automatischer Arbeit erhaltene Ge- schwindigkeit mit dem Koeffizienten 1,07, der die Übersetzung von der Hauptwelle des Schlüsselgerätes zur Hauptwelle des Transmitters mit Dekombinator berücksichtigt, malzunehmen. Es ist zu bemerken, daß bei Betrieb vom Wechselstromnetz eine Spannungsschwankung von ± 10 % eine unbedeutende, in der Größenordnung von 2 % liegende Drehzahländerung der Hauptwelle des Schlüsselgerätes hervorruft.
1. A l l g e m e i n e s
Die Wartung ist von großer Bedeutung für eine einwandfreie
Arbeit und eine lange Lebensdauer des Schlüsselgerätes.
1.1. Hinweise bei der Bedienung des Schlüsselgerätes
a) Während der Arbeit am Schlüsselgerät ist das Rauchen
oder Essen zu unterlassen.
b) Es ist nachzusehen, ob der Abfallkasten des Lochers ge-
leert werden muß. Dieser Abfallkasten ist öfters zu ent-
leeren, da sonst der Locher verstopfen kann.
c) Es ist nachzusehen, ob noch genügend Vorrat an Loch-
streifenpapier auf der Lochstreifenvorratsrolle in der
Kassette vorhanden ist. Ist die farbige Schlußmarkierung
des Lochstreifenpapiers durch den Locher durchgelaufen,
ist die Rolle auszuwechseln.
d) Öfters ist nachzusehen, ob die Typen verschmutzt sind
oder ob sich das Farbband abgenutzt hat.
e) Das Gerät ist staubfrei zu halten, öfter mit Pinsel und
Putzlappen zu säubern und bei Nichtbenutzung mit der
Schutzhaube abzudecken.
1.2. Auswechseln der Lochstreifenvorratsrolle
Beim Einlegen einer neuen Lochstreifenrolle ist folgendes zu
beachten:
a) Die Kassette ist seitlich herauszuziehen.
b) Der Verschluß der Lochstreifenrolle ist zu öffnen, und
der Rest der alten Rolle ist herauszunehmen.
c) Die Trommel ist herauszunehmen und der darunter be-
findliche Papierstaub ist mit einem Putzlappen zu ent-
fernen.
d) Dreht sich die Trommel in ihrer Führung etwas schwer
ist sie leicht zu ölen.
e) Die Papierführung des Lochers ist mit der im Werkzeug-
kasten befindlichen Räumnadel und einem Pinsel von
Papierstaub zu säubern.
f) Anschließend ist die neue Lochstreifenvorratsrolle, von
der man vor dem Einlegen einige Windungen abgewickelt
und abgerissen hat, in die Kassette einzulegen, der Ver-
schluß ist zu schließen, die Kassette ist in die beiden Füh-
rungsschienen einzuschieben und das Papier neu einzuführen.
1.3. Reinigen der Typen
a) Um diese Arbeiten zu erleichtern, ist die Stromversor-
gung und der Wagen abzunehmen.
b) Das Reinigen der Typen hat mit Reinigungsknetmasse,
die über die Typen gerollt wird, zu geschehen.
c) Gleichzeitig ist der Typenkorb mit einem Pinsel, der in
Spiritus bzw. Waschbenzin getaucht wird, zu reinigen.
Vorher ist ein Stück Preßspan oder Pappe unter die
Typenhebel zu schieben, damit der gelöste Schmutz nicht
in das Schlüsselgerät gelangt.
d) Anschließend ist der Sitz der Typenhebel leicht zu ölen.
1.4. Wechseln des Farbbandes
Es ist Schreibmaschinenfarbband von 13 mm Breite zu ver-
wenden. Das Farbband ist öfter als bei einer Schreibmaschine
zu wechseln bzw. umzudrehen, da der Anschlag härter und
deshalb die Abnutzung größer ist.
Das Auswechseln bzw. Umdrehen des Farbbandes geschieht
folgendermaßen:
a) Den Gehäusedeckel (35), Abb. 1, aufklappen.
b) Die beiden Rändelmuttern auf den Farbbandrollen sind
zu lösen.
c) Das Farbband ist aus der Farbbandgabel auszuhängen.
d) Das Fähnchen, welches an das Farbband drückt und die
Umschaltung bewirkt, ist seitlich abzubiegen und die
Farbbandrolle nach oben abzuheben.
e) Wird das Farbband nur umgedreht, sind die beiden Rol-
len miteinander auszutauschen.
f) Das Einsetzen der Farbbandrolle ist in umgekehrter
Reihenfolge vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, daß die
Farbbandrolle in den Führungsstift der Farbbandhalte-
rung eingreift.
2. Z e i t p l a n d e r W a r t u n g
Die Zahlen der Zählerumdrehungen beziehen sich auf den
Zähleranfangsstand plus angegebene Zahl.
2.1. Tägliche Kontrollstelle (Abb. 53)
(Auslösehebel für die Hauptwelle)
a) Täglich kontrollieren ob noch genügend Öl vorhanden ist.
2.2. Ölstellen an den Bauteilen (laut Zeichnungsunterlagen)
a) Die rot gekennzeichneten Ölstellen sind nach jeweils 50
Zählerumdrehungen zu kontrollieren und nach Bedarf zu
ölen.
b) Alle übrigen Ölstellen, die aus den Zeichnungen ersichtlich
sind, sind nach 200 Zählerumdrehungen zu ölen.
c) Befindet sich an den Ölstellen noch Öl, ist nicht zu ölen.
2.3. Reinigen des Kontaktes des Fliehkraftreglers
a) Er ist nach 100-120 Zählerumdrehungen zu reinigen.
b) Gehäuse abnehmen.
c) Den Stromartenstecker am Motor herausziehen.
d) Den Kontakt mit einem in Spiritus getauchten Lappen
reinigen. Bei starker Verschmutzung eine Kontaktfeile
benutzen.
e) Den Kontakt unbedingt ölfrei halten.
f) Anschließend die Drehzahl des Motors bei etwaigen Abweichungen
wieder einregulieren.
2.4. Reinigen des Sicherheitskontaktes des Betriebsartenumschal-
ters und des Kupplungskontaktes des Chiffrators
a) Sie sind nach 100-120 Zählerumdrehungen zu reinigen.
b) Das Gehäuse abnehmen.
c) Die Lochstreifenkassette herausnehmen.
d) Die Stützhülse aufstecken und das Schlüsselgerät hoch-
kippen.
e) Die Bodenplatte entfernen.
f) Die Kontakte mit einem in Spiritus getauchten Leinen-
lappen reinigen.
g) Es ist verboten, Schmirgelleinwand oder eine Feile zu
benutzen.
2.5. Reinigen des Kontaktes für Dauerauslösung Zwischenraum
a) Er ist nach 100-120 Zählerumdrehungen zu reinigen.
2.6. Impulskontakt
Der Impulskontakt schließt und öffnet unter Spannung und
zieht deshalb Funken. Die Kontaktpimpel des Impulskontaktes
sind aus Wolfram und für normale Arbeit muß ein Kontakt-
druck von 150-200 p vorhanden sein. Desgleichen muß die
Kontaktfläche sauber sein. Die in die Schaltung eingebaute
Funkenlöschstrecke verhindert beim Öffnen nicht vollständig
das Auftreten eines Funkens zwischen den Kontakten, des-
halb oxydiert mit der Zeit die Kontaktoberfläche und leitet
schlecht.
Unter solchen Bedingungen kann der Impulskontakt die Ur-
sache für das Fehlen des Zeichenabdruckes sein, weil der
Stromkreis der Elektromagneten unterbrochen ist. Damit eine
einwandfreie Arbeit des Impulskontaktes gewährleistet ist,
ist es notwendig:
a) darauf zu achten, daß der Abstand zwischen den Kon-
takten in der Stoppstellung der Hauptwelle 0,4 mm nicht
überschreitet, da die Vergrößerung des Abstandes zur
Verringerung des Kontaktdruckes führt;
b) daß die Kontaktstellen ölfrei sind;
c) daß die Kontaktoberflächen möglichst parallel zueinan-
der liegen;
d) die Kontakte nach 50 Zählerumdrehungen mit feiner
Schmirgelleinwand und sauberen Putzlappen reinigen.
2.7. Kontakte der Tastatur
Die Kontakte der Tastatur sind aus Silber. Sie schalten nicht
unter Spannung, und deshalb ziehen sie keinen Funken. Die
Schicht von Silberoxyd, die sich im Laufe der Zeit auf den Kon-
takten bildet, verhindert nicht den normalen Stromfluß, der
nur unterbrochen werden kann, wenn die Kontaktoberflächen
durch Öl, Staub usw. verschmutzt sind. Sind saubere Kontakt-
flächen und der nötige Kontaktdruck (40-80 p) vorhanden, so
ist eine einwandfreie Arbeit der Kontakte der Tastatur ge-
währleistet.
Bei Betrieb des Schlüsselgerätes ist es notwendig:
a) nicht zulassen, daß sich Öl und Schmutz auf die Kontakt-
flächen setzt;
b) damit das Schlüsselgerät einwandfrei arbeitet, nach 100
bis 120 Zählerumdrehungen die Kontaktoberflächen rei-
nigen, indem man einen Stoffstreifen (Leinen, Nessel) in
Spiritus taucht und zwischen den Kontaktflächen bei ge-
schlossenen Kontakten durchzieht ;
c) nicht Kontaktfeilen und Sandpapier für die Reinigung
der Silberkontakte verwenden, da es zum schnellen Vers-
chleiß der Kontakte, damit zur Verringerung des Kon-
taktdruckes und letzten Endes zum Ausfall der Kontakt-
gruppe führt.
2.8. Übergangskontaktleisten
Die Kontakte der Übergangskontaktleisten schaffen die elek-
trische Verbindung zwischen den einzelnen Baugruppen. Die
Übergangskontaktleisten bestehen aus festen Kontakten, die in
Kunststoff eingepreßt sind und aus gefederten Kontakten. Die
Kontaktoberflächen sind zur Verhütung einer Oxydation mit
Silber überzogen. Die Kontakte der Übergangskontaktleisten
gewährleisten lange Zeit eine einwandfreie Arbeit. Bei teil-
weisem oder vollständigem Auseinanderbau des Schlüssel-
gerätes ist es notwendig, vor dem Zusammenbau die Kontakte
mit einem in Spiritus getauchten sauberen Lappen zu putzen.
Die Verwendung von Sandpapier zum Reinigen der Kontakte
ist untersagt, da dann der Silberüberzug abgerieben wird.
2.9. Kontaktleisten des Chiffrators und Betriebsartenumschalters
Die Konstruktion dieser Kontakte ist genauso wie die der
Übergangskontaktleisten.
Die Kontaktoberflächen dieser Kontakte werden bei der Ar-
beit auf Grund der gegenseitigen Reibung gereinigt. Die Arbeit
der Kontaktpaare erfolgt, nachdem die reibenden Oberflächen
geschmiert wurden. Es ist notwendig, nach 30-40 Zähler-
umdrehungen den Fettfilm auf den Kontaktleisten zu er-
neuern. Der alte Fettfilm wird durch mit Spiritus getränktem
Mull oder Leinen entfernt. Im Betriebsartenumschalter ist es
notwendig, den Fettfilm einmal innerhalb von 6 Monaten zu
erneuern. Der Fettfilm ist in einer dünnen Schicht (größen-
ordnung 0,05-0,1 mm) gleichmäßig auf den ganzen Kontakt-
oberfläche der Leisten mit den flachen Kontakten aufzutragen.
Als Schmiermittel wird säurefreie technische Vaseline benutzt,
die einen normalen Betrieb im gegebenen Temperaturbereich
von +2°C - + 50°C gewährleistet.
Bemerkung: Es ist verboten, das Schlüsselgerät geöffneten
Kontaktleisten einzuschalten.
2.10. Pflege des Elektromotors SL-369 uA 1
Die Pflege des Elektromotors schließt praktisch die Kontrolle
der Arbeitsfläche des Kollektors und der Kohlebürsten ein. Die
Kontrolle des Zustandes des Kollektors ist regelmäßig nach 80
bis 100 Zählerumdrehungen durchzuführen. Eine Verschmutzte
Kollektoroberfläche ist mit einem in Spiritus angefeuchteten
Leinenlappen zu säubern. Bei starkem Abbrennen des Kollek-
tors ist es zulässig, den Kollektor mit feiner Schmirgelleine-
wand abzureiben und danach mit einem Leinenlappen, der mit
Spiritus getränkt ist, zu säubern. Stellt sich bei der Reinigung
heraus, daß die Oberfläche des Kollektors sehr rau oder stark
eingebrannt ist, so muß der Kollektor in der Werkstatt über-
dreht und zwischen den Lamellen ausgesägt werden. In dem
Maße, wie sich die Bürsten abschleifen, ist es notwendig, die
Kappe mit dem Schlitz, die sich auf den Bürstenhalter befindet,
nachzuziehen. Die Kohlebürsten sind zu erneuern, wenn sie bis
zu einer Restlänge von etwa 6 mm abgenutzt sind. Die Füh-
rungen der Kohlebürsten sind von anhaftendem Kohlenstaub
freizuhalten. In einwandfreiem Zustand des Elektromotors be-
obachtet man schwache Funken an der ablaufenden Kante der
Bürste. Es ist notwendig, den Elektromotor nach 300 Zähler-
umdrehungen auseinanderzunehmen, vollkommen zu reinigen
und die Kugellager neu zu fetten.
2.11. Auswechseln der Kohlebürsten
a) Das Gehäuse abnehmen.
b) Das Deckblech an der Hinterseite des Motors abnehmen.
c) Den Verbindungsstecker Motor-Grundplatte lösen.
d) Die zwei Schrauben, die den Motor im Antriebsteil halten,
lockern damit der Motor gedreht werden kann, um an
die untere Kohlebürste heranzukommen.
e) Das Abdeckblech des Kollektors abnehmen.
f) Die beiden Isoliermuttern der Kohlebürsten abschrauben.
g) Die darunter liegenden Muttern herausschrauben und
die Kohlebürsten herausnehmen.
h) Das Einsetzen in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
i) Nach dem Einbau neuer oder nachgeschliffener Kohlebürsten
den Motor 4-6 Stunden leer laufen lassen.
2.12. Pflege der Elektromagnete
Die Elektromagnete des Druckwerkes und der Elektromagnete
am Locher erfordern nur Ölen der Stangen an der Stelle ihres
Durchganges durch die Buchsen des Joches. Infolge dessen, daß
der Zugang zu den Ölstellen der Elektromagnete auf Grund
ihrer engen Anordnung sehr schwierig ist, ist die Ölung wäh-
rend des vollständigen Auseinanderbauens des Schlüsselgerätes
vorzunehmen.
2.13. Regeln für das Abschmieren
a) Alle Zahnräder werden bei der mittleren und Haupt-
Instandsetzung eingefettet. Das verbrauchte Fett wird mit
einem Pinsel oder einer Bürste, die mit dem Lösungs-
mittel für das verwendete Fett getränkt ist , entfernt. Das
neue Fett wird mit Pinsel oder Bürste dünn aufgetragen.
b) Für das Abschmieren der Kugellager des Schlüsselgerätes
ist Kugellagerfett zu verwenden. Die Kugellager werden
bei der mittleren und Hauptinspektion eingefettet.
Das Auswaschen der Kugellager erfolgt mit Lösungs-
mittel. Nach dem Auswaschen ist es notwendig, sich vom
leichten Gang des Kegellagers zu überzeugen. Das neue
Fett wird mit einem Metall- oder Holzspan in den Käfig
gedrückt, bis dieser zu 2/3 gefüllt ist.
Anmerkung: Das Fetten ist in den vorhandenen Zeich-
nungen nicht angegeben.
c) Es ist nicht ratsam, sehr stark zu ölen. Im allgemeinen
bezieht sich das auf Teile des Schlüsselgerätes, die in
jedem Zyklus arbeiten und während der Arbeit einer
hohen Beschleunigung ausgesetzt sind, z. B. Rollen, die
auf den Nocken laufen, Achsen, die die Bauteile vereini-
gen usw. Ein Überschuß an Öl wird bei den ersten Arb-
beitszyklen des Schlüsselgerätes aus der Schmierstelle
herausgeschleudert und führt zur Verschmutzung des
Schlüsselgerätes mit Öl.
Das Ölen dieser Stellen ist mit der im Werkzeug ent-
haltenen Nadel mit abgeplattetem Ende vorzunehmen,
indem man an die Schmierstelle eine geringe Menge Öl
bringt und den Überschuß mit einem trockenen Lappen
entfernt. Ein Beispiel der Anwendung der Nadel ist in
Abb. 45 gezeigt. Rinnen zum Ölen, die einige Bauteile be-
sitzen, sind mit roter Farbe gekennzeichnet.
In1 weiteren werden die wichtigsten Schmierstellen der
Baugruppen angeführt.
2.14. Schmierung des Druckwerkes
Beim Abschmieren der Bauteile des Druckwerkes ist es not-
wendig, den Wagen abzunehmen. Die wichtigsten Schmier-
stellen sind auf Abb. 42 und 64 angeführt.
2.15. Schmierung des Antriebes
Die Schmierstellen der Bauteile des Antriebes sind auf Abb.
41, 45, 58 und 59 angeführt.
2.16. Schmierung des Transmitters mit Dekombinator
Die Schmierstellen sind auf Abb. 44, 46, 47, 73, 74 und 75 dar-
gestellt. Zum Abschmieren der Schienen des Dekombinators
muß man das Schlüsselgerät kippen. Zum Schmieren der inne-
ren Teile des Transmitters (Hebel, Rollen, Start-Stopp-Kupp-
lung u. a.) ist es notwendig, alle Deckel des Transmitters und
den der linken Seite der Grundplatte abzunehmen.
2.17. Schmierung des Automatikantriebes
Im Automatikantrieb sind alle 40-50 Zählerumdrehungen die
Rollen der Hebel, die auf den Nocken laufen, zu schmieren.
2.18. Schmierung der Teile der Grundplatte und der Tastatur
Die Schmierstellen sind auf Abb. 49 dargestellt.
2.19. Schmierung des Lochers
Die Schmierstellen sind auf Abb. 43 dargestellt.
2.20. Schmierung des Chiffrators
Die Schmierstellen sind auf Abb. 31, 81 und 84 dargestellt.
2.21. Schmierung des Wagens
Die Schmierstellen sind auf Abb. 16 und 18 dargestellt.
Um eine lange, fehlerfreie Arbeit des Schlüsselgerätes zu ga-
rantieren, müssen die mechanischen Bauteile regelmäßig ge-
säubert und die sich reibenden Flächen geölt werden. Es ist
notwendig, das Schlüsselgerät vor Staub zu schützen, da sich
sonst der Verschleiß der sich reibenden Teile erhöht. Alle
Teile des Schlüsselgerätes, die keinen korrosionsfesten Über-
zug besitzen, brüniert oder chemisch geschwärzt wurden,
müssen sich unter einer dünnen Schicht Fett befinden.
3. I n s t a n d h a l t u n g d e s S c h l ü s s e l g e r ä t e s
Zur Instandhaltung des Schlüsselgerätes gehören:
a) Laufende Instandsetzung
b) Mittlere Instandsetzung
Zum Umfang der mittleren Instandsetzung gehören:
Auswechseln schadhafter Teile (Stifte, Rollen, Federn usw.).
Reinigen aller Kugellager, Kontrolle derselben auf Gangbar-
keit. Das Schlüsselgerät ist nur soweit zu demontieren, daß
alle Kugellager zugängig sind.
c) Hauptinstandsetzung
Zum Umfang der Hauptinstandsetzung gehören:
Auswechseln schadhafter Teile (Hebel, Rollen, Kugeln, Federn,
Kontakte usw.).
Reinigen aller Teile des Schlüsselgerätes (Kontakte, Kugellager,
Zahnräder usw.). Das Schlüsselgerät ist soweit zu demontieren,
daß eine gründliche Reinigung erfolgen kann und eine Über-
prüfung aller Teile möglich ist.
Die Zählerumdrehungen, nach denen die Instandsetzungen
durchzuführen sind und Zuständigkeit für diese Instandset-
zungen werden gesondert angewiesen.
| III. Demontage und Montage des Schlüsselgerätes |
| CM-2 |
| Demontage |
1. Allgemeines
In diesem Teil wird der Auseinanderbau des Schlüsselgerätes
in Baugruppen behandelt, mit dem Ziel, den Zugang zu den
mechanischen Bauteilen zu erleichtern, wenn es notwendig ist,
ein Teil zu ersetzen oder eine Störung zu beseitigen.
Das völlige Auseinandernehmen der Baugruppen erfordert
das Hinzuziehen eines qualifizierten Mechanikers und wird bei
Abwesenheit eines solchen nicht empfohlen.
Alle Baugruppen können in einer bestimmten Reihenfolge von
dem Schlüsselgerät entfernt werden.
Es wird empfohlen, den vollständigen Auseinanderbau des
Schlüsselgerätes in der angeführten Reihenfolge vorzunehmen:
a) Gehäuse
b) Wagen
c) Stromversorgung
d) Chiffrator
e) Tastatur
f) Transmitter mit Dekombinator
g) Locher
h) Automatikantrieb
i) Antrieb
j) Druckwerk
k) Filter
Falls es notwendig ist, können die Tastatur, der Locher, die
Stromversorgung und der Filter vom Schlüsselgerät abgenom-
men werden, ohne daß andere Baugruppen, außer dem Ge-
häuse, das in jedem Falle abgenommen werden muß, entfernt
werden müssen. Der Wagen kann ohne Abnehmen des Gehäu-
ses entfernt werden.
2. Gehäuse
Den Wagen nach links schieben. Den vorderen, hinteren und
rechten Deckel des Gehäuses öffnen. Den Wagen in das so ge-
bildete Fenster des Gehäuses stellen. Die zwei Kordelschrau-
ben, die rechts und links das Gehäuse an der Grundplatte be-
festigen, lösen und das Gehäuse von der Grundplatte heben.
3. Wagen
Den Riegel, der in die linke Seite der Grundplatte des Wagens
eingreift, zurückziehen und indem man den Wagen an den
Drehknöpfen der Walze anfaßt, hochheben bis die Führungs-
bolzen des Wagens aus der Führung des Druckwerkes heraus-
kommen. Beim Abnehmen des Wagens ohne vorheriges Ent-
fernen des Gehäuses ist der vordere und hintere Deckel des
Gehäuses zu öffnen, und dann den Wagen, wie oben be-
schrieben, abnehmen.
3.1. Ausbau der Gummiwalze (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Den Drehknopf (32) abschrauben.
c) Die 3 Gewindestifte links neben dem Rastrad (55) lösen.
d) Die Achse mit dem Drehknopf (1) nach rechts heraus-
ziehen.
e) Die Gummiwalze abnehmen.
3.2. Ausbau der Spiralfeder (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Den beweglichen Wagenteil nach links schieben.
c) Das Zahnrad (9) abschrauben und abnehmen. Beim Ab-
nehmen des Zahnrades (9) die Federtrommel an den
Stiften (5) festhalten.
d) Die Spiralfeder langsam entspannen.
e) Die 3 Halteschrauben der Federtrommel (6) lösen und die
Trommel mit Führungsbolzen abnehmen.
f) Die Sicherungsscheibe der Federtrommel abnehmen.
g) Den Trommeldeckel abnehmen.
h) Die Spiralfeder herausnehmen.
Anmerkung: Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
Die Spiralfeder wird durch 3-4 volle Um-
drehungen aufgezogen.
Das Zahnrad (9) wird mit seinen Sperringen
bis an den linken Anschlag gedreht und
dann eine viertel Umdrehung zurückge-
dreht. Es ist darauf zu achten, daß beim
Einbau des Zahnrades (9) der bewegliche
Wagenteil immer in der linken Stellung
steht
3.3. Abnehmen des Wagenoberteils
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Die Papierführung und den Anschlagklotz abschrauben.
c) Die hinteren Hebel außer Eingriff bringen und das Wa-
genoberteil nach links herausziehen.
Anmerkung: Beim Zusammenbau ist darauf zu achten,
daß die Rollenkäfige nicht rechts oder links
aus dem Wagenunterteil herauslaufen
können.
4. Stromversorgung
Die 4 unverlierbaren Schrauben herausdrehen und ohne zu
verkanten, damit die Messer der Messerleiste nicht beschädigt
werden, die Stromversorgung entlang den zwei Führungs-
bolzen von der Grundplatte abheben.
5. Chiffrator (Abb. 48
Für das Abnehmen des Chiffrators ist notwendig:
a) Das Gehäuse und die Stromversorgung abnehmen.
b) Den Betriebsartenumschalter auf D
stellen.
c) Die Schraube (3) (M 2,6x6) lockern.
d) Die Leiste (2) lockern und nach rechts schieben.
e) Die Zugstange (1) aus dem Hebel (4) aushaken.
f) Die 5 unverlierbaren Schrauben M 5 herausdrehen.
g) Vorsichtig, indem man den vorderen Teil des Chiffrators
bis an die Streifenführung des Dekombinators hebt, die
Baugruppe zu sich zurückführen, sie außer Eingriff mit
dem Antrieb bringen, den Hebel (6), Abb. 29, aus der Öff-
nung der Grundplatte herausziehen und indem man fort-
setzt den vorderen Teil zu heben, die Grundplatte mit der
Übergangskontaktleiste unter der Auslöseachse des
Lochers herausziehen.
h) Den Chiffrator auf schon bereitgelegte Holzleisten (20x
30x150) legen. Sind diese nicht vorhanden, lege man den
Chiffrator mit der vorderen Platte nach unten auf den
Tisch.
5.1. Abbau des Antriebes des Chiffrators
a) Den Chiffrator ausbauen.
b) Den Kupplungskontakt abschrauben.
c) Die Halterungsschelle des Kabelbaumes abschrauben.
d) Die 4 Befestigungsschrauben des Antriebes lösen und den
Antrieb abnehmen.
Anmerkung: Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
Es ist darauf zu achten, daß die Markierun-
gen der Zahnräder übereinstimmen und der
Kupplungskontakt nicht beschädigt wird.
5.2. Abbau des Kommutators (Abb. 81)
a) Den Chiffratordeckel abnehmen.
b) Die Feststellschraube (17) lockern.
c) Mit dem Exzenter (16) die Schiene (11) nach links bringen.
d) Den Nocken (13) auf Minimum stellen.
e) Die 6 Befestigungsschrauben lösen und den Kommutator
vorsichtig nach vorn abklappen.
Anmerkung: Beim Zusammenbau darauf achten, daß der
Bolzen (12) sich in der Stellung befindet,
wie auf der Abbildung 81 gezeigt wird.
Diese Stellung wird erreicht, indem man den
großen Federhaken vor den beiden Muttern
in den Bolzen (12) einhängt.
5.3. Ausbau der Abfühleinrichtung des Chiffrators
a) Den Chiffrator ausbauen.
b) Den Antrieb des Chiffrators abbauen.
c) Den Kommutator abbauen.
d) Die 4 Befestigungsschrauben lösen und die Abfühleinrich-
tung von der Grundplatte des Chiffrators abnehmen.
Anmerkung: Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrt er
Reihenfolge. Darauf achten, daß die Mar-
kierungen der Zahnräder übereinstimmen.
5.4. Auswechseln der Abfühlstifte
a) Den Chiffrator ausbauen.
b) Die Abfühleinrichtung des Chiffrators ausbauen.
c) Die Federn (Abb. 32/23 und 34) des jeweiligen Abfühl-
Hebels aushängen.
d) Den Hebel (Abb. 33/39) ausbauen.
e) Das große Schaltrad (Abb. 30/3) abbauen.
f) Die 4 Schrauben des Quersteges, der die Abfühlhebel
unten begrenzt, lockern.
g) Die linke und rechte vordere Schraube des Quersteges -
von der Stromversorgung aus gesehen - herausschrauben.
h) Die beiden Federn aus dem Quersteg aushängen.
i) Den Quersteg nach unten klappen.
j) Den kleinen Haltebügel am Quersteg abschrauben.
k) Den Quersteg wieder nach oben klappen.
l) Den Abfühlstift kurz anheben und nach vorn heraus-
ziehen.
6. Tastatur (Abb. 2)
Für das Abnehmen der Tastatur ist notwendig:
a) Den Papierabfallkasten entleeren (wie in allen Fällen,
wenn das Schlüsselgerät gekippt werden muß).
b) Auf die Führungsbuchse der Stange des Druckbügels die
Stützhülse setzen.
c) Das Schlüsselgerät hochkippen, die 7 Schrauben M 3x6
lösen und die Bodenplatte abnehmen.
d) Die 4 Schrauben M 3x6 lösen und die kleine Bodenplatte
abnehmen.
e) Die Lochstreifenkassette herausziehen.
f) Die Kontermuttern M 6 der Anschlagschrauben des
Tastaturschutzes lösen.
g) Die 4 Schrauben M 4x10 herausschrauben und den Tasta-
turschutz abnehmen.
h) Die Schraube an der Zugstange (80) herausdrehen, das
Gabelblech abnehmen und den Finger, der die Zugstange
mit dem Hebel (81) verbindet, herausziehen.
i) Die linken 2 Schrauben (M 2,6x4) und die rechte Ansatz-
schraube, die die Zugstange (64) hält, herausdrehen.
j) Die Schraube (16) (Abb. 49) (M 2,6x5) herausdrehen.
k) Die Zugstange (90) vom Winkelhebel(91) abschrauben.
1) Die 2 Schrauben M 3 x 8 der Führungsschiene der Loch-
streifenkassette herausdrehen und die Führungsschiene
abnehmen.
m) Die Feder (19) ,Abb. 49, aushängen.
n) Die Zugstange (24), Abb. 49, abschrauben.
o) Den Hebel (105), Abb. 2, abschrauben.
p) Die 5 Schrauben M 4x12 herausdrehen und vorsichtig,
ohne die Stifte zu beschädigen, die Tastatur des Schlüssel-
gerätes abnehmen.
6.1. Ausbau eines Tastenhebels (Abb. 2)
a) Die Tastatur ausbauen.
b) Die Anschlagleiste (78) abnehmen.
c) Die 3 Schrauben, die die Welle (61) arretieren, lösen und
die Welle (61) so drehen, daß die abgeflachte Seite vorn ist.
d) Die Zugfeder (56) aushängen und den Tastenhebel ab-
nehmen.
Anmerkung: Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge. Beim Einbau des Tastenhebels ist da-
rauf zu achten, daß mit dem Kunststoff-
messer des Gleitstückes (60) die Kontakte
nicht verbogen werden.
7. Transmitter mit Dekombinator
Für das Abnehmen der Baugruppe ist notwendig:
a) Die Tastatur ausbauen.
b) Die 2 Schrauben der Streifenführung des Dekombinators
lösen und diese abnehmen.
c) Die 5 Schrauben M 4x12 herausdrehen. Vorsichtig von
den Stiften die Baugruppe abheben und von der Grund-
platte abnehmen.
7.1. Ausbau der Start-Stopp-Kupplung (Abb. 19)
a) Den Transmitter mit Dekombinator ausbauen.
b) Die Feder (27) aushängen.
c) Den Nocken (23) abbauen.
d) Die 4 Schrauben des hinteren Gehäuseteils herausschrau-
ben und dieses abnehmen.
e) Den Nocken (30) abziehen.
f) Den getriebenen Teil der Kupplung (32) abziehen.
7.2. Auswechseln der Abfühlstifte (Abb. 73)
a) Den Transmitterdeckel abschrauben.
b) Die vordere und untere Deckplatte des Transmitters ab-
schrauben.
c) Den Hebel (Abb. 19/54) abschrauben.
d) Die Halterung mit dem AUS- und EIN-Knopf
abbauen.
e) Das linke Führungsblech der Abfühlstifte (von unten
gesehen) abschrauben.
f) Die beiden Schrauben (5) lösen.
g) Den Festhaltebügel (6) abschrauben.
h) Die Federn (9) und (10) aushängen und die Abfühlstifte
(7) vorsichtig nach unten herausziehen.
i) Die Einstellung der Höhe der Abfühlstifte (7) erfolgt mit-
tels der Festhaltebügel (6).
j) Der Abstand der Abfühlstifte (7) zur Streifenführung
beträgt 0,l-0,2 mm.
Anmerkung: Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
Sollte das Einhängen der Federn(9) und (10)
unmöglich sein, muß der Dekombinator ab-
gebaut werden.
7.3. Abbau des Dekombinators vom Transmitter (Abb. 75)
a) Den Transmitter mit Dekombinator ausbauen.
b) Den Transmitterdeckel abschrauben.
c) Die vordere Deckplatte abschrauben.
d) Die Feder (7) aushängen.
e) Die Schraube (2) und den Gewindestift vom Klemmhebel
(1) lockern.
f) Die 4 Befestigungsschrauben des Dekombinators an1
Transmitter abschrauben.
g) Den Hebel (5) nach vorn drücken und den Dekombinator
abnehmen.
8. Locher
Zum Abnehmen des Lochers ist notwendig:
a) Lösen der elektrischen Verbindung des Elektromagneten
WR.
b) Die zwei Schrauben M 2,6x8 der Leiste über den Zug-
stangen (41), Abb. 20, lösen und die Leiste abnehmen.
c) Herausdrehen der 4 Schrauben M 4x12, mit denen der
Locher an der Grundplatte befestigt ist. Vorsichtig, ohne
die Stifte zu beschädigen, die Baugruppe anheben und
aus der Streifenführung herausziehen.
d) Die richtige Stellung der Hebel des Lochers zu den Nocken
der linken Seite des Druckwerkes beachten.
8.1. Auswechseln der Stanzstempel (Abb. 20)
a) Den Locher ausbauen.
b) Die Halterung der Zugstangen (41) und die Auflage-
stücke (27) abbauen.
c) Die Stellung der vorderen Papierführung anzeichnen und
dann abschrauben.
d) Die beiden Exzenter für die Rückführung der Stanzstem-
pel abschrauben;
e) Den Führungskamm (32) abschrauben.
f) Die Auflagestücke (33, 34, 35 und 36) ausbauen.
g) Den Papierandruckhebel ausbauen.
h) Die Stellung der hinteren Papierführung anzeichnen und
abbauen.
i) Die Achsschraube vom Hebel (Abb. 21/45) abschrauben
(dabei auf Unterlegscheibe achten).
j) Die 4 Halteschrauben der Stanzmatrize (16) lösen und die
Stanzmatrize nach vorn herausnehmen.
k) Die Stanzstempel ausbauen und auswechseln.
1) Der Zusammenbau erfolgt- in umgekehrter Reihenfolge.
m) Nach dem Zusammenbau den Locher neu einstellen.
9. Automatikantrieb
Zum Abnehmen des Automatikantriebes ist notwendig:
a) Den Locher ausbauen.
b) Herausdrehen der zwei Schrauben und Abnehmen der
Halterung des Kontaktes (I), Abb. 22.
c) Herausdrehen der 4 Schrauben M 4x12, mit denen der
Automatikantrieb an der Grundplatte befestigt ist.
d) Vorsichtig, ohne die Stifte zu beschädigen, den Automa-
tikantrieb anheben, das Zahnrad ausrasten, welches in
das Druckwerk eingreift, und aus der Öffnung der Grund-
platte herausführen.
9.1. Ausbau der Start-Stopp-Kupplung (Abb. 22)
a) Den Automatikantrieb ausbauen.
b) Die beiden Lagerschalen abschrauben.
c) Die Schraube, die das Kugellager auf der, Welle hält, ab-
schrauben und das Kugellager abziehen.
d) Die Nocken (27) und (28) abbauen.
e) Die Kupplungsschale vorsichtig abnehmen. Beim Abneh-
men auf die Kugel, die Rolle und die Zugfeder (die aus-
gehangen werden muß), die sich im inneren der Kupplung
befinden, achten.
Anmerkung: Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
Es ist darauf zu achten, daß die Kupplung
richtig zusammengebaut wird und die Mar-
kierungen der Zahnräder übereinstimmen.
10. Antrieb
Zum Abnehmen des Antriebes ist notwendig:
a) Stromversorgung und Chiffrator ausbauen.
b) Lösen der zwei Schrauben M 3x10 der rechten Halterung
und der zwei Schrauben M 3x10 der linken Halterung
der Auslöseachse des Lochers.
c) Aushängen der Feder vom Einschalthebel des Lochers.
d) Abnehmen der Halterung mit der Auslöseachse des
Lochers von den Stiften.
e) Aushängen der Zugstange (15), Abb. 58, die den Antrieb
mit dem Druckwerk verbindet.
f) Den Verbindungsstecker Motor-Grundplatte heraus-
ziehen.
g) Herausdrehen der drei Schrauben M 5x12, mit denen
der Antrieb an der Grundplatte befestigt ist. Vorsichtig,
ohne die Stifte zu beschädigen, die Baugruppe anheben
und aus der Grundplatte herausziehen.
10.1. Ausbau und Auseinandernehmen der Hauptwelle (Abb. 14)
a) Die Stromversorgung ausbauen.
b) Der Chiffrator ausbauen.
c) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
d) Die beiden Lagerschalen abschrauben.
e) Die Hauptwelle abnehmen.
f) Die Nocken (14) und (13) ausbauen.
g) Das Kugellager abziehen.
h) Das Zahnrad (15) mit dem Nocken (11) ausbauen.
i) Den getriebenen Teil der Kupplung abnehmen.
10.2. Ausbau und Auseinandernehmen des Motors
a) Das hintere Deckblech an der Grundplatte abschrauben.
b) Den Verbindungsstecker Motor-Grundplatte heraus-
ziehen.
c) Die beiden Befestigungsschrauben des Motors am Antrieb
herausschrauben und den Motor vorsichtig herausziehen.
d) Den Fliehkraftregler ausbauen.
e) Die Kohlebürsten herausnehmen.
f) Die Lagerschalen und den Stator markieren.
g) Die Kupplung abschrauben und abziehen.
h) Die beiden Gehäusebolzen herausschrauben.
i) Den Anker vorsichtig herausziehen.
Anmerkung: Bei Abnahme der Lagerschale (Kollektor-
seite) sind die Anschlußdrähte der Stator-
wicklung vorher zu lösen.
10.3. Ausbau des Auslösehebels der Hauptwelle (Abb. 53)
a) Die Hauptwelle ausbauen.
b) Den Impulskontakt abschrauben.
c) Die beiden Halteschrauben der Achse des Hebels (8) lösen.
d) Den Begrenzungsring der Achse des Hebels (8) abbauen.
e) Die Feder vom Hebel (8) aushängen.
f) Die Achse in Richtung des Impulskontaktes heraus-
drücken.
g) Den Hebel (8) abnehmen.
10.4. Ausbau der Wagenrücklaufwelle (Abb. 13)
a) Den Steuerhebel (37) der Zahnkupplung abschrauben und
seitlich abnehmen (dabei auf die Laufrolle achten).
b) Die 2 Schrauben der hinteren Lagerschale lösen und die
Lagerschale abnehmen.
c) Die Welle aus dem anderen Lager herausziehen.
11. Druckwerk
Zum Abnehmen des Druckwerkes ist notwendig:
a) Stromversorgung, Chiffrator, Locher, Automatikantrieb
und Antrieb abbauen.
b) Hebel (2), Abb. 52, entfernen.
c) Herausdrehen der 5 Schrauben M 5x12, mit denen das
Druckwerk an der Grundplatte befestigt ist. Vorsichtig,
ohne die Stifte zu beschädigen, die Baugruppe abnehmen.
11.1. Ausbau eines Typenhebel (Abb. 10)
a) Das Farbband abnehmen.
b) Die beiden Halteschrauben der Achse (9) lösen.
c) Die Achse (9) bis zum jeweiligen Typenhebel heraus-
drücken.
d) Den Typenhebel anheben und vom Stoßhebel (11) abnehmen.
11.2. Ausbau eines Stoßhebels (Abb. 10)
a) Das Druckwerk ausbauen.
b) Den entsprechenden Typenhebel ausbauen.
c) Die Feder (15) des auszubauenden Stoßhebels (11) aus-
hängen.
d) Den halbrunden Federbügel am Segment (10), der die
Stoßhebel (11) hält, abbauen.
e) Den entsprechenden Stoßhebel (1 1) ausbauen.
Anmerkung: Die mittleren Stoßhebel (P 1) können ohne Ab-
nahme des Federbügels ausgebaut werden.
11.3. Ausbau eines Freigabehebels (Abb. 10)
a) Das Druckwerk ausbauen.
b) Die Schrauben der Magnetanschlußplatte lösen.
c) Die Feder (13) des jeweiligen Freigabehebels aushängen.
d) Den entsprechenden Elektromagneten ausbauen.
e) Den Freigabehebel (14) von der Achse abziehen.
Anmerkung: Beide linke und der rechte Freigabehebel
(14) können nur ausgebaut werden, wenn
der Kombinator abgenommen ist.
12. Filter
a) Herausdrehen der 6 Schrauben M 3x6, mit denen die
hintere Platte an der Grundplatte befestigt ist und Ab-
nehmen derselben.
b) Herausdrehen der 3 Schrauben M 4x10, mit denen der
Filter an der Grundplatte befestigt ist und, indem die
Steckerverbindung gelöst wird, den Filter abnehmen.
M o n t a g e
1. Einbau des Druckwerkes
Der Zusammenbau beginnt mit der Montage des Druckwerkes.
Das Druckwerk wird mit seinen Führungsstiften in die Füh-
rung der Grundplatte eingesetzt und muß glatt auf der Grund-
platte aufsitzen. Danach wird es mit den 5 Schrauben M 5x12
befestigt. Den Hebel (2), Abb. 52, anschrauben.
2. Einbau des Antriebes
Beim Aufsetzen des Antriebes ist darauf zu achten, daß die
Führungsstifte am Gehäuse des Antriebes genau in die vor-
gesehenen Löcher in der Grundplatte eingesetzt werden. Die
Rolle des Druckhebels im Druckwerk muß sich an den Druck-
exzenter der Hauptwelle legen, der Finger des Auslösehebels
aber muß in den Zwischenhebel in der Grundplatte eingreifen.
Der Finger des unteren Hebels der vertikalen Achse der Sperr-
vorrichtung am Antrieb muß in die Gabel des zweiarmigen
Hebels (26), Abb. 49, eingreifen. In dieser Lage wird der An-
trieb mit den drei Schrauben M 5x12 befestigt.
Einhängen der Zugstange (15), Abb. #58, die den Antrieb mit
dem Druckwerk verbindet.
Die elektrische Verbindung Motor-Grundplatte wiederher-
stellen.
3. Einbau des Automatikantriebes
Beim Aufsetzen des Automatikantriebes ist es notwendig, das
Kegelrad des Automatikantriebes und des Druckwerkes mit
ihren Marken aufeinander einzustellen. Au1 jedem dieser Ke-
gelräder sind Markierungen vorhanden. Vor dem Befestigen
muß in die Kardangabel des Automatikantriebes und in die
Zwischenwelle des Antriebes die Kardanwelle gesteckt werden.
Nur, nachdem man sich von der richtigen Stellung der Kegel-
räder zueinander überzeugt hat, darf der Automatikantrieb mit
den 4 Schrauben M 4x12 befestigt werden. Danach wird die
Halterung mit der Kontaktgruppe befestigt. Dabei ist das Ge-
lenk der Auslösevorrichtung des Automatikantriebes mit dem
Gleitstück, das vom Streifentransportknopf (Dauer) arbeitet, zu
kontrollieren, Dazu genügt es, den Streifentransportknopf zu
drücken, um sich davon zu überzeugen, daß die Start-Stopp-
Kupplung des Lochers eingerückt wird (wenn die Stromzu-
führung schon montiert ist).
Wach Einbau des Automatikantriebes muß die Auslöseachse
für die Locherkupplung eingebaut werden. Die Achse mit den
Halterungen wird mit den Stiften in die Führung der Grund-
platte eingesetzt. Die Halterungen werden wie folgt befestigt:
die linke mit zwei Schrauben M 3x8, die rechte mit zwei
Schrauben M 3x10.
4. Einbau des Lochers (Abb. 20)
Beim Einbau des Lochers ist es notwendig, das Ende der Strei-
fenführung, das aus der Grundplatte herausragt, in die Strei-
fenführung des Lochers zu schieben und bei Übereinstimmung
der Führungsstifte des Lochers mit den Führungen der Grund-
platte den Locher bis zum festen Anliegen an die Grundplatte
herunterdrücken. Die richtige Stellung der Hebel des Lochers
in Bezug auf die Nocken des linken Ständers des Druckwerkes
überprüfen und den Locher mit den vier Schrauben M 4x12
befestigen.
Danach die Zugstangen (41) der Auflagestücke des Lochers
mit den Hebeln (42) der Wählschienen des Druckwerkes ver-
binden und die Leiste, die eine sichere Verbindung der Zug-
stangen mit den Hebeln gewährleistet, anschrauben. Der Ab-
stand zwischen den Zugstangen und der Leiste soll 0,1-0,2 mm
betragen. Die Leiste wird mit zwei Schrauben M 2,6x8 be-
festigt. Die Enden der Wicklung des Elektromagneten WR
sind an die Klemmen der Klemmleiste anzuschließen.
5. Einbau des Transmitters mit Dekombinator
Beim Einbau des Transmitters muß das Schlüsselgerät in ge-
kippter Stellung bleiben. In die Kardangabel des Automatik-
antriebes muß die Kardanwelle (S), Abb. 49, eingeführt wer-
den. Danach vorsichtig den Transmitter mit Dekombinator von
oben in die Öffnung der Grundplatte führen, wobei das zweite
Ende der Kardanwelle (8) in die Kardangabel des Transmitters
eingreifen muß.
Den Transmitter bis zum festen Anliegen an die Grundplatte
herunterdrücken. Die Stifte des Transmitters mit Dekombi-
nator müssen in ihre Führungen gehen; danach kann die Bau-
gruppe mit den 5 Schrauben M 4x12 befestigt werden.
6. Einbau der Tastatur
Beim Einbau der Tastatur verbleibt das Schlüsselgerät in ge-
kippter Stellung. Der Einbau der Baugruppe geschieht folgen-
dermaßen:
a) Den Betriebsartenumschalter auf K
stellen.
b) Die Achse des Betriebsartenumschalters in der Tastatur
in eine solche Stellung bringen, daß die Markierungen
der Zahnräder (20) und (21), Abb. 49, zusammenfallen.
c) Den Hebel (81), Abb. 2, in die Aussparung des Fußes des
Hebels (80) führen.
d) Die Tastatur einschieben und mit den Schrauben be-
festigen.
e) Den Finger einsetzen und mit einer Schraube das Gabel-
blech am Fuß der Zugstange befestigen.
f) Die Zugstangen (15) und (17) miteinander verbinden, in-
dem sie mit der Schraube (16) M 2,6x5, Abb. 49, befestigt
werden.
g) Die Zugstange (10) mit dem Zwischenhebel des Trans-
mitters verbinden und mit den zwei Schrauben M 2,6x4
befestigen.
h) Die Zugstange (90) mit dem Winkelhebel (91), Abb. 2, ver-
binden.
i) Die Zugstange (24) einsetzen, mit der Schraube (25) und
der Kontermutter M 2,6 befestigen.
j) Die Führungsschiene der Lochstreifenkassette einbauen
und mit den zwei Schrauben M 3x8 befestigen.
k) Die Feder (19) einhängen.
l) Den Tastaturschutz aufsetzen und mit den vier Schrau-
ben M 4x10 befestigen.
m) Einschrauben der zwei Schrauben (14), bis sie die Grund-
platte der Tastatur berühren. Sicherung durch Konter-
muttern.
n) Das Schlüsselgerät in Arbeitsstellung bringen.
7. Einbau des Chiffrators
Beim Einbau des Chiffrators muß der Betriebsartenumschalter
auf D
stehen.
Nachdem dies überprüft wurde, kann der Chiffrator eingebaut
werden. Beim Einbau ist notwendig:
a) Das Übereinanderstehen der Markierung an dem Zahnrad
des Chiffrators und der Hauptwelle des Schlüsselgerätes
(Abb. 54).
b) Der richtige Eingriff des Zwischenrades in der Grund-
platte des Chiffrators in die Zahnstange des Betriebs-
artenumschalters in der Grundplatte des Schlüsselgerätes.
Bei richtigem Eingriff der Zähne und befestigtem Chiffra-
tor müssen die Stellungen des Betriebsartenumschalters
und die Markierung an den Zahnrädern übereinstimmen.
c) Zusammentreffen der gefederten Kontakte der Über-
gangskontaktleiste der Grundplatte mit den Kontakten
der Übergangskontaktleiste am Chiffrator. Dieses Zu-
sammentreffen wird gewährleistet, wenn der Chiffrator
bei der Montage auf die Grundplatte bis an die An-
schläge geführt wird, die mit Schrauben befestigt und mit
der Grundplatte des Schlüsselgerätes verstiftet sind. Es
wird empfohlen, die Anschläge nicht abzunehmen.
d) Das Einhaken der Zugstange (1) in den Finger des Hebels
(4), Abb. 48.
e) Nachdem der richtige Einbau überprüft wurde, ist die
Baugruppe mit den 5 unverlierbaren Schrauben M 5 zu
befestigen.
8. Einbau der Stromversorgung
Die Stromversorgung auf die 2 Führungsbolzen der Grund-
platte setzen und sie mit den 4 Schrauben befestigen.
9. Einsetzen des Wagens
Den Wagen in beide Hände nehmen, die Führungsbolzen des
Wagens in die Führungsbuchsen des Ständers des Druckwerkes
einführen und langsam herunterlassen. Das Eingreifen der
Bolzen (5) in die Öffnungen der Räder (4), Abb. 16, des rech-
ten Ständers des Druckwerkes ist zu gewährleisten. Gleich-
zeitig muß der obere Arm des Hebels (2), Abb. 52, in die Aus-
sparung der Leiste (10), Abb. 18, des Wagens einfallen.
Bei allen Einstellungen muß der Betriebsartenumschalter aufKstehen. 1.1. Einstellung des Anfangsdruckes der Tastenhebel (Abb. 2) a) Die Tastatur ausbauen. b) Die Zugfeder (56) aushängen. c) Durch Ein- oder Ausschrauben der Zugfeder (56) wird ein Tastendruck von 120-150 p eingestellt. d) Der Unterschied des Tastendruckes zwischen den ein- zelnen Tastenhebeln darf nicht mehr als 60 p betragen. 1.2. Einstellung der Rollensperre (Abb. 5) a) Die beiden Stellschrauben (1) lösen. b) Die TastePdrücken. c) Mit den beiden Stellschrauben (1) die Rollen (7) so ein- stellen, daß die TastePleicht ein- und ausfallen kann. d) Es ist darauf zu achten, daß sich jeweils nur eine Taste drücken läßt. e) Die Stellschrauben (1) kontern. 1.3. Einstellung des Auslöserahmens (Abb. 56) a) Die Kontermutter (2) und die Stellschraube (1) lösen. b) 2 Tasten gleichmäßig nach unten drücken. c) Dann den Abstand zwischen den beiden gedrückten Tasten und dem Auslöserahmen (4) mit Hilfe der Stellschraube (1) auf 0,3-0,4 mm einstellen. d) Die Stellschraube (1) kontern. 1.4. Einstellung des Auslösehebels (Abb. 56) 1.4.1. a) Die Kontermutter (7) lockern. b) Mit dem Exzenter (8) durch Rechts- oder Linksbewegung des Hebels (5) den erforderlichen Spielraum von 0,l-0,2 Millimeter zwischen den Hebeln (5) und (9) einstellen. c) Die Kontermutter (7) festziehen. 1.4.2. Reicht die Einstellung im vorhergehenden Punkt nicht aus, wird nachfolgende Einstellung vorgenommen: a) Den Exzenter (8) in Mittelstellung bringen. b) Den Auslöserahmen (4) an der Stellschraube (1) anliegen lassen. c) Die Klemmschraube an der Lasche (6) lockern. d) Die Lasche (6) so drehen, da3 der Hebel (5) an dem He- bel (9) anliegt. e) Die Klemmschraube der Lasche (6) festziehen. f) Mit dem Exzenter (8) die Einstellung, wie oben beschrie- ben, zu Ende führen. 1.5. Einstellung des U-Rahmen (Abb. 55) a) Die Bodenplatte und den Tastaturschutz abnehmen. b) Die beiden Kontermuttern (4) und (10) lösen. c) Die Spannstange (9) so verstellen, bis der U-Rahmen (25) parallel zur Tastaturplatte steht. d) Die Kontermuttern (4) und (10) festziehen. 1.6. Einstellung des U-Rahmen in der Ausgangslage (Abb. 55) a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Das Schlüsselgerät in Stoppstellung bringen. c) Den Dreizackhebel (Übertragungshebel) am Antrieb in Mittelstellung bringen. d) Eine beliebige Taste, außer Wagenrücklauf, drücken. e) Die Hauptwelle um 15-20 Grad weiterdrehen. f) Die Auslöseeinrichtung (20) mit der Hand aufziehen. g) Nachprüfen, ob der Abstand zwischen der Nase des Gleit- stückes (26) und dem U-Rahmen (25) 0,2-0,3 mm beträgt. h) Muß der Abstand nachgestellt werden, so, werden die beiden Schrauben (13) gelockert und mit dem Exzenter (14) wird der notwendige Abstand eingestellt. 1.7. Einstellung des Hubes des U-Rahmen (Abb. 55) a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Das Schlüsselgerät in Stoppstellung bringen. c) Die TastePdrücken. d) Die Schraube der Exzenterrolle (24) lösen und den Exzen- ter so einstellen, daß das Gleitstück ein Spiel in der Längs- richtung zum U-Rahmen von 0,5-0,8 mm hat. e) Die Schraube der Exzenterrolle (24) festziehen. 1.8. Einstellung des Hebels (20) (Abb. 55) a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Die TastePdrücken. c) Den Motor mit der Hand so weit drehen, bis der Hebel (20) den höchsten Punkt erreicht hat. d) Zwischen dem Hebel (20) und der Auflage des Hebels (18) muß der Abstand 0,2-0,3 mm betragen. e) Dieser Abstand wird durch die Spannstange (Abb. 2/80) eingestellt. 1.9. Einstellung der I. Sperrschiene a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Die Klemmschraube (Abb. 59/6) lösen und den Dreizack- hebe1 (Übertragungshebel) in die erste Stellung bringen. c) Die I. Sperrschiene nach links schieben. d) Die Zugstange (Abb. 60/7) nach oben drücken. e) Die Klemmschraube (Abb. 59/6) festziehen. 1.10. Einstellung der Zwischenraumtaste (Abb. 2) a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Den Tastaturschutz abnehmen. c) Die Schraube am Hebel (31) lösen. d) Mit dem Exzenter am Hebel (31) den Tastenhebel (54) so einstellen, daß er beim Betätigen der Zwischenraum- taste bis zum Anschlag gedrückt wird. e) Die Schraube am Hebel (31) festziehen. 1.11. Einstellung der Taste Wagenrücklauf/Zeilenvorschub (Abb. 60) a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Den Dreizackhebel (Übertragungshebel) in die erste Stel- lung bringen. c) Die beiden Kontermuttern (4) der Zugstange (3) lösen. d) Die Zugstange (3) so einstellen, daß zwischen dem Zahn (9) und dem Haken der Zugstange (3) ein Zwischenraum von 0,2-0,3 mm entsteht. e) Die beiden Kontermuttern (4) festziehen. f) Die Schrauben der Führung (2) lösen. g) Die Führung (2) so einstellen, daß beim Betätigen der Wagenrücklauftaste der Haken der Zugstange (3) voll- kommen freigegeben wird. h) Die Schrauben der Führung (2) festziehen. 1.12. Einstellung der II. Sperrschiene (Abb. 2) a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Den Tastaturschutz abnehmen. c) Den Betriebsartenumschalter aufDstellen. d) Die Feststellschraube am Hebel (8) lösen. e) Mit dem Exzenter des Hebels (8) die Sperrschiene (9) so einstellen, daß zwischen dem Zahn der Sperrschiene (9) und der Nase eines gedrückten Tastenhebels der Abstand 0,2-0,3 mm beträgt. f) Die Feststellschraube am Hebel (8) festziehen. 1.13. Einstellung der Zugstange, die den Transmitter bei Erscheinen der 32. Kombination im Chiffrator abschaltet (Abb. 55) a) Die Bodenplatte abnehmen. b) Einen ungelochten Streifen in den Chiffrator einlegen. c) Den Betriebsartenumschalter aufDstellen. d) Die TastePdrücken. e) Den Motor mit der Hand drehen, bis die Tastatur blok- kiert. f) Die Feststellschraube (6) lösen. g) Mit dem Exzenter (7) die Zugstange (12) so einstellen, daß die Sperrklinke (Abb. 19/3) den gedrücktenEIN- Knopffreigibt. Die Sperrklinke (Abb. 19/3) muß 0,4 bis 0,5 mm über die Kerbe desEIN-Knopfesgehoben werden. h) Die Feststellschraube (6) festziehen. 2. Einstellung des Lochers 2.1. Einstellung des Hubes der Stanzstempel (Abb. 20) a) Die Schrauben der Exzentermuttern des Bügels (17) lösen und den Bügel (17) in die unterste Stellung bringen. b) Buchstabenumschaltung (+++++) stanzen. c) Den Bügel (17) so einstellen, daß in Stoppstellung des Schlüsselgerätes der Lochstreifen frei durchlaufen kann. d) Die Exzentermuttern des Bügels (17) festziehen. e) Überprüfen, ob alle Kombinationen richtig gelocht werden. 2.2. Einstellung des Begrenzungsbügels der Zugstangen a) Die beiden Schrauben des Begrenzungsbügels lösen. b) Den Begrenzungsbügel so einstellen, daß zwischen diesem und den Zugstangen (Abb. 20/41) 0,l - 0,2 mm (Loch- streifenpapierstärke) Luft ist. c) Die beiden Schrauben des Begrenzungsbügels festziehen. 2.3. Einstellung des Streifentransportes (Abb. 21) a) Den Betriebsartenumschalter aufKstellen. b) Den Rasthebel (Abb. 20/24) an das Rastrad (Abb. 20/23) fest andrücken. c) Die Feststellschraube des Hebels (45) lösen und mit dem Exzenter dieses Hebels die Schaltklinke (16) an den Zahn des Schaltrades (15) heranbringen. d) Die Feststellschraube des Hebels (45) festziehen. 2.4. Einstellung des Schrittgruppenabstandes (Abb. 72) a) Den Betriebsartenumschalter aufCund die Teilung (links am Gerät) aufEINstellen. b) Die Stellung der Tromme1(1) und der Buchse (2) zuein- ander markieren. c) Die beiden Schrauben (3) lockern. d) Mit dem Exzenter (4) durch rechts- oder linksdrehen einen Schrittgruppenabstand von 2,54 mm einstellen. e) Die beiden Schrauben (3) festziehen. 2.5. Einstellung des Abstandes der Rastklinke (3) vom Zahnrad (4) (Abb. 21) a) Den Locher ausbauen. b) Die Feststellschraube des Hebels (7) lösen und die Feder dieses Hebels aushängen. c) Den Bügel (54) in die Stellung bringen, die er im ein- gebauten Zustand einnimmt. d) Den Zahn der Scheibe (21) au1 den Zahn des Hebels (46) stellen. e) Die Schraube des Hebels (1) lösen. f) Mit dem Exzenter des Hebels (1) den Abstand der Rast- klinke (3) vom Zahnrad (4) auf 0,2-0,3 mm einstellen. g) Die Schraube des Hebels (1) festziehen. h) Mit Hilfe des Exzenters am Hebel (7) den Zahn des He- bel (7) so einstellen, daß er genau in einen Zahn des Rast- rades (6) eingreift. i) Die Feststellschraube des Hebels (7) festziehen. j) Den Locher einbauen. Anmerkung: Die richtige Einstellung wird überprüft: in- dem das Zeichenzählwerk in Stoppstellung gebracht wird. Den Betriebsartenumschalter aufKstel- len, dabei darf das Zeichenzählwerk nicht anlaufen. 2.6. Einstellung der Auflagestücke beim Betätigen der Taste Wagenrücklauf/Zeilenvorschub (Abb. 20) a) Den Betriebsartenumschalter aufKstellen. b) Die Stellschraube am Hebel. (45) lösen. c) Den Nocken (44) auf Maximum drehen und mit der Stellschraube am Hebel (45) zwischen den Hebeln (11) und (12) einen kleinen Überhub einstellen. d) Die Stellschraube am Hebel (45) kontern. e) Den Elektromagnet (37) lösen und so einstellen, daß der Stift (39) auf dem Hebel (12) aufsitzt. f) Den Elektromagnet (37) festziehen. g) Die Kontermutter der Einstellschraube am Hebel (11.) lösen. h) Den Elektromagnet (37) von Hand auslösen. i) Mit der Einstellschraube des Hebels (11) die Auflagestücke (33, 34 und 36) so einstellen, daß sie über den ersten 2 Reihen der Stanzstempel stehen. j) Lochstreifenpapier einführen und stanzen. k) Die Einstellschraube am Hebel (11) kontern. l) Die Feststellschraube am Hebel (9) lösen und den Elektromagnet (37) auslösen. m) Den Exzenter am Hebel (9) so verstellen, daß der Hebel (Abb. 21/12) so steht, daß der Lochstreifen 2 Schritte transportiert werden kann. n) Die Feststellschraube am Hebel (9) festziehen. o) Die Kontermutter der Stellschraube am Hebel (Abb. 21/ 19) lösen. p) Mit der Stellschraube am Hebel (Abb. 21/19) den Bügel (Abb. 21/18) so einstellen, daß die Fortschaltklinke (Abb. 21/16) 2 Schritte transportiert. q) Die Kontermutter der Stellschraube am Hebel (Abb. 21/19) festziehen. r) Alle Einstellungen nachprüfen. 2.7. Einstellung der Schaltklinke (48) für den Zählwerktransport (Abb. 21) a) Die Feststellschraube am Hebel (50) lösen. b) Die beiden Schrauben des Anschlages der Schaltklinke (48) lösen. c) Den Hebel (50) auf den maximalen Radius des Nocken (49) bringen. d) Mit Hilfe des Exzenters am Hebel (50) die Schaltklinke (48) so einstellen, daß sie voll in einen Zahn des Zahn- rades (51) eingreift. Dabei beachten, daß die Rastklinke (7) ebenfalls voll in einen Zahn des Zahnrades (6) ein- greift. e) Die Feststellschraube am Hebel (50) festziehen. f) Den Anschlag an die Schaltklinke (48) heranführen und die Schrauben festziehen. 2.8. Einstellung des Bügels (16) (Abb. 65) a) Den Betriebsartenumschalter aufKstellen. b) Die Zahnscheiben (Abb. 21/21 und 23) so einstellen, da8 kein Zahn auf den Zähnen der beiden darunterliegenden Hebel (Abb. 21/20 und 46) aufliegt. c) Die Feststellschraube (17) lösen. d) Mit dem Exzenter (18) den Bügel (16) so einstellen, daß die Zähne der Hebel (Abb. 21/20 und 46) an den Zahn- scheiben anliegen. e) Die Feststellschraube (17) festziehen. 2.9. Einstellung der Ausgangsstellung der Auflagestücke für die Steuerkombinationen und der Anfangsstellung des Sektors für den Streifentransport (Abb. 21) a) Den Locher ausbauen. b) Die Zahnscheiben (21) und (23) so einstellen, daß kein Zahn auf den Zähnen der beiden darunterliegenden He- bel (20) und (46) aufliegt. c) Die Kontermutter der Stellschraube am Hebel (38) lösen. d) Mit der Stellschraube am Hebel (38) das Auflagestück (32) so einstellen, daß es sich 0,U-0,5 mm vor dem Stanzbügel (Abb. 20/31) schiebt. e) Die Kontermutter der Stellschraube am Hebel (38) fest- ziehen. f) Die Exzenterschraube mit Kontermutter am Hebel (34) lösen und mit Hilfe dieses Exzenters das Auflagestück (31) ebenfalls wie im Punkt d. beschrieben, einstellen. g) Die Kontermutter der Exzenterschraube am Hebel (34) festziehen. h) Die Kontermutter der Stellschraube am Hebel (41) lösen und die Auflagestücke (29) und (32) wie im Punkt d. be- schrieben, einstellen. i) Einen Zahn der Zählscheibe (23) auf den darunterliegenden Zahn des Hebels (20) stellen. j) Die Kontermutter der Stellschraube am Hebel (20) lösen und die Stellschraube so einstellen, daß die Transport- klinke (16) vom Bügel (18) für 2 Schritte freigegeben wird. k) Die Kontermutter der Stellschraube am Hebel (20) fest- ziehen. Anmerkung: Nach diesen Einstellungen Lochstreifen- papier in den Locher einführen, das Zei- chenzählwerk in Ausgangsstellung bringen und überprüfen, ob Zwischenraum, Wagen- rücklauf und Zeilenvorschub richtig gelocht werden. 2.10. Einstellung der Ansatzstücke des Zeichenzählwerkes beim Lochen der ersten 49 Zeichen jeder Geheimtextzeile. Beim Einstellen der Auflagestücke des Zeichenzählwerkes und des Bügels ist es notwendig: a) Den Betriebsartenumschalter aufKstellen. b) Das Schlüsselgerät einschalten. c) Den Arbeitsumschalter aufLstellen. d) Durch den Transportknopf für Dauerauslösung Zwischen- raum das Zeichenzählwerk ausschalten. e) In den Chiffrator den Schlüssellochstreifen einlegen. f) Den Betriebsartenumschalter aufCstellen. g) Das Schlüsselgerät ausschalten. h) Die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle einrasten und durch Drehen an der Kappe des Fliehkraftreglers die mechanischen Teile des Lochers und des Zeichenzähl- werkes in die in Abb. 67 gezeigte Stellung bringen, die dem Moment vor Beginn des Streifentransportes ent- spricht. i) Die Kontermutter (7) lösen, durch die Schraube (8) zwi- schen Auflagestücke und Stanzbügel ein Spiel von 0,3 bis 0,5 mm einstellen und die Kontermutter anziehen. In diesem Augenblick müssen die Auflagestücke die Stel- lung I, Abb. 20, einnehmen. j) Das Schlüsselgerät einschalten. k) Die Hauptwelle 3 mal anlaufen lassen und dann den Strom abschalten. l) Die Start-Stopp-Kupplung der Hauptwelle einrasten und durch Drehen an der Kappe des Reglers die mechanischen Baugruppen des Lochers und des Zeichenzählwerkes in die, in Abb. 68, gezeigte Stellung bringen, die dem Mo- ment vor Beginn des Streifentransports entspricht. (Stellung II, Abb. 20). m) Durch die Einstellschraube (3) nach vorangegangenem Lösen der Kontermutter (14) den Bügel (15) in eine Stellung bringen, in der die Klinke (2) das Schaltrad (I) mit der Achse (16) um 2 Schritte drehen muß. n) Durch die Exzenterschraube (7) werden die Auflagestücke der Hebel (5) und (6) auf gleicher Höhe (über der mitt- leren Stempelreihe) eingestellt und die Schraube (7) durch die Kontermutter (8) gesichert. 2.11. Einstellung der Scheiben des Zeichenzählwerkes Die Einstellung des Zeichenzählwerkes muß damit begonnen werden, daß man den Betriebsartenumschalter aufKstellt. Danach wird das Lösen der Schraube (9), Abb. 65, durch. Drehen der Exzenterbuchse (8) die Scheibe in die Stellung ge- bracht, in der der Hebel (14) aus dem Schaltrad (13) ausgerastet und die Seheibe (3), Abb. 66, mit dem Hebel (4) Zahn auf Zahn steht. Diese Stellung der Buchse wird durch die Schraube (9) gesichert. 2.12. Einstellung der Start-Stopp-Kupplung und des Klinkenan- triebes Der Hebel (1), der die Bewegung von der Nockenwelle des Druckwerkes auf die Scheibennase des Zeichenzählwerkes überträgt, liegt auf dem Hebel (22), Abb. 65, der wie folgt ein- gestellt wird: a) Die Start-Stopp-Kupplung des Lochers wird eingerastet, und die Nockenwelle des Druckwerkes wird in eine Stel- lung gebracht, bei der sich die Hebelrolle (23) auf dem maximalen Nockenradius befindet und die Scheibe (4) durch die Rastklinke (7) festgehalten wird. b) Um eine stabile Stellung der Achse zu erhalten, muß die Schraube (19) gelöst und der Hebel (1) durch den Ex- zenter (20) in die erforderliche Lage gebracht werden. c) Dazu sind die Schrauben (2) M 2,6x6 zu lösen. d) Der Anschlag (3) muß so weit verschoben werden, daß der Hebel (1) durch das Rastrad (4) nicht überholt wird. e) Die Schrauben festziehen. Anmerkung: Die Einstellung ist beim Lauf zu überprüfen, In diesem Zyklus muß die Scheibennase einen Schritt machen der 1/50 Umdrehung entspricht und bis zum nächsten Schritt eine stabile Stellung einnehmen. 2.12.1. Die Einstellung des Hebels (25), der die Streifenvorschubklinke steuert, geschieht wie folgt: a) Die Nockenwelle des Druckwerkes in eine Stellung bringen, in der die Rolle des Hebels (25) auf dem maximalen Nockenradius liegt. b) Die Schraube (24) lösen und die Streifenvorschubklinke durch den Exzenter (21) bis zum Anschlag (6) führen. c) Die Schraube (24) festziehen.
3.1. Einstellung des Kupplungskontaktes (Abb. 50 und 51) a) Den Betriebsartenumschalter aufDstellen. b) Die Antriebswelle des Chiffrators mit der Hand aus- kuppeln. c) Der Kupplungskontakt muß zu beiden Seiten 0,5-0,6 mm geöffnet sein. d) Wieder einkuppeln, dabei muß die mittlere und die obere Kontaktfeder geschlossen sein. Zwischen den anderen Kontaktfedern muß ein Zwischen- raum von 0,5-0,6 mm sein. e) Den Betriebsartenumschalter aufKstellen. f) Dabei wird die untere und die mittlere Kontaktfeder ge- schlossen. Der Abstand zwischen den geöffneten Kontak- ten muß ebenfalls 0,5-0,6 mm betragen. g) Die Einstellung des Abstandes erfolgt durch den Ex- zenter (17). 3.2. Einstellung des Aufzughebels (Abb. 85) a) Das Schaltrad (Abb. 30/3) abschrauben. b) Das Schaltrad (Abb. 30/2) um 90 Grad nach rechts drehen. c) Das Schlüsselgerät in Stoppstellung bringen. d) Die beiden Feststellschrauben (7) lockern. e) Mit den beiden Exzentern (6) den Bügel (3) in die unter- ste Stellung bringen. f) Das Schaltrad (Abb. 30/2) um 90 Grad nach links drehen. g) Mit den beiden Exzentern (6) den Bügel (3) soweit nach oben stellen, daß der Aufzugshebel (Abb. 8116) beim Zu- rückschalten des Betriebsartenumschalters aufKmit etwas Überschub aufgezogen wird. h) Die beiden Feststellschrauben (7) festziehen. i) Das Schaltrad (Abb. 30/3) anschrauben. 3.3. Einstellung der Ausgangsstellung der Abfühlstifte (Abb. 84) a) Den Betriebsartenumschalter aufKstellen. b) Das Schlüsselgerät in Stoppstellung bringen. c) Die Feststellschraube (11) lösen. d) Mit dem Exzenter (10) die Höhe der Abfühlstifte (9) so einstellen, daß sie 0,2 mm unter der Deckplatte des Chiff- rators stehen. e) Die Feststellschraube (11) festziehen. 3.4. Einstellung der Abfühlhebel der Kontroll- und Sicherungs- vorrichtungKSV(Abb. 82) a) Den Betriebsartenumschalter aufDsteilen. b) Gegenüber der roten Markierung des Schaltrades (Abb. 30/3) auf dem Schaltrad (Abb. 30/5) eine Markierung an- bringen. c) Das Schaltrad (Abb. 30/3) abschrauben. d) Die Feststellschraube (2) lösen. e) Die beiden Hebel (4) mit Hilfe des Exzenters (3) so ein- stellen, daß sie 0,2 mm unter der Streifenführung stehen. f) Die Feststellschraube (2) festziehen. g) Das Schaltrad (Abb. 30/3) anschrauben. 3.5. Einstellung des Gummikissens (Abb. 83) a) Den Chiffratordeckel abschrauben. b) Den Betriebsartenumschalter aufCstellen. c) Die Feststellschraube (11) lösen. d) Mit dem Exzenter (12) das Gummikissen (2) so einstellen, daß es sich - bei der Bewegung von der Ausgangsstel- lung nach oben - zirka 1,0-2,0 mm bewegt und dann muß der Hebel (Abb. 33/9) den Hebel (Abb. 33/3) frei- geben. e) Die Feststellschraube (11) festziehen. f) Den Betriebsartenumschalter aufKstellen. g) Den Chiffratordeckel festschrauben. 3.6. Einstellung der Sperrschiene, die bei Erscheinen der 32. Kom- bination in Funktion tritt (Abb. 81) a) Den Betriebsartenumschalter aufDstellen. b) Das Schlüsselgerät in Stoppstellung bringen. c) Die Feststellschraube (17) lösen. d) Mit den1 Exzenter (16) die Sperrschiene (11) so einstellen, daß der Hebel (4) gut einfallen kann. e) Die Feststellschraube (17) festziehen. f) Die beiden Schrauben des Anschlagklotzes (3) lösen. g) Den Anschlagklotz (3) so einstellen, daß zwischen der Sperrschiene (11) und dem Anschlagklotz (3) ein Zwi- schenraum von 0,2 mm ist. h) Die beiden Schrauben des Anschlagklotzes (3) festziehen. 3.7. Einstellung der Hebe1 zur Steuerung der Bewegung der Kon- taktleisten (Abb. 84) a) In den Chiffrator einen Schlüssellochstreifen, in dem nur die Transportlöcher eingestanzt wurden, einlegen. b) Den Betriebsartenumschalter aufDstellen. c) Durch die Kurbel die Nockenwelle des Chiffrators in eine Stellung bringen, in der die Rolle des Hebels (4) auf dem Nockenberg (3) steht. In dieser Lage darf der Spielraum zwischen den Aussparungen der Einstellstücke (8) und dem unteren Arm des Hebels (7) nicht mehr als 0,l bis 0,2 mm betragen und der gefederte Kontakt der Kontakt- leiste (5) muß in der Mitte des unbeweglichen Kontaktes der anderen Kontaktleiste liegen. Das Aufeinandertreffen der Kontakte wird durch den Abdruck der eingefärbten beweglichen Kontakte geprüft. Übersteigt der Abstand zwischen den Einstellstücken und den Hebeln den genann- ten Wert, so muß er wie folgt eingestellt werden. d) Die beiden Schrauben (12) M 4x7 lösen. e) Durch den Exzenter (13) den erforderlichen Spielraum einstellen. f) Die beiden Schrauben (12) festziehen.
| 4. E i n s t e d l u n g d e s T r a n s m i t t e r s u n d d e s |
| D e k o m b i n a t o r s |
4.1. Einstellung des Feststellhebels für die Hauptwelle (Abb. 19)
a) Den Transmitter mit Dekombinator ausbauen.
b) Die Kupplung in Stoppstellung bringen.
c) Die Mutter der Exzenterachse des Hebels (31) lösen.
d) Durch Drehen der Exzenterachse wird zwischen den Zäh-
nen der Kupplung (32) ein Abstand von 0,2-0,3 mm ein-
gestellt.
Anmerkung: Beim Lauf der Kupplung vergrößert sich der
Abstand zwischen den Zähnen der beiden
Kupplungsscheiben auf 0,5-0,6 mm.
4.2. Einstellung des Transmitters für eine Zeichenabtastung
(Abb. 19)
a) Den Transmitter mit Dekombinator ausbauen.
b) Die Mutter am Hebel (31) lösen.
c) Den AUS-Knopf
(2) drücken und in dieser Stellung
festhalten.
d) Den Festhaltezahn (36) gegenüber der Nase des Hebels
(16) stellen und die Rolle des Hebels (31) auf Maximum
des Nocken (30) bringen.
e) Den Exzenter am Hebel (31) so einstellen, daß der Hebel
(18) den Hebel (14) ausklinkt.
f) Die Mutter am Hebel (31) festziehen.
4.3. Einstellung des Streifentransportes (Abb. 19)
a) Den Transmitterdeckel abschrauben.
b) Die Transmitterkupplung in Stoppstellung bringen.
c) Die beiden Kontermuttern des linken Exzenterbolzens
(37) lösen.
d) Durch Drehen des linken Exzenters (37) wird ein Abstand
von 0,l-0,2 mm zwischen dem Zahn der Schaltklinke (38)
und den Zähnen des Zahnrades (39) eingestellt.
e) Die beiden Muttern des linken Exzenterbolzens (37) fest-
ziehen.
4.4. Einstellung des Streifentransportes am Ende der Fort-
schaltung (Abb. 19)
a) Den Transmitterdeckel abschrauben.
b) Die beiden Kontermuttern des rechten Exzenterbolzens
(37) lösen.
c) Die Transmitterkupplung auslösen und die Schaltklinke
(38) auf Maximum drehen.
d) Durch Drehen des rechten Exzenterbolzens (37) wird ein
Abstand von 0,1-0,2 mm zwischen der Schaltklinke (38)
und dem rechten Exzenterbolzen (37) eingestellt.
e) Die beiden Kontermuttern des rechten Exzenterbolzens
(37) festziehen.
4.5. Einstellung des Schrittgruppenabstandes (Abb. 80)
a) Die vordere Deckplatte abschrauben.
b) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
c) Einen gelochten Streifen mit einem Schrittgruppenab-
stand von 2,54 mm auf das Transportrad legen.
d) Die Schlitzschraube (5) locker;.
e) Mit der Exzenterschraube (4) die Löcher des Lochstreifens
genau über die Mitte der Abfühlstifte bringen.
f) Die Schlitzschraube (5) festziehen.
4.6. Einstellung der Ausgangsstellung der Abfühlstifte (Abb. 73)
a) Die Bodenplatte des Transmitters abschrauben.
b) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
c) Die beiden Schrauben (5) lösen.
d) Mit der linken Schraube (5) den Hebel (6) so einstellen,
daß die Abfühlstifte (7) 0,l-0,2 mm unter der Streifen-
führung stehen.
e) Die rechte Schraube (5) festziehen.
4.7. Einstellung des Aufzuges der Dekombinatorschienen (Abb. 74)
a) Die vordere und linke Deckplatte des Transmitters ab-
schrauben.
b) Die Streifenführung über dem Dekombinator abnehmen.
c) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
d) Die Feststellschraube am Hebel (Abb. 19/8) lösen.
e) Die Kontermutter (2) lösen.
f) Mit der Stellschraube (3) einen Abstand von 0,2-0,3 mm
zwischen den Schienen (6) und den Ansatzstücken (5)
einstellen.
g) Die Kontermutter (2) festziehen.
h) Die Feststellschraube am Hebel (Abb. 1918) festziehen.
Anmerkung: Der Abstand, wie im Punkt f. beschrieben,
kann schlecht gesehen werden.
Um den Abstand feststellen zu können,
werden alle Abfühlstifte nach unten gedrückt
und die Hauptwelle des Transmitters
gedreht. Dabei bewegen sich die Dekombi-
natorschienen, woraus der Abstand ersicht-
lich wird.
4.8. Einstellung des Schlagbügels (Abb. 75)
a) Den Transmitterdeckel abschrauben.
b) Den Transmitter in Stoppstellung bringen
c) Die Klemmschraube (2) und den Gewindestift des Klemm-
bügels (1) lösen.
d) Den Schlagbügel (3) so einstellen, daß alle Hebel (15) von
den Schienen (4) einen Abstand von 0,4-0,6 mm einnehmen.
e) Die Klemmschraube (2) und den Gewindestift des Klemm-
bügels (1) festziehen.
4.9. Einstellung des Transmitters bei Wagenrücklauf (Abb. 78)
a) Den Transmitter mit Dekombinator ausbauen.
b) Den Transmitter in Stoppstellung bringen.
c) Den Hebel (16) an die Nase (17) anlegen.
d) Die Feststellschraube (12) lösen.
e) Die Zugstange (15) in den Schlitz einhängen.
f) Den Nocken (3) auf Maximum stellen.
g) Mit dem Exzenter (13) einen Abstand von 0,3-0,4 mm
zwischen den Hebeln (7) und (8) einstellen.
h) Die Feststellschraube (12) festziehen.
i) Die Feststellschraube des Exzenters (6) lösen.
j) Mit dem Exzenter (6) den Hebel (5) so einstellen, daß der
Hebel (Abb. 19/20) an der Nase der Kupplung 2,O-2,5 mm
anliegt.
k) Die Feststellschraube des Exzenters (6) festziehen.
l) Den Transmitter mit Dekombinator einbauen.
m) Die Zugstange (1) so anschrauben, daß zwischen den He-
beln (7) und (8) ein Abstand von 0,l-0,2 mm ist.
Anmerkung: Die Einstellung im Punkt m. wird erst dann
vorgenommen, wenn der Wagenrücklauf am
Antrieb richtig eingestellt ist.
4.10. Einstellung für die Auslösung beim Abfühlen der 32. Kombi-
nation (Abb. 75)
a) Den Transmitter mit Dekombinator ausbauen.
b) Die vordere Deckplatte abschrauben.
c) Den Transmitter in Stoppstellung bringen.
d) Die Kontermutter (8) lösen.
e) Mit der Stellschraube (10) zwischen dem Hebel (5) und
der untersten Schiene (4) einen Abstand von 0,2-0,3 mm
einstellen.
f) Die Kontermutter (8) festziehen.
g) Einen zirka 20 cm langen Lochstreifen mit der 32. Kom-
bination einlegen und auf den EIN-Knopf
drücken.
h) Die Mutter der Exzenterschraube (12) lösen.
i) Einen Hebel (15) in die Dekombinatorschienen (4) ein-
fallen lassen.
j) Mit der Exzenterschraube (12) zwischen dem Hebel (Abb.
19/3) und dem EIN-Knopf
(Abb. 19/1) einen Abstand
von 0,4-0,5 mm einstellen.
k) Die Mutter der Exzenterschraube (12) festziehen.
5.1. Einstellung der: Ausschaltung des Zeichenzählwerkes, wenn
der Knopf für Dauerauslösung Zwischenraum gedrückt wird
(Abb. 71)
a) Ben Betriebsartenumschalter auf C
stellen.
b) Die Automatikkupplung in Stoppstellung bringen.
c) Die Stellschraube (1) so einstellen, daß sich, wenn auf
den Knopf für Dauerauslösung Zwischenraum gedrückt
wird, der Hebel (5) um 1,O-1,5 mm anhebt.
e) Die Kontermutter (2) festziehen.
5.2. Einstellung der Start-Stopp-Kupplung (Abb. 63)
a) Die Stromversorgung ausbauen.
b) Den Betriebsartenumschalter auf K
und den Arbeits-
umschalter auf BL
stellen.
c) Die Klemmschraube (5) lesen.
d) Den Hebel (3) bis zum Anschlag (2) drücken.
e) Den Hebel (Abb. 62/3) so einstellen, da13 zwischen seiner
Nase und dem Hebel (Abb. 62/2) ein Abstand von 0,2 bis
0,3 mm ist.
f) Die Klemmschraube (5) festziehen.
g) Eine beliebige Taste drücken.
h) Den Motor mit der Hand soweit durchdrehen, bis der He-
bel (Abb. 6212) auf dem Maximum des Nocken (Abb. 62/1)
steht.
i) Die Feststellschraube des Exzenters (16) lösen.
j) Mit Hilfe des Exzenters (16) den Abstand des Hebels (6)
vom Zahn (7) der Kupplung auf 0,3-0,5 mm einstellen.
k) Die Feststellschraube des Exzenters (16) festziehen.
6.1. Einstellung des Impulskontaktes
a) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
b) Zwischen dem Kunststoffstück der Kontaktfeder und dem
Nocken muß ein Abstand von 0,l-0,2 mm sein.
c) Zwischen den beiden Kontakten muß ein Abstand von
0,5-0,6 mm sein.
Anmerkung: Die Kontaktfedern müssen fest an ihren
Stützen anliegen. I
Der Impulskontakt darf nicht geölt werden,
er muß immer sauber sein.
6.2. Einstellung des Feststellhebels der Hauptwelle
a) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
b) Die Festhalteschraube der Exzenterachse lösen.
c) Durch Drehen der Exzenterachse wird zwischen den Zäh-
nen der Hauptwellenkupplung ein Abstand von 0,2 bis
0,3 mm eingestellt.
d) Die Festhalteschraube der Exzenterachse festziehen.
Anmerkung: Beim Lauf der Kupplung vergrößert sich der
Abstand zwischen den Zähnen der beiden
Kupplungsscheiben bis auf 0,5-0,6 mm.
6.3. Einstellung der Friktionskupplung der Wagenrücklaufwelle
(Abb. 15)
a) Über die angetriebenen Teile (6) und (11) mit Bleistift
einen Strich ziehen.
b) Das Schlüsselgerät einschalten und den Wagen in die
Anfangsstellung bringen.
c) Die Wagenrücklauftaste drücken.
d) Bei richtiger Einstellung müssen sich die Bleistiftstriche
um 2,O-3,O mm verschieben.
e) Sollte dies nicht der Fall sein, wird mit Hilfe der Mut-
tern (3) und (4) der Andruck der Federn (14) verändert.
6.4. Einstellung der Steuerung für automatischen Wagenrücklauf
(Abb. 58)
6.4.1. Einstellung der Zugstange zum Wagens
a) Den Dreizackhebel (Übertragungshebel) (4) in die Aus-
gangsstellung bringen.
(Läßt sich der Dreizackhebel (4) nicht in die Ausgangs-
stellung bringen, muß die Klemmschraube (6) gelöst und
neu eingestellt werden).
b) Den Wagen auf den 57. Schritt bringen.
c) Die Zugstange (20) so einstellen, daß der Wagen beim 57.
Schritt an dieser anliegt.
6.4.2. Einstellung der Vorrichtung, die das Auffangen des Wagens
bei Wagenrücklauf bewirkt (Abb. 58)
a) Die obere Schraube (5) des Hebels (4) so Einstellen, daß
diese 1,5-2,O mm nach vorn zum Hebel (2) heraussteht.
b) Die Stellschraube des Stoßdämpfers lösen und mittels
dieser den Hebel (4) so einstellen, da9 nach ausgelöstem
Wagenrücklauf der Hebel (4) in seine Ausgangsstellung
gebracht wird.
c) Die Stellschraube des Stoßdämpfers kontern.
6.4.3. Einstellung der Ausgangsstellung des Anschlaghebels (Abb. 58)
a) Die Schraube des Exzenters (1) lösen.
b) Den Wagen von Hand aus nach rechts in die Anfangs-
stellung bringen.
c) Der Abstand zwischen Wagen und Kunststoffklotz des
Hebels (2) muß 0,3-0,5 mm betragen.
d) Die Schraube des Exzenters (1) festziehen.
6.4.4. Einstellung des Hebels (9) (Abb. 58)
a) Die Schraube (8) lösen.
b) Den Kunststoffklotz (3) bis zum Anschlag zurückziehen
und festhalten.
c) Die Schraube (8) so einstellen, daß zwischen den Hebeln
(9) und (10) ein Abstand von 0,2-0,3 mm entsteht.
d) Den Kunststoffklotz (3) loslassen und die Schraube (8)
kontern.
6.4.5. Einstellung der Steuerung der Zahnkupplung beim Einschalten
von Wagenrücklauf (Abb. 58)
a) Die untere Schraube (5) lösen.
b) Den Hebel (4) in die 3. Stellung bringen.
c) Mit der Stellschraube (5) zwischen den Hebeln (9) und (10)
einen Abstand von 0,l-0,2 mm einstellen.
d) Die untere Schraube (5) kontern.
6.4.6. Einstellung der Steuerung der Zahnkupplung nach erfolgtem
Wagenrücklauf (Abb. 58)
a) Den Hebel (9) in den Hebel (10) durch Zurückziehen des
Kunststoffklotzes (3) einrasten.
b) Die beiden Schraube11 des Hebels (17) lösen.
c) Zwischen den Zähnen der Kupplung (21) einen Abstand
von 0,3-0,5 mm einstellen.
d) Die beiden Schrauben des Hebels (17) festziehen.
Anmerkung: Nach Beendigung dieser Einstellungen muß
das Zusammenwirken mit der Tastatur
überprüft werden.
6.5. Regulierung der Motordrehzahl bei der Arbeit mit Wechsel-
strom (Abb. 86)
a) Durch Drehen der Rändelmutter (9) in die eine oder an-
dere Richtung wird die Drehzahl des Motors geregelt.
7.1. Einstellung der Schaltklinke für Zeilentransport (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Den Drehknopf (32) abschrauben.
c) Die beiden Schrauben des Anschlages (21) lösen.
d) Den Anschlag (21) so einstellen, daß die Nase der Schalt-
klinke (22) vom Schaltrad (23) einen Abstand von 0,2
bis 0,3 mm hat.
7.2. Einstellung der Schaltklinke und des Sektors bei Ende des
Zeilentransportes (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Die Rastklinke (25) in den zweiten Zahn des Sektors (27)
einrasten.
c) Die Feststellschraube des Sektors (27) lösen.
d) Den Exzenter des Sektors (27) so einstellen, daß die
Schaltklinke (22) vom hinteren Anschlag (37) einen Ab-
stand von 0,l mm hat.
e) Die Feststellschraube des Sektors (27) festziehen.
7.3. Einstellung des Wagenauslösebügels (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Die Rastklinke (25) in den zweiten Zahn des Sektors (27)
einrasten.
c) Die Feststellschraube am Wagenauslösebügel (35) lösen.
d) Den Exzenter so einstellen, daß der Bügel vom Hebel (47)
einen Abstand von 0,4-0,5 mm hat.
e) Die Feststellschraube am Wagenauslösebügel (35) festziehen.
7.4. Einstellung der Rastklinke für Zeilentransport (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Das Papierführungsblech (56) abnehmen.
c) Die Mutter der Exzenterachse der Rastklinke (52) lösen.
d) Die Rastklinke (25) in den zweiten Zahn des Sektors (27)
einrasten.
e) Die Exzenterachse so einstellen, daß die Rolle der Rast-
klinke (52) zwischen 2 Zähnen liegt.
f) Die Mutter der Exzenterachse festziehen und das Papier-
führungsblech wieder aufsetzen.
7.5. Einstellung der Zahnstange für Fünfergruppenteilung (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen. .
b) Die 2 Befestigungsschrauben der Zahnstange (46) lösen.
c) Die Zahnstange so einstellen, daß nach fünfmaliger Wa-
genfortschaltung der Hebel (47) hinter dem Zahn der
Zahnstange (46) steht.
d) Die 2 Befestigungsschrauben der Zahnstange (46) festziehen.
Anmerkung: Beim Einstellen ist die Zahnstange (46)
immer nach vorn (Richtung der Zähne) zu
drücken.
7.6. Einstellung der Spannung der Spiralfeder (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Den beweglichen Wagenteil an den linken Anschlag
bringen.
c) Das Sperrad (9) abnehmen.
Achtung! Die Trommel mit der Feder muß festgehalten
werden.
d) Die Spiralfeder 3-4 volle Umdrehungen auf ziehen.
e) Das Sperrad bis zum linken Anschlag drehen, dann eine
viertel Umdrehung wieder zurückdrehen.
f) Das Sperrad (9) wieder einbauen.
Anmerkung: Den Wagen wieder aufsetzen und prüfen,
ob er über die ganze Zeile transportiert wird
und auch der Wagenrücklauf und die Tei-
lung in Fünfergruppen einwandfrei erfolgt.
Der Vorgang ist so lange zu wiederholen,
bis die genannten Funktionen gewähr-
leistet sind.
7.7. Einstellung des Druckes der Papierandruckwalzen (Abb. 16)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Das Papierführungsblech (56) und die Gummiwalze ab-
nehmen.
c) Das Papierführungsblech (5 1) mit den Gummirollen (16)
abnehmen.
d) Durch Drehen der Zahnkupplungen (43) den nötigen
Druck einstellen.
7.8. Einstellung der Wagenfortschaltung (Abb. 57)
a) Die Muttern (3) und (5) der Spannstange(4) lösen.
b) Die Spannstange (4) so einstellen, daß der Wagen ein-
wandfrei fortgeschaltet wird.
c) Die Muttern (3) und (5) der Spannstange (4) festziehen.
8.1. Einstellung der Federspannung der Druckerfeder (Abb. 8)
a) Die rechte Farbbandrolle abnehmen.
b) Das Feststellstück der Spezialmutter (7) nach rechts schieben
und die Mutter (7) so anziehen, daß die Rolle (10)
auf dem Nocken (11) abläuft.
c) Das Feststellstück nach beendeter Einstellung nach links
in die Nut einschieben.
8.2. Einstellung der Ausgangsstellung des Druckerbügels (Abb. 7)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
c) Die 4 Gewindestifte an den schwarzen Exzenterbuchsen
lockern.
d) Mit den Exzenterbuchsen den Druckerbügel (41) so ein-
stellen, daß zwischen den Stoßhebeln (37) und den Frei-
gabehebeln (36) gleich viel Spiel verbleibt. Dabei muß
zwischen dem Druckerbügel(41) und den Beiden Exzenterbuchsen
o,1 mm Spiel. sein.
e) Zwischen den Stoßhebeln (37) und den Freigabehebeln
(36) wird mit dem Klemmstück (43) ein Abstand von 0,5
bis 0,7 mm eingestellt.
8.3. Einstellung des Ankerhubes der Elektromagneten
a) Die Kontermutter der Stellschraube (gelb gelackt) lockern.
b) Den Anker drücken und zwischen Anker und Stellschrau-
be einen Abstand von 0,6-0,7 mm einstellen.
c) Die Stellschraube kontern.
8.4. Einstellung der Ausgangsstellung der Freigabehebel (Abb. 61)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Die Hauptwelle in Stoppstellung bringen.
c) Die Halteschraube (3) des Betreff enden Elektromagneten
(2) lösen.
d) Den Elektromagnet (2) so einstellen, daß er bei angezo-
genem Anker (1) den Freigabehebel (4) vom Stoßhebel
(14) 0,2-0,3 mm entfernt.
e) In der Ausgangsstellung des Freigabehebels (4) muß zwi-
schen seinem unteren Arm und den Kombinatorschienen
(16) ein Abstand von 0,2-0,3 mm sein.
f) Die Halteschraube (3) des betreffenden Elektromagneten
festziehen.
Anmerkung: Wenn zwischen den Kombinatorschienen
(16) und dem unteren Arm des Hebels (4)
kein Zwischenraum von 0,2-0,3 mm ein-
zustellen ist, so muß das Lederkissen (Abb.
10/16) angehoben werden. Das Anheben er-
folgt durch die 4 Stellschrauben.
8.5. Einstellung der Anschlagstärke der Typenhebel (Abb. 61)
a) Einen Bogen Papier in den Wagen einspannen.
b) Das Schlüsselgerät einschalten.
c) Den Zeichenabdruck prüfen, danach den Wagen ab-
nehmen.
d) Die Gewindestifte (9) des Abwurfbügels (13) lösen.
e) Wenn der Zeichenabdruck schwächer werden soll, so muß
der Abwurfbügel (13) nach hinten geschoben werden. Soll
der Zeichenabdruck stärker sein, so muß der Abwurf-
bügel (13) nach vorn gezogen werden.
f) Die Gewindestifte (9) des Abwurfbügels (13) festziehen.
g) Den Wagen aufsetzen und den Zeichenabdruck prüfen.
8.6. Einstellung der Kombinatorschienen (Abb. 64)
a) Den Wagen vom Schlüsselgerät abnehmen.
b) Den Locher ausbauen.
c) Den Betriebsartenumschalter auf K
und den Arbeits-
umschalter auf BL
stellen.
d) Den Automatikantrieb in Stoppstellung bringen.
e) Die Hauptwelle durch Drücken des Buchstaben V
auslösen.
(Danach das gleiche mit dem Buchstaben E
durchführen).
f) Den Motor von Hand aus so weit drehen, daß sich die
Kombinatorschienen gerade zu bewegen beginnen.
g) Es ist darauf zu achten, ob die Kombinatorschienen (1)
das nötige Spiel von 0,l-0,2 mm zwischen den Freigabe-
Hebeln (12) haben.
Ist dies nicht der Fall, muß nachgestellt werden.
h) Das Nachstellen der Kombinatorschienen geschieht durch
das Losen der Feststellschraube (6), danach die Konter-
mutter (4) lösen und mit der Stellschraube (5) den nöti-
gen Abstand einstellen.
i) Die Feststellschraube (6) und die Kontermutter (4) fest-
ziehen.
Anmerkung: Für diese Einstellung ist der Stromarten-
stecker am Motor zu entfernen und das
Schlüsselgerät einzuschalten.
Alle Stellschrauben, die farbig gelackt sind und nachgestellt werden müssen, sind nach Beendigung der Einstellung erneut mit farbigem Sicherungslack zu lacken.
| V. Vorschrift für die Funktionsüberprüfung des |
| Schlüsselgerätes CM-2 |
1. Allgemeines a) Gehäuse abnehmen. b) Schlüsselgerät einschalten. 2. Überprüfung des Streifentransportes des Lochers a) Den Arbeitsumschalter aufBLund den Betriebsarten- umschalter aufKstellen. b) Abwechselnd 32. Kombination und Dauerauslösung Zwi- schenraum geben (ca. fünfmal). Richtiges Lochen der Kombinationen prüfen. c) Abwechselnd Wagenrücklauf und Dauerauslösung Zwi- schenraum geben (ca. fünfmal). Richtiges Lochen der Kombinationen prüfen. d) Hintereinander (ca. zehnmal) Wagenrücklauf drücken. Richtiges Lochen der Kombinationen prüfen. e) Den Betriebsartenumschalter aufCstellen. f) Mit dem Schraubenzieher das Zeichenzählwerk am Hebel (Abb. 22/38) auslösen und prüfen, ob die Teilung in Fün- fergruppen einwandfrei durchgeführt wird. Ca. 30 bis 40 Fünfergruppen lochen lassen. g) Schrittgruppenabstand prüfen und wenn nötig einstellen. h) Das Zeichenzählwerk in der 2. bis 4. Fünfergruppe ab- schalten. i) Dauerauslösung Zwischenraum geben und prüfen, ob das Zeichenzählwerk abgeschaltet wird. j) Die Punkte 2f, 2h und 2i werden dreimal wiederholt. 3. Überprüfung, ob in der StellungBdes Arbeitsumschalters der Locher und beiLdas Druckwerk abgeschaltet wird. 4. Überprüfung der Arbeit des Druckwerkes, des Transmitters mit Dekombinator und des Lochers a) Arbeitsumschalter aufBLKund Betriebsartenumschalter aufKstellen. b) 10 Zeilen des folgenden Klartextes über die Tastatur ein- geben: Kaufen sie jede Woche vier gute bequeme Pelze ryryry … (bis zum Ende der Zeile). c) 32. Kombination drücken und den Streifen durch Dauer- auslösung Zwischenraum vorlaufen lassen. d) Den erhaltenen Lochstreifen über den Transmitter ein- geben und den Text noch einmal unter den von Hand geschriebenen Text schreiben. e) Prüfen, ob der Transmitter auf die 32. Kombination an- spricht und abschaltet. f) Die beiden erhaltenen Lochstreifen werden auf Abwei- chungen überprüft. 5. Überprüfung der Arbeit des Chiffrators 5.1. Herstellung eines Schlüssellochstreifens für Prüfzwecke. Es wird ein Schlüssellochstreifen von ca. 1,5 m Länge hergestellt. Dazu ist folgendes notwendig: a) 5 bis 10 cm Zwischenraum durch Dauerauslösung geben. b) Wahllos alle möglichen Kombinationen lochen (auch Wagenrücklauf, Zeilenvorschub) und am Ende die 32. Kombination drücken. c) Die vordere Ecke des Streifens abreißen. Dadurch erhält man einen Streifen, der einem Schlüssellochstreifen in technischer Hinsicht äquivalent ist. 5.2. Prüfvorgang a) Arbeitsumschalter aufBLund Betriebsartenumschalter aufKstellen. b) Den nach Punkt 5.1. hergestellten Schlüssellochstreifen einlegen. c) Durch Drücken auf verschiedene Tasten prüfen, ob das Schlüsselgerät tatsächlich gesperrt ist. d) Betriebsartenumschalter aufDstellen. Dabei muß die Hauptwelle des Schlüsselgerätes einmal anlaufen. Der Wagen und der Gruppenzähler dürfen keinen Schritt machen, während sich der hergestellte Schlüssellochstrei- fen um einen Schritt weiterbewegt. e) Den Betriebsartenumschalter aufCstellen. Dabei muß der Stanzstempel ein Loch in den Streifen stanzen. f) Den Klartextstreifen in den Transmitter einlegen und chiffrieren. g) Da im hergestellten Schlüssellochstreifen am Ende die 32. Kombination vorkommt, muß über den Chiffrator die 2. Sperrschiene ansprechen. Hält das Schlüsselgerät an, so muß aufKzurückgeschaltet werden. h) Den Deckel des Chiffrators öffnen. Der Mechaniker mu8 sich davon überzeugen, daß die 32. Kombination un- mittelbar links von den Abfühlstiften liegt. i) Danach den Schlüsselstreifen und den Klartextlochstreifen nochmals einlegen. j) Den Betriebsartenumschalter aufCstellen. k) Durch Drücken auf die Tasten prüfen, ob die Sperre gegen doppelte Benutzung des Schlüssellochstreifens anspricht. l) Danach die Sperre aufheben und den entstehenden Ge- heimtext unter den ersten Geheimtext schreiben. m) Prüfen, ob gleicher Geheimtext entsteht. n) Gegen Ende des Schlüssellochstreifens prüfen, ob das Schlüsselgerät blockiert wird, wenn der Schlüsselloch- streifen nicht transportiert wird. Zu diesem Zweck den Streifen festhalten. o) Beide Geheimtextstreifen dechiffrieren und auf Blatt untereinanderschreiben.
Art der Fehler | Ursache der Fehler | Fehlerbeseitigung
Beim Einschalten des | Fehlen der Netzspan- | Vorhandensein der Netzspannung mit Voltmeter - fehlt
Schlüsselgerätes arbei- | nung. | dieses, dann mit Lampe aus dem Werkzeugkasten -
tet der Elektromotor | | prüfen.
nicht. | |
| Durchgebrannte Sicheru- | Sicherung mit Ohmmeter prüfen. Defekte Sicherung aus-
| ng 2A im Stromkreis | wechseln.
| des Elektromotors. |
| |
| Bruch im Zuleitungs- | Das Zuleitungskabel überprüfen, indem eine Klemme des
| kabel des Schlüsselge- | Ohmmeters an den Stecker des Zuleitungskabels und die
| rätes. | zweite Klemme der Reihe nach an jede Klemme der Lei-
| | ste in der Grundplatte angeschlossen wird, an der die Ka-
| | belenden befestigt sind. Bei einem Bruch der einen oder
| | der anderen Leitung des Kabels am Stecker oder am Ein-
| | gang in die Grundplatte des Schlüsselgerätes, ist das Ka-
| | belenden befestigt sind. Bei einem Bruch der einen oder
| | der anderen Leitung des Kabels am Stecker oder am Ein-
| | gang in die Grundplatte des Schlüsselgeräte ist, das Ka-
| | bel an der schadhaften Stelle abzuschneiden und die Lei-
| | tungsenden an dem Stecker oder an der Leiste in der
| | Grundplatte neu anzuschließen.
| |
| Der Netzschalter des | Mit dem Ohmmeter den Stromlauf im Schalter prüfen.
| Schlüsselgerätes ist | Bei Unterbrechung den Schalter auseinandernehmen und
| schadhaft. | den Zustand der Kontaktoberflächen prüfen. Bei Abbren-
| | nen oder Verschmutzung sind sie zu säubern. Ein schad-
| | hafter Schalter ist durch einen neuen zu ersetzen.
| |
Fehler im Elektromo- | Fehlen des Kontaktes | Mögliche Ursache kann sein, daß die Bürsten abgenutzt
tor SL-369 uA 1 | zwischen Kollektor | oder im Bürstenhalter eingeklemmt sind. Abgenutzte
| und Bürsten. | Bürsten werden durch neue ersetzt. Bei eingeklemmten
| | Bürsten werden die Bürstenhalter gesäubert und die Bür-
| | sten angepaßt, nachdem sie mit einer Feile abgefeilt
| | wurden.
| |
| Der Kontakt des Flieh- | Der Kontakt, der im stromlosen Zustand geschlossen sein
| kraftreglers ist geöff- | muß, ist einzustellen.
| net (bei Arbeit vom |
| Wechselstromnetz). |
| |
| Bruch im Stromkreis | Dieser Fehler ist vom Durchbrennen der Sicherung 2 A
| der Erregerwicklung | begleitet. Der Stromkreis der Erregerwicklung ist mit dem
| | Ohmmeter an Hand des Stromlaufplanes des Schlüssel-
| | gerätes zu prüfen.
| |
Der Elektromotor ar- | Starkes Abbrennen | Den Kollektor mit feiner Schmirgelleinewand reinigen
beitet nicht mit voller | des Kollektors. | und mit in Spiritus getränktem Leinenlappen abreiben.
Leistung. | |
| |
| Die Bürsten sind nicht | Die Bürsten sind durch Drehen der Schlitzklappen in den
| genügend an den Kol- | Bürstenhalter im Uhrzeigersinn anzudrücken.
| lektor angedrückt. |
| |
| Bruch einer der Sek- | Die Bruchstelle durch Anschließen des Ohmmeters an die
| tionen der Ankerwick- | benachbarten Kollektorlamellen feststellen. Ein Bruch er-
| lung. | erfolgt meistens an den Lötstellen der Wicklungsenden an
| | den Kollektorlamellen.
| | Bei Vorhandensein einer Bruchstelle ist das gelöste Ende
| | vorsichtig zu säubern und anzulöten. Bei einem Bruch
| | innerhalb der Wicklung muß der Elektromotor ausge-
| | wechselt werden.
| |
Der Elektromotor hat | Es fehlt die Schmierung | Den Elektromotor auseinandernehmen, die Kugellager
sich stark erhitzt. | in den Lagern. | waschen und neu fetten. Nach dem Zusammensetzen über-
| Die Lager sind ver- | prüfen, ob der axiale Spielraum der Welle fehlt und ob
| schmutzt. | diese sich von Hand aus ohne Bürsten leicht drehen läßt.
| |
| Stark an den Kollek- | Den Bürstendruck regulieren. Da es wegen Fehlen des er-
| tor angedrückte Bür- | forderlichen Meßinstrumentes während des Betriebes
| sten. | schwierig ist, den notwendigen Bürstendruck festzustellen,
| | empfiehlt es sich, den Bürstendruck auf folgende Weise
| | zu ermitteln:
| | Der Druck der Bürste des eingeschalteten Elektromotors
| | ist herabzusetzen, indem die Schlitzklappe mit einem
| | Schraubenzieher abgeschraubt wird, bis über dem ablau-
| | fenden Rand der Bürste eine starke Funkenbildung ent-
| | steht, wonach die Kappe wieder 1,5 bis 2 Umdrehungen
| | einzuschrauben ist.
| |
Niedriger Widerstand | Absetzen von Kupfer- | Den Elektromotor auseinandernehmen, die innere Mantel-
der Isolation an den | und Kohlestaub auf | fläche des Gehäuses und die Bürstenhalter mit Wasch-
stromführenden | den Bürstenhaltern. | mittel auswaschen.
Teilen gegenüber dem | |
Gehäuse des Elektro- | |
motors. | |
| |
Beim Einschalten des | Die Sicherung 1A im | Die Sicherung herausnehmen und mit dem Ohmmeter
Schlüsselgerätes ar- | Stromkreis der Elek- | prüfen. Sie, falls erforderlich, durch eine neue ersetzen.
beitet zwar der Elek- | tromagneten ist durch- |
tromotor, aber es wer- | gebrannt. |
den keine Zeichen ge- | |
schrieben. | |
| Der Kupplungskon- | Durch wiederholtes Umstellen des Betriebsartenumschal-
| takt KK
(Abb. 40), | ters von K
auf D
oder C
überzeugt man sich von
| der vom Betriebs- | der richtigen Arbeit des Kontaktes. Iii allen Fällen muß
| artenumschalter ge- | eine Verbindung der mittleren mit der oberen oder un-
| steuert wird und sich | teren Feder hergestellt werden.
| in der Grundplatte |
| des Chiffrators befin- |
| det, gibt keine Ver- |
| bindung. |
| |
| Verschmutzung des | Den Kontakt mit einem Stück Stoff, das mit Spiritus ge-
| Kontaktes KK
. | tränkt ist, säubern. Den Durchgang mit Hilfe eines Ohm-
| | in allen Stellungen des Betriebsartenumschalters
| | prüfen.
| |
| Die Zuleitungen zum | Durchgang nach dem Stromlaufplan mit dem Ohmmeter
| Kontakt K
sind | prüfen.
| beschädigt. |
| |
| Verschmutzung des | Kontakte säubern. Lötstellen prüfen.
| Impulskontaktes |
| IK
|
| |
Während eines jeden | Einer der Kontakte | Bodenplatte abnehmen und die Stellung der Kontakte
Zyklus arbeiten gleich- | der Tastatur ist | der Tastatur prüfen.
zeitig 2 Typenhebel. | dauernd geschlossen. |
| |
| Anker und Stange | Am wahrscheinlichsten ist, da13 sich die Stange des Elek-
| eines Elektromagneten | tromagneten in der Buchse festgelaufen hat. Es ist not-
| des Druckwerkes | wendig, den Elektromagneten abzunehmen, das Festlau-
| kehren nicht in | fen zu beseitigen, neu abschmieren und einbauen.
| die Ausgangsstellung |
| zurück. |
| |
Während eines zyk- | Schluß zwischen Kon- | Den Schluß auf Grund des Stromlaufplanes mit Hilfe des
lus (nicht in jedem) | takten der Ubergangs- | Ohmmeters oder der Neonlampe eingrenzen. Die Hand-
sprechen 2 Typenhebel | kontaktleisten oder | lampe für die Beleuchtung darf bei der Eingrenzung des
an. | zwischen Drähten. | Schlusses nicht angewandt werden, da die Isolation an
| | benachbarten Kontakten durchbrennen kann.
| |
| | Beispiel:
| | Schluß bei der Stellung des Betriebsartenumschalters auf
| | K
.
| |
| | Nehmen wir an, daß bei Drücken auf die Taste D
2
| | Typenhebel ansprechen -D
und E
. Aus dem Strom-
| | laufplan des Schlüsselgerätes geht hervor, da13 der Schluß
| | zwischen den Kontakten 4 und 5 eines der Übergangs-
| | kontaktleisten ÜKL 4, ÜKL 3, ÜKL 1, ÜKL 2 oder in der
| | Verdrahtung, die diese Übergangskontaktleisten verbin-
| | det, liegt. Die Übergangskontaktleisten sind parallel ge-
| | schaltet. Zur Fehlersuche ist es notwendig, sie voneinan-
| | der zu trennen. Im gegebenen Falle ist es zweckmäßig,
| | den Chiffrator abnehmen, den Betriebsartenumschalter
| | auf K
stellen und vergewissern, ob der Schluß weg ist,
| | indem man das Ohmmeter an die Kontakte 4 und 5 der
| | Übergangskontaktleiste ÜKL 3 anklemmt.
| | Indem das Ohmmeter an die inneren Kontaktfedern der
| | Kontakte D
und E
angeklemmt wird, feststellen, ob
| | Schluß in der Tastatur ist. Ist dort kein Schluß, so ist das
| | Ohmmeter an die Kontakte 4 und 5 der Leiste ÜKL 1 an-
| | zuschließen, die sich in der Grundplatte befindet.
| | Zeigt das Ohmmeter zwischen den Kontakten 4 und 5 der
| | Übergangskontaktleiste Widerstand an, so muß man sich
| | vergewissern, ob sich die Federn der Kontakte 4 und 5,
| | an die die Drähte gelötet sind, berühren. Desgleichen ist
| | die Isolation der Drähte zu prüfen. Sind keine sichtbaren
| | Beschädigungen in der Übergangskontaktleiste ÜKL 1, so
| | muß das Druckwerk abgenommen und dessen Verdrah-
| | tung geprüft werden.
| |
| | Beispiel:
| | Auffinden eines Kurzschlusses, wenn der Betriebsarten
| | umschalter auf C
oder D
steht.
| |
| | Es wird angenommen, daß das Schlüsselgerät in der Stel-
| | lung K
des Betriebsartenumschalters normal arbeitet
| | und im gegebenen Fall eine Störung im Chiffrator vor-
| | liegt. Es wird empfohlen, die Eingrenzung in unten auf-
| | geführter Reihenfolge durchzuführen:
| |
| | Den Deckel der Kontaktleisten KL
öffnen und sorgfäl-
| | tig die Leisten KL 7, KL 8 und die 2 Leisten KL
2 und 4.
| | überprüfen, ob die Isolation zwischen benachbarten Kon-
| | takten verbrannt ist. Bei Feststellen einer Brandstelle
| | muß die verkohlte Schicht zwischen den Kontakten ent-
| | fernt werden. Ein Loch 01,2 mm bis 2,5 mm tief zwi-
| | schen den Kontakten bohren, in die Bohrung Schellack
| | oder Bakelitlack einführen und ein Ebonitröllchen (Er-
| | satzteilnummer 8.589.039), das in den Ersatzteilen vor-.
| | handen ist, einpressen. Nach dem Trocknen die Stelle mit
| | Schmirgelleinwand abreiben und mit der Kontaktober-
| | fläche abschließen lassen. Ist keine Brandstelle vorhan-
| | den, so muß die Verdrahtung des Chiffrators geprüft
| | werden. Dabei nimmt man ihn von dem Schlüsselgerät ab.
| |
| | Die Verdrahtung wird wie folgt geprüft:
| |
| | Den Deckel der Kontaktleisten KL
öffnen und den Be-
| | triebsartenumschalter auf C
stellen. Eine Klemme des
| | Ohmmeters wird an den Kontakt 1 (Leitung 28) der Uber-
| | gangskontaktleiste ÜKL 3, der zweite Anschluß an den
| | Kontakt 5 (Leitung 82) der Leiste KL 8 in Übereinstim-
| | mung mit dem Stromlaufplan angeklemmt. Bei allen an-
| | deren Kontakten der Leisten KL 7 und KL 8 darf kein
| | Durchgang sein.
| |
| | Wenn z. B. der zweite Anschluß des Ohmmeters, außer am
| | Kontakt 5 der Leiste 8, Durchgang am Kontakt 20 (Lei-
| | tung 57) der Leiste 7 anzeigt, so ist es ein Beweis dafür,
| | daß zwischen Verbindungen der zweiten und dritten Kon-
| | takte der I. und 11. Reihe der Leiste KL 6 des Betriebs-
| | artenumschalters ein Schluß liegt. Nach Durchprüfen der
| | Stromkreise, die an den Kontakt 1(Leitung 28) der Leiste
| | UKL 3 angeschlossen sind, müssen alle Kontakte ein-
| | schließlich des 27. dieser Leiste geprüft werden. Solch eine
| | Prüfung erfaßt alle Stromkreise des Chiffrators mit Aus-
| | nahme der Stromkreise der beweglichen Kontaktleisten
| | KL
. Für das Prüfen der Leisten KL
, ob ein Schluß
| | zwischen den Kontakten oder Drähten vorhanden ist, wird
| | das Ohmmeter verwandt. Dabei muß jeder Kontakt der 1.
| | oder 2. Reihe (Zählrichtung gleichgültig) nur einmal mit
| | einem Kontakt der 3. oder 4. Reihe Verbindung haben.
| |
Bei Betätigen einer | Unterbrechung des | Beispiel für das Aufsuchen einer Unterbrechung des
Taste läuft die Haupt- | Stromkreises des Elek- | Stromkreises, wenn der Betriebsartenumschalter auf Kc
welle des Schlüssel- | tromagneten des | steht.
gerätes an, aber der | Druckwerkes. |
Abdruck fehlt. | | Nehmen wir an, daß beim Drücken der Taste A
dieses
| | nicht abgedruckt wird. Ea ist notwendig, den Netzstecker
| | zu ziehen, den Netzschalter des Schlüsselgerätes in Stel-
| | lung EIN
zu bringen, den Stromartenschalter auf = zu
| | schalten. Den Stecker St 6 aus der Federleiste Hü 5 der
| | Grundplatte herausziehen. Die Taste A
drücken. Von
| | Hand aus den Elektromotor bis zum Schließen des Impuls-
| | drehen. Mit dem Ohmmeter bestimmen, welcher
| | Stift des Steckers mit dem Impulskontakt verbunden ist.
| | Der 2. Stift muß mit der gemeinsamen Leitung 28 Ver-
| | bindung haben, die gleichzeitig die gemeinsame Leitung
| | für die Wicklungen des Elektromagneten des Druckwerkes
| | ist. Wenn der Stromkreis des Elektromagneten nicht un-
| | terbrochen ist, so zeigt das Ohmmeter den Widerstand
| | der Wicklung des Elektromagneten an, der 450 Ohm be-
| | trägt. Wenn das Ohmmeter eine Unterbrechung des
| | Stromkreises anzeigt, ist es notwendig, das Ohmmeter an
| | den Stift des Schukosteckers zu klemmen, der an dem
| | Impulskontakt angeschlossen ist und Schritt für Schritt
| | den Stromkreis des Elektromagneten A
zu prüfen.
| |
Bei Einschalten des | Es ist kein Kontakt | Das Schlüsselgerät kippen und die Bodenplatte abnehmen.
Schlüsselgerätes | zwischen der Schelle | Die Schraube die in der Schelle sitzt, um 3-4 Gänge
brennt die Sicherung | und der Wicklung des | herausdrehen, die Schelle verschieben, die Kontaktstelle
2 A durch. | Widerstandes 32 (Abb. | zwischen Widerstandswicklung und Schelle säubern. Die
| 49), der in Serie mit | Schelle an ihren Platz rücken, festschrauben. Vor dem
| der Erregerwicklung | Einschalten des Schlüsselgerätes die Sicherung 2 A aus-
| des Elektromotors | wechseln und den Durchgang des Teiles des Widerstandes
| liegt, vorhanden. | prüfen, der im Stromkreis der Erregerwicklung liegt.
| |
Der Isolationswider- | Beschädigung der Iso- | Die Stelle des Gehäuseschlusses ist ohne Auftrennung der
stand ist gleich 0 oder | lation und Gehäuse- | elektrischen Verbindung zwischen den Baugruppen nicht
in der Größenordnung | schluß. | zu bestimmen.
bis zu Kiloohm und | | Es wird bei der Fehlereingrenzung empfohlen, folgender-
Gehäuseschluß. | | maßen vorzugehen :
| | Nachsehen, ob keine offensichtliche Beschädigung der
| | Isolation und damit ein Gehäuseschluß vorliegt. Die
| | Federleiste St 6 des Antriebes aus der Steckerleiste Hü 5
| | der Grundplatte herausnehmen und den Isolationswider-
| | stand der stromführenden Teile des Motors in Bezug auf
| | das Gehäuse prüfen. Der Elektromotor kann Ursache für
| | ein starkes Sinken des Isolationswiderstandes sein, wenn
| | sich das. Gemisch von Kohle- und Kupferstaub auf die
| | Isolationshülsen des Elektromotors absetzt.
| | Wenn der Elektromotor nicht die Ursache für das Sinken
| | des Isolationswiderstandes ist, ist es notwendig, den Chiff-
| | rator vom Schlüsselgerät abzunehmen und einzeln den
| | Isolationswiderstand am Chiffrator, an der Tastatur, an
| | der Leiste ÜKL 1, mit angeschlossener Leiste UKL 2 des
| | Druckwerkes zu prüfen.
| |
Der Netzstecker wird | Gehäuseschluß im | Filter herausnehmen, den Gehäuseschluß im Filter be-
in die Dose gesteckt. | Filter. | seitigen. Mit dem Ohmmeter den Isolationswiderstand
Die Netzsicherung | | prüfen.
brennt durch. | |
| |
Bei Betätigen einer | Die Auslösevorrich- | Die Einstellung der Bauteile der Auslösevorrichtung der
Taste läuft die Haupt- | tung ist gestört. | Hauptwelle überprüfen und unter Berücksichtigung des
welle nicht an. | | entsprechenden Abschnittes neu einstellen.
Die Hauptwelle läuft | |
durch. | |
| |
Bei Eingabe von Hand | Die Einstellung der | Die Einstellung der Sperrvorrichtung während des Wa-
werden die Tasten- | Sperrvorrichtung der | genrücklaufs prüfen und nach dem entsprechenden Ab-
hebe1 nach Wagen- | Tastatur ist fehlerhaft. | schnitt einstellen.
rücklauf nicht in der | |
unteren Stellung fest- | |
gehalten. | |
| |
Schwacher Abdruck | Die Spannung der | Die Druckerfeder muß eine Kraft aufweisen, durch die
der Zeichen auf dem | Druckerfeder ist zu ge- | die Rolle des Druckerhebels dem Profil des Nockens folgt,
Blatt. | ring. Der Abwurf- | ohne sich von ihm zu entfernen.
| bügel ist nicht richtig | Praktisch entfernt sich die Rolle des Druckerhebels beim
| eingestellt. | Übergang auf den kleineren Radius des Nockens. Das Ab-
| | laufen der Rolle auf dem Druckexzenter kann geprüft
| | werden,- indem man die Exzenteroberfläche mit einer
| | dünnen Fettschicht (0,5-1 mm) bestreicht und die Haupt-
| | welle für einen Arbeitszyklus anlaufen läßt. An Hand der
| | Spur, die die Rolle auf der Fettschicht hinterläßt, kann
| | man beurteilen, wie sie auf dem Nocken abläuft. Die
| | Spannung der Druckerfeder, bei der die Rolle in einem
| | maximalen Winkel abläuft, ist als optimal anzusehen. Ein
| | weiteres Spannen der Druckerfeder erhöht die Geschwin-
| | digkeit der Bewegung der Typenhebel nicht und schadet
| | den Bauteilen des Schlüsselgerätes. Die Druckerfeder-
| | Spannung muß in Stoppstellung der Hauptwelle des
| | Schlüsselgerätes in der Größenordnung von 6 kp liegen.
| | Die Einregulierung der Stärke der auf das Blatt gedruck-
| | ten Zeichen muß bei richtig gewählter Federspannung
| | dadurch erfolgen, daß die Stellung des Abwurfbügels ent-
| | sprechend dem Abschnitt Einstellung der Anschlagstärke
| | der Typenhebel
verändert wird.
| |
Die Schrittgruppen | Die Elektromagnete | Es ist eine Überprüfung gemäß Abschnitt Einstellung der
werden falsch in den | im Druckwerk sind | Ausgangsstellung der Freigabehebel
vorzunehmen.
Lochstreifen gestanzt. | falsch eingestellt. |
| |
| Die Einstellung des | Überprüfen nach Abschnitt Einstellung der Kombinator-
| Hebels zum Steuern | schienen
.
| der Schienen des Kom- |
| ist fehlerhaft. |
| |
Bei der Arbeit mit | Der Elektromagnet am | Störung in der elektrischen Schaltung mit Hilfe des Ohm-
Klartext und beim | Locher spricht nicht | meters und des Stromlaufplanes suchen.
Drücken auf die Taste | an. |
Wagenrücklauf
feh- | |
len auf dem Lochstrei- | |
fen die Schrittgruppen | |
Wagenrücklauf
und | |
Zeilenvorschub
. | |
| |
| |
Im Locher fehlt der | Die Stellung des He- | Nach Abschnitt Einstellung des Streifentransportes
ein-
Streifentransport. | bels zur Steuerung des | stellen.
| Streifentransport- |
| nebels ist nicht richtig |
| eingestellt. |
| |
Falscher Abstand zwi- | Die Streifentransport- | Die Stellung der Streifentransporttrommel nach Abschnitt
schen den Kombina- | trommel ist nicht | Einstellung des Schrittgruppenabstandes
verändern.
tionen auf dem | richtig eingestellt. |
Streifen. | |
| |
Die Farbbandgabel | Die Farbbandgabel ist | Die Farbbandgabel ist mit einer in Spiritus getauchten
bleibt in der oberen | verschmutzt. | Bürste zu säubern und anschließend zu ölen.
Stellung. | |
| |
Bei Arbeit mit Klar- | Einer oder mehrere | Prüfen, ob Abfühlhebel verklemmt sind und den Fehler
text (automatisch) | Abfühlhebel des | beseitigen.
entsprechen die auf | Transmitters arbeiten |
dem Blatt gedruckten | nicht. |
Zeichen nicht den | |
Schrittgruppen auf dem | |
Streifen, die durch die | |
Abfühlhebel des | |
Transmitters abgeta- | |
stet werden. | |
| |
Bei automatischer Ar- | Bruch der Feder am | In die Streifenführung des Transmitters einen Streifen
beit läuft die Haupt- | Schlagbügel, der auf | einlegen, auf den Knopf EIN
drücken und durch Drehen
welle nicht an. | den Hebel einwirkt, | des Elektromotors mit der Hand, feststellen, ob der Hebel
| der in die Aussparun- | in die Aussparungen der Schienen des Dekombinators ein-
| gen der Dekombina- | gefallen ist. (Vorher die Streifenführung abnehmen).
| torschienen einfällt. | Läuft die Hauptwelle des Schlüsselgerätes nicht an, ist die
| | vordere Schutzplatte des Transmitters abzunehmen und
| | zu überprüfen, in welchem Zustand sich die Feder des
| | Stoßbügels befindet.
| | Wenn der Hebel nicht in die Aussparungen der Schienen
| | des Dekombinators einfällt ist zu prüfen, ob er verklemmt
| | ist. Überprüfen, ob die Schienen des Dekombinators in die
| | Ausgangsstellung gehen, die im entsprechenden Abschnitt
| | der Beschreibung Einstellung des Aufzuges der Dekom-
| | binatorschienen
angeführt ist.
| |
Der Transmitter des | Fehlerhafte Einstel- | Die Einstellung auf Grund des entsprechenden Abschnit-
Dekombinators stoppt | lung der Sperrvor- | tes Einstellung des Transmitters beim Wagenrücklauf
nicht während des | richtung. | überprüfen.
Wagenrücklauf es oder | |
stoppt zu früh. | |
Nach Wagenrücklauf | |
läuft die Hauptwelle | |
nicht an. | |
| |
Beim Chiffrieren | Die Feder (12), Abb. | Die Feder auswechseln und die Einstellung der Zugstange
die Teilung des Ge- | 18, ist gerissen. | (7) überprüfen (Abb. 52).
heimtextes in Fünfer- | |
gruppen. | |
| |
Beim Chiffrieren hält | Im Chiffrator wird | Die Einstellung des Gummikissens
vornehmen.
die Hauptwelle nach | der Schlüssellochstrei- |
dem zweiten Arbeits- | fen nicht transportiert. |
zyklus an. | |
| |
1. D e f e k t e , d i e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m T r a n s m i t t e r u n d d e m D e k o m b i n a t o r a u f - t r e t e n 1.1. Ein Zeichen am Ende der Zeile fällt aus a) Die Zugstange (Abb. 49/10) hat sich verstellt. 1.2. Die Kombinationen werden verstümmelt a) Die Abfühlstifte klemmen. b) Die Feder (Abb.19/51) ist gebrochen oder ausgehangen. c) Die Schienen des Kombinators klemmen oder die Feder an den Schienen ist ausgehangen oder gebrochen. d) Der Aufzughebel (Abb. 19/41) hat sich verstellt. e) Der Schrittgruppenabstand des Transmitters hat sich verändert. 1.3. Bei Klartext werden keine Zeichen abgedruckt a) Die Feder (Abb. 19/53) ist ausgehangen oder gebrochen. 1.4. Der Transmitter wird bei Wagenrücklauf nicht abgeschaltet a) Die Zugstange (Abb. 19/34) hat sich verstellt. b) Die Zugstange (Abb. 19/26) ist ausgehangen. 2. E s l i e g t k e i n e S p a n n u n g a n a) Es liegt ein Drahtbruch im Anschlußkabel vor. b) Der Netzschalter gibt keinen Kontakt. c) Ein Kondensator im Filter ist defekt. d) Die Sicherung 2 A ist durchgebrannt. 3. D e r E l e k t r o m o t o r a r b e i t e t n i c h t a) Es liegt keine Spannung an. b) Zwischen Kohlebürste und Kollektor ist schlechter Kontakt. c) Der Kollektor ist stark verschmutzt. d) Die Kohlebürsten sind verklemmt. e) Der Fliehkraftregler ist geöffnet. f) Es liegt eine Unterbrechung im Stromkreis der Erreger- wicklung vor. g) Es liegt eine Unterbrechung im Stromkreis der Anker- wicklung vor. 4. D e f e k t e , d i e m i t d e m N i c h t a b d r u c k e n v o n Z e i c h e n z u s a m m e n h ä n g e n 4.1. Der Zeichenabdruck fehlt beiKDundCvollständig a) Die Sicherung 1 A ist durchgebrannt. b) Der Impulskontakt (IK) ist verschmutzt oder ständig ge- öffnet. c) Der Kupplungskontakt (KK) ist geöffnet oder verschmutzt. d) Der Kontakt am Betriebsartenumschalter ist geöffnet oder ver- schmutzt. e) Es liegt, ein Drahtbruch des gemeinsamen Leiters im Chiffrator, in der Tastatur, im Druckwerk oder in den Übergangskontaktleisten vor. 4.2. Der Abdruck von Zeichen fehlt beiDundCvollständig a) Die Kupplung am Chiffrator ist nicht richtig eingerastet - der Kupplungskontakt (KK) ist geöffnet. 4.3. Der Abdruck eines oder mehrerer Zeichen fehlt beiK,DundCa) Der Kontakt in der Übergangskontaktleiste (ÜKL) von der Tastatur zum Chiffrator und vom Chiffrator zum Druckwerk fehlt. b) Das Kunststoffmesser (Abb. 4/16) am Tastenhebel ist ab- gebrochen. c) Der Tastaturkontakt schließt nicht. d) Der Kontakt im Betriebsartenumschalter fehlt. e) Der Kontakt in der Übergangskontaktleiste der Grund- platte fehlt. f) Der Elektromagnet ist durchgebrannt oder erhält keinen Strom. g) Die Stange des Elektromagneten ist verbogen oder fest- gelaufen. h) Der Elektromagnet hat sich verstellt. i) Der Typenhebel hat sich verklemmt. j) Der Stoßhebel wird nicht freigegeben. k) Die Feder des Stoß- oder Freigabehebels ist gebrochen oder ausgehangen. 4.4. Der Abdruck eines oder mehrerer Zeichen fehlt beiDundCa) Es liegt ein Drahtbruch im feststehenden Teil des Be- triebsartenumschalters vor. b) Die Kontaktleisten sind verschmutzt. 4.5. Der Abdruck eines Zeichens fehlt nur in einer der 3 Betriebs- arten a) Der Flächenkontakt im feststehenden Teil des Betriebs- artenumschalters ist oxydiert. b) Es liegt eine Unterbrechung der Verbindung im Betriebs- artenumschalter vor. 4.6. Zwei Typenhebel schlagen gleichzeitig an a) Der Elektromagnet klebt. b) Der Freigabehebel klemmt. c) Ein Kontakt der Tastatur ist ständig geschlossen. 4.7. Einzelfälle, in denen der Zeichenabdruck fehlt a) Der Typenhebel hat zuviel seitliches Spiel. b) Die Tastatur ist nicht gut eingestellt, der Bügel (Abb. 4/17) nimmt die Gleitstücke schlecht mit. c) Der Elektromagnet klemmt. d) Schlechter Kontakt in der Tastatur. e) Schlechter Kontakt in der Übergangskontaktleiste. f) Schlechter Kontakt beim Kupplungskontakt (KK) oder am Kontakt des Betriebsartenumschalters. 5. D e f e k t e , d i e m i t d e r T a s t a t u r z u s a m m e n - h ä n g e n 5.1. Die Hauptwelle wird dauernd ausgelöst a) Die Feder (Abb. 2/38) des Auslösehebels ist gebrochen oder ausgehangen. b) Die Zugstange (Abb. 2/80) hat sich verstellt. c) Der kleine Auslösehebel (Abb. 2/39) klemmt. d) Der Bügel (Abb. 2/49) ist verbogen. e) Der Zahn des dreiarmigen Auslösehebels (Abb. 2/43) ist abgenutzt. 5.2. Die Tastatur wird während des Wagenrücklaufs nicht blockiert a) Der Dreizackhebel (Übertragungshebel) hat sich auf der Achse verdreht. b) Die Feder der Sperrschiene ist gebrochen oder aus- gehangen. c) Die Sperrschiene klemmt. d) Die Feder am Hebel (Abb. 21101) ist gebrochen oder aus- gehangen. 5.3. Es ist nicht möglich, eine Taste zu drücken a) Der linke dreiarmige Hebel des Tastaturaufzuges hat sich verstellt (der U-Bügel steht schief). b) Die Stifte auf den dreiarmigen Hebeln Sind abgenutzt (der U-Bügel steht schief). c) Die Spannstange zwischen den beiden dreiarmigen He- beln ist zu lang bzw. zu kurz. d) Der dreiarmige Hebel (Abb. 2/93), der bei Ende des Schlüssellochstreifens anspricht, hat sich verstellt. e) Die Feder an der 1. Sperrschiene der Tastatur ist aus- gehangen oder gebrochen. f) Die Sperrvorrichtung gegen ein gleichzeitiges Drücken von zwei oder mehreren Tasten ist nicht richtig ein- gestellt. 5.4. Die Kupplung an der Hauptwelle rastet nicht ein a) Die Auslösevorrichtung ist verstellt. b) Die große Feder (Abb. 2/57) am dreiarmigen Auslösehebel in der Tastatur ist gebrochen oder zu schlaff. 6. D e f e k t e , d i e m i t d e m A n t r i e b v e r b u n d e n s i n d a) Die L-förmige Spannstange (Abb. 16/12) hat sich verstellt. b) Die Stellschrauben des Dreizackhebels (Übertragungs- hebel) haben sich verstellt. c) Die Zahnkupplung für Wagenrücklauf schleift. d) Die Steuerstange der Wagenrücklauf -Kupplung hat sich verstellt. e) Die Schraube am Hebel mit dem Kunststoffklotz hat sich verstellt. f) Die Friktionskupplung arbeitet nicht richtig. 6.1. Nicht einwandfreies Arbeiten der Hauptwelle a) Die Feder des Feststellhebels ist gebrochen oder ausge- hangen. b) Die Zahnkupplung pfeift. c) Die Zahnkupplung ist defekt. 7. D e f e k t e i m D r u c k w e r k 7.1. Undeutlicher Abdruck des Zeichen a) Das Farbband ist abgenutzt. b) Die Typen sind verschmutzt. c) Die Farbbandumkehrung ist defekt. d) Der Typenhebel ist verbogen. e) Der Typenhebel hat im Führungskamm zu viel Spiel. f) Der Abwurfbügel ist nicht richtig eingestellt. g) Die Type hat sich auf dem Typenhebel gelockert oder verschoben. h) Die Druckerfeder ist zu schlaff (die Rolle drückt nicht fest genug auf den Nocken). 7.2. BeiBLwerden die Zeichen nicht richtig gestanzt a) Die Elektromagneten im Druckwerk haben sich verstellt. b) Eine der Federn an den Kombinatorschienen ist herunterge- sprungen oder gebrochen. c) Eine Schiene des Kombinators schleift oder die Auflagestücke des Lochers klemmen. 7.3. Die Farbbandumschaltung funktioniert nicht a) Die Fähnchen, die auf die Farbbandrolle drücken, haben sich verstellt. b) Das Kegelrad vom Farbbandantrieb hat sich gelockert und verstellt. 8. D e f e k t e , d i e m i t d e m L o c h e n z u s a m m e n - h ä n g e n 8.1. Der Schrittgruppenabstand beträgt nicht 2,54 mm a) Die Streifentransporttrommel hat sich verstellt. b) Die Feder des Rasthebels am Streifentransportrad ist gebrochen oder ausgehangen. c) Der Streifenvorschub ist nicht richtig eingestellt. d) Der Streifen stößt an die Führung an. e) Die Streifentransporttrommel schleift. Die Achse hat sich seitlich verschoben. f) Der Papierandruckhebel drückt zu stark oder zu schwach auf die Transporttrommel. g) Die Stellschrauben, die den Streifenvorschub bei Wagen- rücklauf, Zeilenvorschub und Zwischenraum steuern, haben sich verstellt. h) Der Exzenter des Bügels (Abb. 21/27) hat sich verstellt. i) Der Hebel (Abb. 21/26) hat sich verstellt (Wagenrücklauf und Zeilenvorschub werden beim Drücken der Wagenrücklauftaste nicht richtig gestanzt). j) Die Lochstreifenvorratsrolle ist falsch eingelegt. k) Es ist dünneres bzw. dickeres Lochstreifenpapier eingelegt worden. 8.2. Die Löcher werden schlecht in den Streifen gestanzt a) Der Bügel, der die Stanzstifte zurückführt, hat sich verstellt. b) Der Papierabfallkasten ist voll. c) Der Streifen schleift in der Papierführung. d) Die Stanzstempel sind stumpf. e) Die Stanzstempel klemmen in der Führung. 8.3. Keine richtige Gruppenteilung im hergestellten Geheimtextstreifen a) Die Stoppstellung des Rastrades (Abb. 21/6) ist nicht richtig eingestellt. b) Der HebelTeilungsteht in einer Zwischenstellung. c) Die Bügel mit den Auflagestücken für die Steuerkombi- nationen haben sich verstellt. d) Die Schaltklinke (Abb. 21/48) des Zeichenzählwerkes hat sich verstellt. e) Die Rastklinke (Abb. 21/3) für den Antrieb des Zähl- werkes ist abgenutzt. f) Der Streifenvorschub ist nicht richtig eingestellt. 9. D e f e k t e , d i e m i t d e m W a g e n v e r b u n d e n s i n d 9.1. Die Zeichen werden übereinander geschrieben a) Die Wagenfortschaltung ist nicht richtig eingestellt. b) Die Spiralfeder (Abb. 16/7) ist nicht straff genug auf- gezogen oder gebrochen. c) Das Zahnrad des Rollenkäfigs hat sich verbogen oder ist verschmutzt. d) Die Rastklinken (Abb. 16/39, 40) schleifen oder sind verschmutzt. e) Die Zahnräder (Abb. 16/9, 10, 11) sind festgelaufen. 9.2. Der Wagen geht nicht auf das erste Zeichen zurück a) Die Feder der Rastklinke (Abb. 16/39, 40) ist schlaff geworden. b) Der erste Zahn der Zahnstange (Abb. 16/41) ist abgenutzt. c) Die Blockierung der Wagenfortschaltung während des Wagenrücklaufes hat sich verstellt (Bügel Abb. 25/20, 22). 9.3. Der Wagentransport wird nicht eingeschaltet a) Die Hebel für die Wagenfortschaltung in der Grundplatte haben sich verstellt. b) Die Zugstange für die Wagenfortschaltung in der Grund- platte ist verklemmt. 9.4. Falsche Gruppenteilung des Textes a) Die Zahnstange für die Gruppenteilung am Wagen hat sich verstellt oder ist verbogen. b) Die Feder des Wagenauslösebügels ist heruntergesprungen. c) Die Spannstange (Abb. 52/7) oder der Hebel (Abb. 52/2) für die Einstellung der Gruppenteilung sind verstellt bzw. verbogen. 9.5. Kein richtiger Zeilentransport a) Die Gummiwalze schleift. b) Die Papierandruckwalzen schleifen. c) Der Sektor (Abb. 16/27) für den Zeilentransport hat sich verstellt. 10. D e f e k t e , d i e m i t d e m C h i f f r a t o r v e r b u n d e n s i n d 10.1. Das Schlüsselgerät wird beiCblockiert a) Der Exzenter am Gummikissen hat sich verstellt. b) Der Hebel (33/14) schleift. c) Der schwarze Bolzen (Abb. 34/27) ist verklemmt. d) Die Feder am Abfühlhebel, der das Steuerloch beim Schlüssellochstreifen abfühlt, ist heruntergesprungen. e) Die Feder am Hebel (Abb. 33/39) ist zu straff. f) Das Gummikissen ist abgenutzt oder durch Öl zersetzt. 10.2. Der Schlüssellochstreifen wird im Transportloch eingerissen a) Konfetti ist unter den Deckel gekommen. b) Der Stanzstempel ist stumpf. c) Die gerändelte Rolle am Chiffratordeckel schleift. d) Die Exzenter der Streifenführung haben sich verstellt oder gelockert. 10.3. Das Schlüsselgerät blockiert beiCundDa) Der Aufzug der Sperrvorrichtung des Chiffrators hat sich verstellt. b) Der dreiarmige Hebel, der die 2. Sperrschiene steuert, hat sich verstellt. c) Die 2 Stützschrauben unter der Tastatur sind zu stark an- gezogen.
| VIII. Vorschrift für das Ausfüllen |
| von Reparaturscheinen |
1. Allgemeines Ein Reparaturschein wird nach der Beendigung einer Reparatur bzw. nach Wartung lt.Wartungsanweisung für das Schlüsselgerät CM-2mit Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Tinte (in Blockschrift) aus- gefüllt. Die Eintragung in den Reparaturschein nimmt der Mechaniker vor, der die Reparatur durchgeführt hat. Ein Reparaturschein wird nicht ausgefüllt für Arbeiten, die unter Punkt 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. in der Wartungsanweisung angeführt sind. Der Mechaniker, der die Reparatur ausführt, ist verantwortlich dafür, daß der ausgefüllte Reparaturschein an den Leiter des Reparatur- dienstes des MfS geschickt wird. Verschriebene oder ungültig gemachte Reparaturscheine werden durchgestrichen und wie die gültigen Reparaturscheine an den Leiter des Reparaturdienstes des MfS geschickt. 2. Der Aufbau des Reparaturscheines 2.1. Gerätenummer: Die Nummer des Gerätes, an dem (Maschinen-Nr.) die Reparatur durchgeführt wurde 2.2. Dienststelle: Die Nummer der Dienststelle, der das zu reparierende Schlüsselge- rät gehört 2.3. Mechaniker : Die Nummer des Mechanikers, der die Reparatur durchgeführt hat 2.4. Benötigte Stunden: Die Anzahl der Stunden, die zur vollständigen Reparatur ein- schließlich Fehlersuche benötigt wurden 2.5. Datum: Der Tag, an dem die Reparatur durchgeführt beziehungsweise begonnen wurde 2.6. Zählerstand: Es wird der Zählerstand eingetragen, der zum Zeitpunkt der Reparatur angezeigt wird 2.7. Maschinentyp: Es wird eine dreistellige gerätegebundene Nummer angegeben. Diese Nummer wird vom Repara- turdienst des MfS festgelegt 2.8. Fehler: 2.8.1. Baugruppe: Baugruppe, in der die Fehlerursache festgestellt wurde 2.8.2. Fehlernummer: Diese fünf stellige Nummer wird aus den beiden Tabellen zusam- mengestellt a) Benummerung der Teile b) Benummerung der Fehler z. B. 067130 2.9. Ersatzteile: 2.9.1. Nummer: Diese Nummern sind aus der Ersatzteilliste zu entnehmen 2.9.2. Stück: Die Anzahl der verbrauchten Er- satzteile 2.10. Art des Fehlers: Es wird aufgeführt, in welcher Art und Weise der Fehler auftritt und wie er sich auswirkt 2.11. Behebung des Fehlers: Es wird die genaue Behebung des Fehlers beschrieben 3. Benummerung der Baugruppen 00 Gesamtes Schlüsselgerät 07 Locher 01 Chiffrator 08 Druckwerk 02 Tastatur 09 Wagen 03 Transmitter 10 Filter 04 Dekombinator 11 Antrieb 05 Stromversorgung 12 Grundplatte 06 Automatikantrieb 13 Gehäuse mit Konzepthalter 4. Benummerung der Teile 001 Abfühlstift 038 Elektromagnet 002 Abfallkasten 039 Exzenter 003 Anschlag 040 Exzenterschraube 004 Anschluß 041 005 Andruckrollen 042 006 Ansatzstück 043 007 Auflagestück 044 008 Auslöserahmen 045 Farbband 009 Achse 046 Farbbandgabel 010 Ansatzschraube 047 Farbbandführung 011 Aufhängung 048 Farbbandumschalter 012 049 Federkontakt 013 050 Führungszylinder 014 051 Führungsprismen 015 Bedienungshebel 052 Filzscheibe 016 Bedienungsknopf 053 Finger 017 Blattführung 054 Fliehkraftregler 018 Bolzen 055 Führungskamm 019 Bügel 056 020 Buchse 057 Gehäuseschluß 021 Benzing 058 Gewinde 022 059 Gleitlager 023 060 Gummikissen 024 061 Gummiwalze 025 Chiffratordeckel 062 Gehäuse 026 Chiffratorklappe 063 Gewindestift 027 064 Gleitstück 028 065 Gruppenzähler 029 Diode 066 Haltedraht 030 Draht 067 Hebel 031 Drehfeder 068 Halterung 032 Druckfeder 069 033 070 034 071 Impulskontakt 035 072 Isolation 036 073 037 074 113 075 Kabelschuh 114 Nocke 076 Kardanwelle 115 077 Kardangabel 116 078 Kegelrad 117 079 Klinke 118 080 Kohlebürste 119 Ölfilz 081 Kollektor 120 Öse 082 Kontakt 121 083 Kondensator 122 084 Kontaktleiste 123 085 Konzepthalter 124 Papier 086 Kupplung 125 Papierführung 087 Kugellager 126 Papierführungskanal 088 Kugellagersitz 127 Papierandruckwalze 089 Kugel 128 090 Kurbel 129 091 Klemmring 130 092 Kunststoffmesser 131 093 Kombinatorschiene 132 094 Kegelstift 133 Riegel 095 134 Rolle 096 135 Rollenkäfig 097 Lederstreifen 136 098 Lochabstand 137 099 Lötstelle (kalte) 138 100 Lötleiste 139 101 Lagerschale 140 Schraube 102 Leiste 141 Schraubenschlitz 103 142 Schalter 104 143 Schaltrad 105 144 Schlagbügel 106 Motor 145 Scheibe 107 Motordrehzahl 146 Schnecke 108 Mutter 147 Sicherung 109 110 111 112 148 Sicherungselement 186 149 Spannungswahlschalter 187 150 Sperrschiene 188 151 Spiralfeder 189 Wagenrücklauf 152 Spule 190 Wählschiene 153 Stift 191 Welle 154 Stanzstempel 192 Widerstand 155 Stanzmatrize 193 Wicklung 156 Streifentransportrad 194 Winkel 157 Stecker 195 Winkelhebel 158 Stoßdämpfer 196 159 Stange 197 160 Stiftrad 198 161 Sektor 199 162 Stanzbügel 200 Zahnrad 163 Stufenklotz 201 Zahnstange 164 Schlüsselgerät 202 Zählwerk 165 Schiebestück 203 Zugstange 166 204 Zugfeder 167 205 Zählscheibe 168 Tastaturkontakt 206 Zylinderstift 169 Taste 207 170 Tastenhebel 208 171 Transmitterdeckel 209 172 Transmitterklappe 210 173 Trommel 211 174 Trafo 212 175 Type 213 176 Typenhebel 214 177 Transportrad 215 178 216 179 217 180 218 181 219 182 U-Rahmen 220 183 184 185 Voltmeter 221 236 222 237 223 238 224 239 225 240 226 241 227 242 228 243 229 244 230 245 231 246 232 247 233 248 234 249 235 250 5. Benummerung der Fehler 01 abgebrochen 36 02 abgenutzt 37 03 abgeschert 38 (zu) hoch 04 angerostet 39 (zu) klein 05 ausgehangen 40 06 ausgelaufen 41 07 ausgelötet 42 08 43 09 44 10 45 11 beschädigt 46 12 47 13 48 14 49 schief 15 50 schleift 16 defekt 51 (zu) schlaff 17 durchgebrannt 52 (zu) straff 18 durchgeschlagen 53 19 durchgeschliffen 54 20 55 21 56 22 eingerissen 57 taub 23 58 (zu) tief 24 falsch justiert 59 25 fehlt 60 26 festgelaufen 61 27 falsch eingebaut 62 überdreht 28 63 unregelmäßig 29 64 überlastet 30 gebrochen 65 31 gelockert 66 32 gelöst 67 verbogen 33 geölt (zu stark) 34 gereinigt 35 (zu) groß 68 verklemmt 85 69 verschmort 86 70 verschmutzt 87 71 verstellt 88 72 verstopft 89 73 verzogen 90 74 91 75 92 76 93 77 94 78 95 79 96 80 97 81 98 82 99 83 84
| IX. Aufstellung und Lagerung des Schlüssel- |
| gerätes CM-2 |
1. Aufstellung der in Betrieb befindlichen Schlüsselgeräte CM-2
1.1. Die, Aufstellung der in Betrieb befindlichen Schlüsselgeräte ist
nur in Räumen vorzunehmen, für die ein Temperaturbereich
von + 2 Grad C bis höchstens + 50 Grad C bei einem relativen
Luftfeuchtigkeitsgehalt von höchstens 90% gewährleistet ist.
1.1.1. Ist der Punkt 1.1. bei der Aufstellung der Schlüsselgeräte in
motorisierten Chiffrierstationen nicht gewährleistet, so be-
dürfen die Schlüsselgeräte einer häufigeren Kontrolle und
Wartung.
1.2. Die Schlüsselgeräte sind prinzipiell
a) vor Eindringen von Staub, vor Verschmutzung, sowie vor
Feuchtigkeit und
b) vor Stoß und starken Erschütterungen
zu schützen.
1.2.1. In Betrieb befindliche Schlüsselgeräte sind während der Ar-
beitspausen mit der dazugehörigen Kunststoffhaube abzu-
decken.
1.2.2. In Betrieb gewesene Schlüsselgeräte, mit denen längere Zeit
nicht gearbeitet wird (z. E. Ersatzschlüsselgeräte), sind mit ge-
schlossener Kunststoffhaube in dem dazugehörigen Transport-
kasten unterzubringen.
Diese Schlüsselgeräte sind vorher sorgfältig auf ihre Einsatz-
bereitschaft zu überprüfen - Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
sind zu entfernen - und das Gerät ist abzuölen.
Die Geräte können im Arbeitsraum verbleiben oder in Räumen
mit gleichen Bedingungen abgestellt werden.
2. Anforderungen an den Lagerraum
2.1. Der Lagerraum ist mit einem Hygrometer und einem Thermo-
meter auszustatten.
Die relative Luftfeuchtigkeit soll 45-70 % und die Temperatur
+ 10 bis + 30 Grad C betragen.
2.2. Heizkörper bzw. Ofen müssen von den gelagerten Teilen einen
solchen Abstand haben, daß ein schädlicher Einfluß aus-
geschlossen ist.
Bei Ofenheizung muß der Ofen so aufgestellt werden, daß die
Heizung und die Reinigung des Ofens von einem anderen Raum
aus erfolgen kann.
2.3. Der Lagerraum muß gelüftet werden können. Die zu lagernden
Teile sind im Raum so unterzubringen, daß durch Zugluft kein
schädlicher Einfluß auf die zu lagernden Teile ausgeübt wird,
2.4. Der Lagerraum soll einen Vorraum besitzen, dessen Tempera-
tur im Winter höher als die Außentemperatur, aber niedriger
als die Temperatur des Lagerraumes ist.
2.5. Der Lagerraum ist mit Kastenregalen für die Lagerung und mit
Tischen für das Sichten der eingehenden Ersatzteile auszu-
statten.
Die Regale sind aus trockenem Holz zu fertigen.
2.6. Im Lagerraum und in seiner unmittelbaren Nähe dürfen keine
Laugen, Säuren und ähnliche Chemikalien, bzw. keine Akku-
mulatoren auf Säure- oder Laugebasis gelagert werden.
Sanitäre Anlagen sollen möglichst weit vom Lagerraum ent-
fernt sein.
2.7. Der Lagerraum muß gut beleuchtet sein.
3. Regeln für die Lagerung der Ersatzteile
3.1. Die zur Lagerung eingehenden Ersatzteile sind solange im
Lagervorraum zu belassen, bis gewährleistet ist, daß sich die
Temperatur der Ersatzteile der Temperatur des Vorraumes an-
gepaßt hat.
3.2. Staub und Schmutz sind von der Verpackung im Lagervorraum
zu entfernen.
3.3. Die Ersatzteile sind so zu lagern, daß sie vor Verstaubung und
Feuchtigkeit geschützt sind und nicht beschädigt werden
können.
3.4. Ersatzteile, die für längere Zeit gelagert werden, sind nach je-
weils 6 Monaten zu überprüfen.
Anzeichen von Korrosion sind zu beseitigen und die Teile neu
einzufetten.
| X. Vorschrift über die Anwendung des Materialanforderungs- |
| und -ausgabescheines |
1. Allgemeines Bei Anforderung bzw. Ausgabe von Ersatzteilen wird der Ma- terialanforderungs- bzw. -ausgabeschein in dreifacher Aus- fertigung ausgefüllt. Der Zweck dieser Scheine besteht darin, daß ein Nachweis über ausgegebene Ersatzteile geführt werden kann. 2. Handhabung des Materialanforderungs- und -ausgabescheines Dieser Schein ist nur mit Schreibmaschine oder mit Kugel- schreiber in Blockschrift auszufüllen. Das Original ist in Schwarzdruck, der erste Durchschlag ist in Gründruck und der zweite Durchschlag in Rotdruck ausgeführt. 2.1. Anforderung des Bereichslagers an das Hauptlager Bei Ersatzteilbedarf wird eine Anforderung in dreifacher Aus- fertigung geschrieben. Das Original und der erste Durchschlag werden an das Hauptlager des Reparaturdienstes des MfS ge- schickt. Der zweite Durchschlag verbleibt bei der ausfertigen- den Stelle. Nach Bearbeitung der Anforderung schickt das Hauptlager die Ersatzteile mit dem jetzt als Lieferschein fun- gierenden ersten Durchschlag an das Bereichslager zurück, während das Original beim Hauptlager des MfS verbleibt. Kann nur ein Teil der Bestellung realisiert werden, so nennt das Hauptlager des MfS auf dem ersten Durchschlag in der SpalteBemerkungeinen neuen Liefertermin oder ein an- deres Lager, an das sich das Bereichslager wenden kann. Sind die Ersatzteile und der erste Durchschlag beim Bereichs- lager eingetroffen, wird unter Bezugnahme auf die Nummer des Scheines telefonische Empfangsbestätigung an das Aus- lieferungslager gegeben. 2.2. Anforderung eines Bereichslagers an ein anderes Bereichslager Eine Anforderung eines Bereichslagers an ein anderes Bereichs- lager darf nur dann ausgeführt werden, wenn das Hauptlager beim MfS nicht liefern kann und von diesem der Hinweis ge- geben wurde, sich an ein bestimmtes anderes Bereichslager zu wenden. Die Anforderung wird ebenfalls in dreifacher Ausfertigung geschrieben. Das anfordernde Bereichslager schickt das Origi- nal und den ersten Durchschlag an das liefernde Bereichslager. Der zweite Durchschlag verbleibt beim anfordernden Bereichs- lager. Das liefernde Bereichslager schickt die Ersatzteile mit den als Lieferschein fungierenden ersten Durchschlag an die anfordernde Stelle zurück. Das Original der Anforderung wird vom liefernden Bereichslager mit einem Vermerk der voll- zogenen Auslieferung an das Hauptlager des MfS geschickt. Das Hauptlager entlastet das liefernde Bereichslager durch eine schriftliche Empfangsbestätigung. Das anfordernde Be- reichslager bestätigt telefonisch dem liefernden Bereichslager den Empfang der Ersatzteile. 2.3. Anforderung des Chiffreur-Mechanikers an das Bereichslager Die Anforderung erfolgt sinngemäß in der gleichen Form wie die Anforderung des Bereichslagers an das Hauptlager, nur ver- bleibt jetzt das Original beim Bereichslager. 3. Ausfül1en des Materialausgabescheines 3.1. BeiDienststellewird der Absender des Scheines eingetragen. 3.2.Anenthält die Adresse der angeschriebenen Dienststelle. 3.3. UnterLaufende Nummer(Lfd. Nr.) erfolgt die Numerierung der angeforderten Ersatzteile. 3.4. BeiBezeichnungwird der Name des angeforderten Gegen- standes eingetragen. Ist die Ersatzteilnummer unbekannt, wird hier die Zeichnungs- und Positionsnummer eingetragen. (z. B. 20/15) 3.5. In der SpalteErsatzteilnummerwird die genaue Nummer des angeforderten Teiles lt. Ersatzteilliste T 301 E1 eingetragen. 3.6. Die benötigte Stückzahl wird unterStück benötigtein- getragen. 3.7. Die ausgelieferte Anzahl wird in SpalteStück gelieferteingetragen. 3.8. Die SpalteBemerkungist besonderen Angaben vorbehalten. (Siehe 2.1.) 3.9. In der SpalteErhaltenquittiert der Abholende den Empfang der Ersatzteile und in der nebenstehenden Spalte wird das Empfangsdatum angegeben. 3.10. In der SpalteAusgegebenunterschreibt der Ausgebende und in der nebenstehenden Spalte wird das Ausgabedatum ein- getragen. 3.11. Die SpalteLeiter des Reparaturdiensteswird vom jeweiligen Leiter des Reparaturdienstes der absendenden Dienststelle unterschrieben.
| I N H A L T S V E R Z E I C H N I S |
| Das Schlüsselgerät CM-2 |
1. Allgemeine Hinweise
2. Aufbau des Schlüsselgerätes CM-2
2.1. Baugruppen des Schlüsselgerätes CM-2
I. Beschreibung der Baugruppen des Schlüsselgerätes
1. Tastatur
1.1. Tastenhebel
1.2. Auslösevorrichtung
1.3. Sperrvorrichtungen
1.3.1. Auslösesperre
1.3.2. Sperrung der Tastatur während des automatischen
Wagenrücklaufes
1.3.3. Sperrung der Tastatur, wenn bei K
im Chiffrator
ein Schlüssellochstreifen eingelegt wird
1.3.4. Sperrung der Tastatur, wenn im Chiffrator der
Schlüssellochstreifen zu Ende ist
1.3.5 Sperrung der Tasten Zwischenraum, Wagenrücklauf
und X
1.4. Wagenrücklauftaste
1.5. Zwischenraumtaste
2. Transmitter
2.1. Hauptwelle des Transmitters
2.2. Auslösevorrichtung
2.3. Abfühlvorrichtung
2.4. Streifentransportvorrichtung
2.5 Sperrvorrichtungen
2.5.1. Das Anhalten des Transmitters für die Zeit des
Zeilenvorschubs und Wagenrücklaufes
2.5.2. Das Anhalten des Transmitters, wenn im Schlüssel-
lochstreifen eine 32. Kombination erscheint
2.5.3. Blockieren des Transmitters bei Erscheinen der 32.
Kombination
3. Dekombinator
4. Locher
4.1. Eingabe und Lochen der Fünferschrittgruppen
4.2. Zeichenzähler mit Zwischenraumgeber
4.2.1. Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraum-
geber beim Chiffrieren
4.2.2. Automatisches Lochen von Zwischenraum
4.2.3. Automatisches Lochen von WR und Zeilenvorschub
4.3. Streifentransport
4.4. Abschalten des Zeichenzählers mit Zwischenraum-
geber
4.5. Arbeit des Zeichenzählers mit Zwischenraumgeber,
wenn die Taste WR/ZV gedrückt wird
5. Automatikantrieb
5.1. Steuerung der Start-Stopp-Kupplung des Lochers
5.2. Einschalten des Lochers für Dauerauslösung des
Streifentransportes
5.2.1. Betätigen des Knopfes für Dauerauslösung ZW
beim Chiffrieren
5.3. Einschalten des Lochers zum Lochen der 32. Kom-
bination
5.4. Start-Stopp-Kupplung des Lochers
6. Chiffrator
6.1. Antrieb
6.1.1. Benutzung der Kurbel
6.1.2. Benutzung der Kurbel beim Dechiffrieren
6.1.3. Der Kupplungskontakt (KK
)
6.2. Kontaktleisten (KL
)
6.3. Transmitter des Chiffrators
6.3.1. System der Bauteile, die in jedem Zyklus arbeiten
6.3.2. System der Bauteile, die beim Umschalten des Be-
triebsartenumschalters arbeiten
6.3.3. Konstruktive Ausführung des Transmitters
6.4. Verstellungssysteme der Kontaktleisten KL
ent-
sprechend den Schlüsselkombinationen
6.5. Sperrung der Tastenhebel und Anhalten des Trans-
mitters mit Dekombinator bei Ende des Schlüssel-
lochstreifens
6.6. Verhinderung der Überschlüsselung nur mit einer
Kombination des Schlüssellochstreifens bei Störung
des normalen Streifentransportes
6.7. Verhinderung von Fehlern des Nachrichtensachbe-
arbeiters beim Benutzen des Schlüssellochstreifens
6.7.1. KSV
, die die Möglichkeit der Arbeit an dem
Schiüsselgerät mit Klartext bei eingelegtem Schlüs-
sellochstreifen verhindern
6.7.2. KSV
, die doppeltes Benutzen eines Schlüssel-
lochstreifens ausschalten
6.7.3. KSV
, die die Möglichkeit des Chiffrierens mit
einem Schlüssellochstreifen, der für die Dechiff-
rierung bestimmt ist, ausschließt
6.8. Auslösen der Hauptwelle des Schlüsselgerätes beim
Umschalten des Betriebsartenumschalters von K
auf D
6.9. Verhinderung der Wagenfortschaltung beim Um-
schalten von K
auf D
6.10. Sperrung des Gruppenzählers beim Umschalten des
Betriebsartenumschalters von K
auf D
6.11. Betriebsartenumschalter
6.12. Gruppenzähler
7. Gehäuse mit Konzepthalter
8. Antrieb
8.1. Elektromotor SL-369 uA 1
8.2. Hauptwelle des Schlüsselgerätes
8.3. Start-Stopp-Kupplung
8.4. Wagenrücklaufwelle
8.4.1. Aufbau der Wagenrücklaufwelle
8.4.2. Steuerung der Kupplung der Wagenrücklaufwelle
8.5. Zähler für die Arbeitszyklen des Schlüsselgerätes
8.6. Impulskontakt IK
9. Wagen
9.1. Aufbau des Wagens
9.2. Papierführung
9.3. Wagenfortschaltung
9.3.1. Wagenfortschaltung bei der Einteilung in Fünfer-
gruppen
9.4. Zeilenvorschub der Schreibwalze
10. Druckwerk
10.1. Exzenterantrieb
10.2. Abdruck eines Zeichens auf Blatt
10.3. Steuerung des Lochers durch den Kombinator
10.4. Farbbandgabel
10.5. Farbbandtransport und Farbbandumkehrung
10.6. Zusatzvorrichtungen für die Arbeit des Druckwer-
kes bei den einzelnen Betriebsarten
11. Grundplatte
12. Stromversorgung
13. Filter
14. Die elektrischen Bauteile der Baugruppen
14.1. Elektrische Bauteile der Stromversorgung
14.2. Elektrische Bauteile der Grundplatte
14.3. Elektrische Bauteile des Antriebes
14.4. Elektrische Bauteile der Tastatur
14.5. Elektrische Bauteile des Druckwerkes
14.6. Elektrische Bauteile des Chiffrators
14.7. Elektrische Bauteile des Filters
15. Stromlaufplan
15.1. Stromkreis der Primärwicklung des Transfor-
mators (Tr 1)
15.1.1. Stromkreis der Sekundärwicklung des Transfor-
mators (Tr 1)
15.2. Stromkreis des Elektromotors (M 1) bei Anschluß
an ein Gleichstromnetz
15.3. Stromkreis im Druckteil des Schlüsselgerätes bei
Anschluß an eine Wechselstromquelle
15.4. Stromkreis im Druckteil des Schlüsselgerätes bei
Anschluß an eine Gleichstromquelle
15.5. Stromverlauf bei Klartext
15.6. Stromverlauf beim Chiffrieren
15.7. Stromverlauf beim Dechiffrieren
15.8. Stromverlauf beim Drücken der Wagenrücklauf-
taste
15.9. Stromverlauf beim Auslösen des Lochers vom
Knopf Dauerauslösung Zwischenraum
16. Zeitdiagramm des Schlüsselgerätes CM-2
17. Inbetriebnahme des Schlüsselgerätes
18. Drehzahlregelung der Hauptwelle des Schlüssel-
gerätes
II. Wartungsanweisung für das Schlüsselgerät
1. Allgemeines
1.1 Hinweise bei der Bedienung des Schlüsselgerätes
1.2. Auswechseln der Lochstreifenvorratsrolle
1.3. Reinigen der Typen
1.4. Wechseln des Farbbandes
2. Zeitplan für die Wartung
2.1. Tägliche Kontrollstelle
2.2. Ölstellen an den Bauteilen
2.3. Reinigen des Kontaktes des Fliehkraftreglers
2.4. Reinigen des Sicherheitskontaktes des Betriebs-
artenumschalters und des Kupplungskontaktes des
Chiffrators
2.5. Reinigen des Kontaktes für Dauerauslösung Zwi-
schenraum
2.6. Impulskontakt
2.7. Kontakte der Tastatur
2.8. Übergangskontaktleisten
2.9. Kontaktleisten des Chiffrators und Betriebsarten-
umschalters
2.10. Pflege des Elektromotors SL-369 uA 1
2.11. Auswechseln der Kohlebürsten
2.12. Pflege der Elektromagnete
2.13. Regeln für das Abschmieren
2.14. Schmierung des Druckwerkes
2.15. Schmierung des Antriebes
2.16. Schmierung des Transmitters mit Dekombinator
2.17. Schmierung des Automatikantriebes
2.18. Schmierung der Teile der Grundplatte und der
Tastatur
2.19. Schmierung des Lochers
2.20. Schmierung des Chiffrators
2.21. Schmierung des Wagens
3. Instandhaltung des Schlüsselgerätes
III. Demontage und Montage des Schlüsselgerätes
Demontage
1. Allgemeines
2. Gehäuse
3. Wagen
3.1. Ausbau der Gummiwalze
3.2. Ausbau der Spiralfeder
3.3. Abnehmen des Wagenoberteils
4. Stromversorgung
5. Chiffrator
5.1. Abbau des Antriebes des Chiffrators
5.2. Abbau des Kommutators
5.3. Ausbau der Abfühleinrichtung des Chiffrators
5.4. Auswechseln der Abfühlstifte des Chiffrators
6. Tastatur
6.1. Ausbau eines Tastenhebels
7. Transmitter mit Dekombinator
7.1. Ausbau der Start-Stopp-Kupplung
7.2. Auswechseln der Abfühlstifte
7.3. Abbau des Dekombinators vom Transmitter
8. Locher
8.1. Auswechseln der Stanzstempel
9. Automatikantrieb
9.1. Ausbau der Start-Stopp-Kupplung
10. Antrieb
10.1. Ausbau und Auseinandernehmen der Hauptwelle
10.2. Ausbau und Auseinandernehmen des Motors
10.3. Ausbau des Auslösehebels der Hauptwelle
10.4. Ausbau der Wagenrücklaufwelle
11. Druckwerk
11.1. Ausbau eines Typenhebels
11.2. Ausbau eines Stoßhebels
11.3. Ausbau eines Freigabehebels
12. Filter
Montage
1. Einbau des Druckwerkes
2. Einbau des Antriebes
3. Einbau des Automatikantriebes
4. Einbau des Lochers
5. Einbau des Transmitters mit Dekombinator
6. Einbau der Tastatur
7. Einbau des Chiffrators
8. Einbau der Stromversorgung
9. Einsetzen des Wagens
IV. Einstellung des Schlüsselgerätes
1. Einstellung des Tastatur
1.1. Einstellung des Anfangsdruckes der Tastenhebel
1.2. Einstellung der Rollensperre
1.3. Einstellung des Auslöserahmen
1.4. Einstellung des Auslösehebels
1.5. Einstellung des U-Rahmen
1.6. Einstellung des U-Rahmen in der Ausgangslage
1.7. Einstellung des Hubes des U-Rahmen
1.8. Einstellung des Hebels (ZO), Abb. 55
1.9. Einstellung der I. Sperrschiene
1.10. Einstellung der Zwischenraumtaste
1.11. Einstellung der Taste Wagenrücklauf/Zeilen-
vorschub
1.12. Einstellung der 11. Sperrschiene
1.13. Einstellung der Zugstange, di den Transmitter bei
Erschienen der 32. Kombination im Chiffrator ab-
schaltet
2. Einstellung des Lochers
2.1. Einstellung des Hubes der Stanzstempel
2.2. Einstellung des Begrenzungsbügels der Zugstangen
2.3. Einstellung des Streifentransportes
2.4. Einstellung des Schrittgruppenabstandes
2.5. Einstellung des Abstandes der Rastklinke (3) vom
Zahnrad (4)
2.6. Einstellung der Auflagestücke beim Betätigen der
Taste Wagenrücklauf/Zeilenvorschub
2.7. Einstellung der Schaltklinke (48) für den Zählwerk-
transport
2.8 Einstellung des Bügels (16)
2.9. Einstellung der Ausgangsstellung der Auflage-
stücke für die Steuerkombinationen und der An-
fangsstellung des Sektors für den Streifentransport
2.10. Einstellung der Ansatzstücke des Zeichenzählwer-
kes beim Lochen der ersten 49 Zeichen jeder Ge-
heimtextzeile
2.11. Einstellung der Scheiben des Zeichenzählwerkes
2.12. Einstellung der Start-Stopp-Kupplung und des
Klinkenantriebes
3. Einstellung des Chiffrators
3.1. Einstellung des Kupplungskontaktes
3.2. Einstellung des Aufzughebels
3.3. Einstellung der Ausgangsstellung der Abfühlstifte
3.4. Einstellung der Abfühlhebel der KSV
3.5. Einstellung des Gummikissens
3.6. Einstellung der Sperrschiene, die bei Erscheinen der
32. Kombination in Funktion tritt
3.7. Einstellung der Hebel zur Steuerung der Bewegung
der Kontaktleisten
4. Einstellung des Transmitters und des Dekombina-
tors
4.1. Einstellung des Feststellhebels für die Hauptwelle
4.2. Einstellung des Transmitters für eine Zeichen-
ablastung
4.3. Einstellung des Streifentransportes
4.4. Einstellung des Streifentransportes am Ende der
Fortschaltung
4.5. Einstellung des Schrittgruppenabstandes
4.6. Einstellung der Ausgangsstellung der Abfühlstifte
4.7. Einstellung des Aufzuges der Dekombinator-
schienen
4.8. Einstellung des Schlagbügels
4.9. Einstellung des Transmitters bei Wagenrücklauf
4.10. Einstellung für die Auslösung beim Abfühlen der
32. Kombination
5. Einstellung des Automatikantriebes
5.1. Einstellung der Ausschaltung des Zeichenzählwer-
kes, wenn der Knopf für Dauerauslösung Zwischen-
raum gedrückt wird
5.2. Einstellung der Start-Stopp-Kupplung
6. Einstellung des Antriebes
6.1. Einstellung des Impulskontaktes
6.2. Einstellung des Feststellhebels der Hauptwelle
6.3. Einstellung der Friktionskupplung der Wagen-
rücklaufwelle
6.4. Einstellung der Steuerung für automatischen
Wagenrücklauf
6.4.1. Einstellung der Zugstange zum Wagen
6.4.2. Einstellung der Vorrichtung, die das Auffangen des
Wagens bei Wagenrücklauf bewirkt
6.4.3. Einstellung der Ausgangsstellung des Anschlag-
Hebels
6.4.4. Einstellung des Hebels (9)
6.4.5. Einstellung der Steuerung der Zahnkupplung beim
Einschalten von Wagenrücklauf
6.4.6. Einstellung der Steuerung der Zahnkupplung nach
erfolgtem Wagenrücklauf
6.5. Regulierung der Motordrehzahl bei der Arbeit mit
Wechselstrom
7. Einstellung des Wagens
7.1. Einstellung der Schaltklinke für Zeilentransport
7.2. Einstellung der Schaltklinke und des Sektors bei
Ende des Zeilentransportes
7.3. Einstellung des Wagenauslösebügels
7.4. Einstellung der Rastklinke für Zeilentransport
7.5. Einstellung der Zahnstange für Fünfergruppen-
teilung
7.6. Einstellung der Spannung der Spiralfeder
7.7. Einstellung des Druckes der Papierandruckwalzen
7.8. Einstellung der Wagenfortschaltung
8. Einstellung des Druckwerkes
8.1. Einstellung der Federspannung der Druckerfeder
8.2. Einstellung der Ausgangsstellung des Drucker-
bügels
8.3. Einstellung des Ankerhubes der Elektromagneten
8.4. Einstellung der Ausgangsstellung der Freigabe-
hebe1
8.5. Einstellung der Anschlagstärke der Typenhebel
8.6. Einstellung der Kombinatorschienen
9. Schlußbemerkung
V. Vorschrift für die Funktionsüberprüfung des
Schlüsselgerätes
1. Allgemeines
2. Überprüfung des Streifentransportes des Lochers
3. Überprüfung, ob in der Stellung BL
des Arbeits-
umschalters der Locher und bei L
das Druckwerk
abgeschaltet wird
4. Überprüfung der Arbeit des Druckwerkes, des
Transmitters mit Dekombinator und des Lochers
5. Überprüfung der Arbeit des Chiffrators
VI. Hinweise über die Beseitigung von Fehlern
VII. Fehler und ihre möglichen Ursachen
1. Fehler, die im Zusammenhang mit dem Transmit-
ter und dem Dekombinator auftreten
2. Es liegt keine Spannung an
3. Der Elektromotor arbeitet nicht
4. Defekte,die mit dem Nichtabdrucken von Zeichen
zusammenhängen
5. Defekte, die mit der Tastatur zusammenhängen
6. Defekte, die mit dem Antrieb verbunden sind
7. Defekte in1 Druckwerk
8. Defekte, die mit dem Locher zusammenhängen
9. Defekte, die mit dem Wagen verbunden sind
10. Defekte, die mit dem Chiffrator verbunden sind
VIII. Vorschrift für das Ausfüllen von Reparaturscheinen
1. Allgemeines
2. Aufbau des Reparaturscheines
3. Benummerung der Baugruppen
4. Benummerung der Teile
5. Benummerung der Fehler
IX. Aufstellung und Lagerung der Schlüsselgeräte
1. Aufstellung der in Betrieb befindlichen Schlüssel-
geräte
2. Anforderungen an den Lagerraum
3. Regeln für die Lagerung der Ersatzteile
X. Vorschrift über die Anwendung des Material-
anforderungs- und -ausgabescheines
1. Allgemeines
2. Handhabung des Materialanforderungs- und -aus-
gabescheines
2.1. Anforderung des Bereichslagers an das Hauptlager
2.2. Anforderung eines Bereichslagers an ein anderes
Bereichslager
2.3. Anforderung des Chiffreur-Mechanikers an das
Bereichslager
3. Ausfüllen des Materialausgabescheines